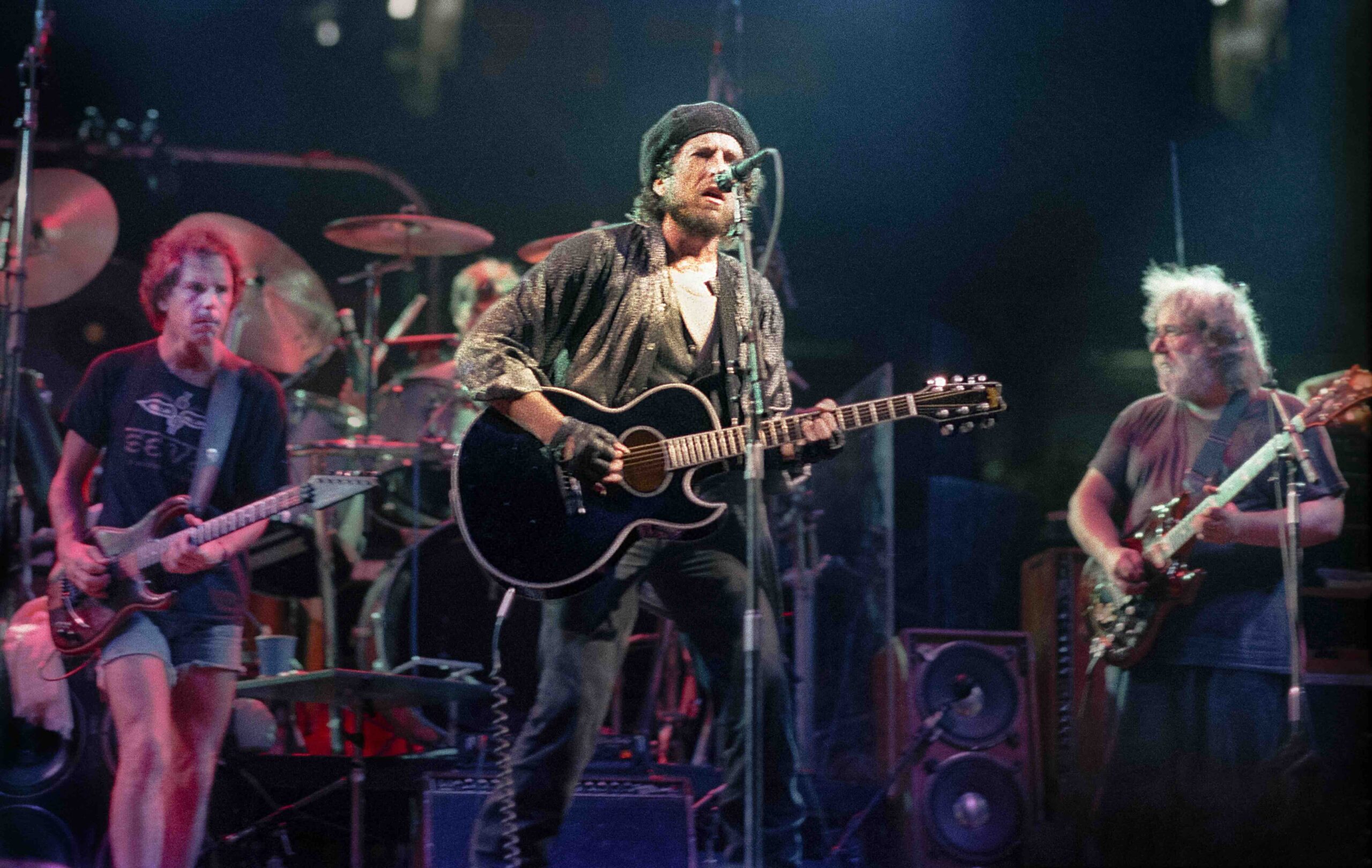Die 100 besten Singer/Songwriter Alben
Mit den besten Singer/Songwriter-Alben beginnt der ROLLING STONE seine neue Serie mit Best-Of-Listen der wichtigsten Musikgenres. Eine 60-köpfige Jury hat abgestimmt: Am Ende waren es fast 600 verschiedene Platten, die genannt wurden - manche dutzendfach, andere nur ein einziges Mal. Aber auch letztere werden gewürdigt: als kleine Extrarezensionen auf den Top-100-Seiten. Viel Vergnügen!
JENS BALZER, „Berliner Zeitung“, RS
ANDREAS BANASKI, Autor RS
ACHIM BERGMANN, Trikont
THOMAS BOHNET, Konzertveranstalter
ANDREAS BORCHOLTE, „Spiegel Online“
MAIK BRÜGGEMEYER, Redaktion RS
HANNS PETER BUSHOFF, Sony Music
REIMER BUSTORFF, Musiker (Kettcar)
CHRISTOPH DALLACH, „KulturSpiegel“
DETLEF DIEDERICHSEN, Haus d. Kulturen d. Welt WOLFGANG DOEBELING, Autor RS, „Radio Eins“
DANNY DZIUK, Musiker
CHRISTOF ELLINGHAUS, City Slang
JÖRG FEYER, Autor RS, „Deutschlandfunk“
ROBERT FORSTER, Musiker
BIRGIT FUSS, Redaktion RS
CHARLOTTE GOLTERMANN, Managerin
MAX GÖSCHE, Autor RS
THOMAS GROSS, „Die Zeit“
CHRISTOPH GURK, HAU Berlin
CHRISTINE HEISE, „tip“, „Radio Eins“
JOACHIM HENTSCHEL, „Business Punk“, RS
KLAUS KALASS, Grafiker RS
ACHIM KARSTENS, Warner Music
GISBERT ZU KNYPHAUSEN, Musiker
ALBERT KOCH, „Musikexpress“
DANIEL KOCH, www.rollingstone
NILS KOPPRUCH, Musiker
HEINZ RUDOLF KUNZE, Musiker
FRANK LÄHNEMANN, Autor RS, Marina Records
SOPHIE LEUBNER, Praktikantin RS
TOM LIWA, Musiker
EKKI MAAS, Musiker (Erdmöbel)
EVA MAIR-HOLMES, Trikont
ALEXANDER MÜLLER, Autor RS
RALF NIEMCZYK, Redaktion RS
HANS NIESWANDT, DJ und Autor
ERIC PFEIL, „FAZ“, RS
MICHAEL PILZ, „Berliner Morgenpost“
ULF POSCHARDT, „Die Welt“
JENS-CHRISTIAN RABE, „Süddeutsche Zeitung“
GUNTHER REINHARDT, „Stuttgarter Zeitung“, RS
ROBERT ROTIFER, Autor RS
JÖRN SCHLÜTER, Autor RS
FRANK SCHMIECHEN, „Die Welt“
MARKUS SCHNEIDER, „Tagesanzeiger“, RS
FRANZ SCHÖLER, „Stereoplay“, RS
BERTHOLD SELIGER, Konzertveranstalter
GREGOR STÖCKL, Musik-Manager
CARSTEN STRICKER, Agentur „Verstärker“
BENJAMIN VON STUCKRAD-BARRE, Autor
THEES UHLMANN, Musiker (Tomte)
JOHANNES WÄCHTER, „SZ-Magazin“
KLAUS WALTER, ByteFM
MARKUS WIEBUSCH, Musiker (Kettcar)
JAN WIGGER, „Spiegel Online“
ARNE WILLANDER, Redaktion RS
ROLF WITTELER, Le Pop Musik
SEBASTIAN ZABEL, Redaktion RS
JÜRGEN ZIEMER, „Die Zeit“, RS
Presented by WIMP
www.wimp.de/rollingstone
Der singende Souverän
Mit dem Singer/Songwriter nähert sich die Popmusik der Literatur – und dem Troubadour früherer Zeiten. In Selbsterforschung und Weltreflexion, Anklage und Einsicht bereichert der singende Autor die Kultur
Von Arne Willander
In der guten alten Zeit trank der Songschreiber in seinem Atelier Champagner, bevor er ein paar Melodien summte und die Kadenzen genialisch auf dem Flügel nachspielte. Er trug feine Anzüge, war ein Salonlöwe und gab große Empfänge auf weitläufigen Grundstücken in den Hamptons, wenn ihm New York zu heiß wurde. Seine Lieder waren Gassenhauer, er schrieb für Musicals am Broadway und Filme in Hollywood, und er sah fantastisch aus.
Im Jahr 1945 spielte Cary Grant den Songschreiber Cole Porter in einem Film von Michael Curtiz. Der englische Beau war eine merkwürdige Besetzung, denn Porter war von kleinem Wuchs und zog ein Bein nach, und an rauschenden Festen nahm der homosexuelle Komponist selten teil. In den 30er-Jahren war Cole Porter der erfolgreichste Songschreiber der Welt, Lieder wie „Night And Day“ und „I’ve Got You Under My Skin“ waren Schlager. Er selbst sang freilich nicht. Ein anderer großer Komponist der Zeit, Hoagy Carmichael, schrieb beschwingte karibische Klavierstücke und spielte und sang sie im Film gleich selbst, etwa in Howard Hawks‘ „To Have And Have Not“: Dort begleitet er die laszive Lauren Bacall am Piano.
Das New Yorker Brill Building war die Adresse für Songschreiber, die ein Angestelltenverhältnis eingingen: In der Schlagerschmiede Aldon Music von Don Kirshner arbeiteten Cynthia Weil und Barry Mann, Carole King und Gerry Goffin, Howard Greenfield und Neil Sedaka, und auch Neil Diamond begann dort Anfang der 60er-Jahre mit Akkordarbeit seine Karriere. Die Aufgaben von Komponist und Texter waren meistens strikt getrennt, oft saßen die Duos nicht einmal im selben Raum. Burt Bacharach, der in den 50er-Jahren musikalischer Direktor der Konzerte von Marlene Dietrich gewesen war, schrieb die meisten seiner erstaunlichen Lieder mit dem Texter Hal David, dem „Do You Know The Way To San José?“, „What The World Needs Now Is Love“ und „Raindrops Keep Falling On My Head“ einfielen. Im Rock’n’Roll und in der Soul Music wurden so viele Songs gebraucht, dass Profis wie Jerry Leiber und Mike Stoller, die Brüder Holland mit Lamont Dozier, Mort Shuman und Doc Pomus ein Universum famoser Stücke schrieben, die das thematische Spektrum weit über Liebeslyrik hinausführten. „Hound Dog“, „Heartbreak Hotel“ und „Jailhouse Rock“ sind so großartig, weil sie eine neue Metaphernsprache einführten: Wie schon Cole Porters Lieder umkreisten sie subtil das Erotische und das Dionysische, indem sie die Schauplätze verlagerten. Rock’n’Roll wie Soul handelten von Verlangen und Rausch, verbrämten die Absichten aber spielerisch. Die Körpersprache von Elvis Presley und Jerry Lee Lewis freilich machte alle Semantik zunichte.
Der Rock’n’Roll befreite den Körper – die Folk-Musik setzte den Geist in Bewegung, zunächst als Kritik der bestehenden Verhältnisse, dann als Vehikel der Introspektion. Musiker wie Dave Van Ronk etablierten im Greenwich Village in New York City eine Kultur des Kaffeehaus-Konzerts, bei dem Traditionelles ebenso zulässig war wie Selbstverfasstes. Bob Dylan war neben Fred Neil und Phil Ochs einer der Bilderstürmer der beginnenden Sechziger, deren Songs politischen Aplomb bekamen. Der Singer/Songwriter betrat die Bühne: eine einsame Stimme, oft mit Gitarre und Mundharmonika bewaffnet. Dylan trieb die Agitation mit „The Times They Are A-Changin'“ auf die Spitze und erfand damit eine auf Jahrzehnte hinaus gebrauchte Sentenz. Ein Jahr später übertrug er die bekenntnishafte Lyrik und Innenansicht auf seine Lieder: „Subterranean Homesick Blues“, „It’s Alright, Ma, I’m Only Bleeding“ und „It’s All Over Now, Baby Blue“ handelten nicht mehr von äußeren Vorgängen, sondern vom Bewusstsein. Dann kam das „erweiterte Bewusstsein“ zu Ruhm – eine wohlfeile Ausrede fürs Zudröhnen, aber auch die Quelle für Wunderwerke wie „Pet Sounds“, „Blonde On Blonde“ und „Revolver“.
Während der psychedelischen Revolution arbeitete ein anderer Typus des Songschreibers an radikal avantgardistischen Entwürfen: Schon 1962 schrieb der 20-jährige Randy Newman in der Vine Street – dem Brill Building von Los Angeles – an seinen fiesen Songs über falsche Liebe, Entfremdung und Einsamkeit. Sein Schulfreund Van Dyke Parks dichtete 1966 die Texte für Brian Wilsons „Smile“ – das Album wurde vom Establishment weggeschlossen, sein surrealistischer Charakter als systemstörend empfunden. 1968 aber brachen alle Dämme, die den Mainstream von der Gegenkultur trennten: Die Beatles individualisierten sich mit dem Weißen Album, Van Morrisons „Astral Weeks“ und die Debütalben von Leonard Cohen (Dezember 1967), Neil Young, Randy Newman und Van Dyke Parks erschienen. Käuze durften bei den größten Firmen Platten aufnehmen und Budgets ausgeben, die sonst Frank Sinatra zustanden. Randy Newman stellte dem alternden Sänger im Capitol-Turm in Los Angeles einige seiner Lieder vor und spielte „Lonely At The Top“, doch Sinatra war wenig amüsiert: Das Lied spottete über Sinatras singuläre Position als saturierter berühmtester Sänger der Welt. „Er tat so, als könnte er Noten lesen“, erzählte Newman. Sinatra lehnte den Song ab. Später sang er bei Konzerten „Something“ – „eines der schönsten Liebeslieder der Welt“ -, für das er „John Lennon und Paul McCartney“ dankte.
Bis 1970 war der Typus des Singer/Songwriters etabliert: Joni Mitchell und Laura Nyro, Jackson Browne und James Taylor, Elton John und Gilbert O’Sullivan, Mickey Newbury und Loudon Wainwright wurden auf Anhieb gefeiert. Kris Kristofferson und Willie Nelson reüssierten, Johnny Cash kam als Knast-Sänger und Quasi-Autor zurück, alle Beatles veröffentlichten Soloalben, sogar Robin Gibb versucht es allein. In der Soul Music emanzipierten sich Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green und Bobby Womack vom seriellen Prinzip der Stax- und Motown-Songschmieden, was ungefähr der Auflösung des alten Studio-Systems in Hollywood entsprach. Elvis Presley wurde noch einmal aufgerüttelt, produzierte das Comeback-Special sowie „From Elvis In Memphis“ und „Elvis Country“, die ihn immerhin als Zeitgenossen auswiesen. Bob Dylan war spätestens mit „Blood On The Tracks“ wieder dabei. Die 70er-Jahre wurden dominiert von der einsamen Erscheinung des sinn-, gott-, und wahrheitssuchenden Sängers. Der Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung, schließlich Watergate schraubten das Maß des Missvergnügens in Rekordhöhe, das haschende Hippietum ging auf in zahllosen esoterischen Friedens-, Religions- und Anti-Atomkraftbewegungen.
In den 80er-Jahren sang Elvis Costello, der beste Singer/Songwriter jener Zeit: „They’re so tired of shooting protest singers that they hardly mention us.“ Pete Townshend, immer schon ein manischer Songschreiber, sang jetzt auch. Einzelne Stimmen wie die von Tracy Chapman und Suzanne Vega übertönten auf denkbar schlichteste und ergreifendste Weise den Tumult, und sogar unter den größten Stars gab es eine gewisse Neigung zum Songschreibertum: Prince, Bruce Springsteen, Michael Jackson und Phil Collins waren beides, Songschreiber und Sänger. Und Madonna verstand sich mit einigem Recht als Autorin – jedenfalls in einem höheren Sinn.
Sie sind ja fast alle noch da: Cat Stevens kam nach langer Schaffenspause als erleuchteter Yusuf wieder, Donovan dreht seine kleinen Runden, Billy Joel nimmt keine Platten mehr auf, füllt aber Stadien, Joan Baez gibt unbeirrt Konzerte, Leonard Cohen ist der älteste bekannte Singer/Songwriter. Mittlerweile etabliert sich eine neue Generation, deren Exponenten mit anderem, oft elektronischem Instrumentarium und Gesang durchaus Singer/Songwriter genannt werden können: James Blake und Julia Holter etwa, Poliça und Grimes, St. Vincent und Aloe Blacc. Und Lady Gaga schreibt ihre eigene Geschichte auch Kapitel für Kapitel fort – nicht bloß eigenhändig, sondern mit vollem Körpereinsatz. Full circle!
1. Blonde On Blonde
Bob Dylan Columbia, 1966
Bereits auf „Another Side Of Bob Dylan“ hatte Bob Dylan 1964 die Wandlung vom Folksänger zum Singer/Songwriter vollzogen. Er sang nun vom Ich statt vom Wir, schaute in sich hinein und nicht zurück, glaubte nicht länger an Gut und Böse und war um mindestens 40 Jahre jünger geworden. Auf „Bringing It All Back Home“ und „Highway 61 Revisited“ erweiterte er sein musikalisches und poetisches Vokabular, eine Band stand ihm zur Seite, die Texte wurden surreal, die Bedeutung ergab sich nicht länger aus den Wörtern, sondern aus der Performance. Mit dem fünfminütigen „Like A Rolling Stone“ sprengte er 1965 das Popsongformat und mit der Doppel-LP „Blonde On Blonde“ ein Jahr später gar die Grenzen des klassischen Albums – nicht, weil das musikalisch notwendig gewesen wäre (die weitaus virtuoseren Beatles und Beach Boys kamen immer noch locker mit zwei Albumseiten aus), sondern weil die Texte Zeit brauchten, um sich zu entfalten, weil sie in Verbindung mit dem Spiel der Musiker weite Räume öffneten, kurz: weil „Blonde On Blonde“ eigentlich ein existenzialistisches Ambient-Album ist. Hier ist kein Sänger zu hören, der seine Wörter wie noch auf „Highway 61 Revisited“ gegen eine Bandbegleitung schleudert und hofft, dass einige von ihnen kleben bleiben, „Blonde On Blonde“ lebt vielmehr von einem Sound, der aus den sprachlichen Bildern herauszufließen scheint.
Bob Dylan hat lange nach der Zauberformel für diesen quecksilbrigen Klang gesucht und sie schließlich in der konservativen Countrymetropole Nashville gefunden. Im Zusammenspiel des Pianisten Hargus „Pig“ Robbins mit Al Koopers Orgel, dem federnd treibenden Schlagzeug von Kenny Buttrey, dem pulsierenden Bass von Joe South und den metallischen Gitarren von Charlie McCoy, Wayne Moss und Robbie Robertson.
Man kann in „Visions Of Johanna“ die Heizungsrohre husten und den Countrysender leise im Hintergrund dudeln hören, während ein paar Gestalten in einem dunklen Zimmer des Chelsea Hotel sitzen und wie in einem Beckett-Stück auf Erlösung warten. Doch immer wieder werden sie zurückgeworfen auf die Schmerzensmusik des Blues, die „Blonde On Blonde“ bestimmt und deren Struktur und Harmonik nur in den Momenten aufgelöst werden, in denen die Liebe den Raum betritt – im tänzelnden „I Want You“ und der elfminütigen Marienerscheinung der „Sad-Eyed Lady Of The Lowlands“ ganz am Ende. Dann ist es vollbracht.
Der Bob Dylan von „Blonde On Blonde“ ist danach nie wieder zurückgekehrt. Mit seiner ersten Auferstehung auf „John Wesley Harding“ ein Jahr später war er bereits ein anderer. maik brüggemeyer
2. Harvest
Neil Young Reprise, 1972
Neil Young selbst erklärte „Harvest“ zu seiner „vielleicht besten Platte“. Kein anderes seiner Alben erreichte eine solche Breitenwirkung, und das lag nicht nur an der US-Nummer-eins „Heart Of Gold“. Selten tarierte der Schrat die Extreme so wunderbar aus wie hier: Einfaches trifft auf Vielschichtiges, Tragödien auf Humor, Rumpelrock auf Romantik, Realismus auf Hippie-Träume. Und die Weisheiten von „A Man Needs A Maid“, „Old Man“ und dem live eingespielten „The Needle And The Damage Done“ haben bis heute Bestand. Dabei waren die Umstände bei den Aufnahmen in Nashville alles andere als vielversprechend: Wegen eines Rückenleidens musste Young meist ein Stützkorsett tragen. Seinem anrührenden Gesang hört man die Einschränkung nicht an. Birgit fuss
3. Blood On The Tracks
Bob Dylan Columbia, 1975
Klar, dass diese Platte stets als Verarbeitung persönlichen Liebesleids gehört wird. Und natürlich dementiert Dylan. Da glaubt man, der Rätselhafte habe die Maske abgenommen, da behauptet er, allein von Tschechow und seinem Zeichenlehrer Norman Raeben beeinflusst gewesen zu sein. Doch ganz gleich, woher diese Lieder kommen: Lange hatte Dylan nicht mehr so zwingend geklungen. Verletzt, wütend und höhnisch tönen die Songs – und sind doch so zärtlich wie nichts anderes zum Thema „zerschossene Beziehungen“. Und von faszinierender Virtuosität: Die Erzählperspektiven wechseln innerhalb einer Strophe, es entstehen ganze Filme in diesen Liedern. Alle seither veröffentlichten Schmerzensplatten wundgelittener Liedautoren müssen sich an diesem Werk messen. eric pfeil
4. Songs Of Leonard Cohen
Leonard Cohen Columbia, 1967
Eine seltsame Tages- und Uhrzeit ist es, die Leonard Cohen mit seiner ersten Platte eingeführt hat: ganz kurz nach Sonnenaufgang, aber vor dem Aufwachen. Wenn Frauenhaare noch wie Goldstürme auf den Kissen liegen, aber die Wanderer, Hotelgäste und Schlaflosen schon auf sind, an vergessene Gebete denken, die Machtgefälle der Liebe reflektieren. Und man alles, trotz des milden Lichts, eiskalt klar sieht. Der Gesang des 32-jährigen Debütanten, der als Dichter schon einen gewissen Ruf hatte, klingt beim ersten Hören auch wie eine Stimme, die einen im Halbschlaf erreicht, nicht einladend, umso verbindlicher. Mit „Suzanne“, „So Long, Marianne“, „Sisters Of Mercy“ bleibt dies Cohens meistgehörte Platte – obwohl „I’m Your Man“ mehr verkauft hat. joachim hentschel
5. Astral Weeks
Van Morrison Warner, 1968
Genie wird überschätzt. Dass „Astral Weeks“ dieses genresprengende Meisterwerk wurde, das wie kein anderes klingt, war nicht allein Van Morrisons Verdienst. Die Lieder der Platte, mit denen er die straffe Struktur des R&B, seiner Lieblingsmusik, aufbrechen wollte, probte er bereits mit kleiner Besetzung in US-Clubs. Zwei davon nahm er auch in schwerblütigen Soul-Versionen auf. Ihr betörendes Flair bekamen sie aber erst, als Morrisons Produzent Jazzer engagierte, die Morrison gar nicht kannte, obwohl sie Kapazitäten der Szene waren, und mit denen er kaum redete, sondern ihnen nur das Songmaterial vorspielte und sie dann improvisieren ließ. Und wie oft im Singer/Songwriter-Metier auch hier unterbewertet: die kongenialen Orchester-Arrangements. Andreas Banaski
6. I See A Darkness
Bonnie, Prince‘ Billy Palace/Domino, 1999
Nach seinen Palace-Alben Will Oldhams erstes Album unter seinem meistbenutzten Namen. Der Titelsong dürfte durch Johnny Cash wohl sein bekanntester sein, aber ausweglose Großwerke wie „Black“ oder „Death To Everyone“ stehen ihm kaum nach. Dabei bekennt sich Oldham hier beinahe freundschaftlich zur betrüblichen Unausweichlichkeit der Dunkelheit, deren Erkenntnis dem Leben und nicht zuletzt auch dem Geschlechtlichen den besonderen Kick verleiht. Die minimalistische Grundausstattung wird sacht instrumental und sogar mit Bläsern aufgehellt. Die Öffnung der dunklen Horizonte zu existenzialistischer Hoffnung verdankt sich allerdings vor allem der Fallhöhe zwischen Todespathos und der Lächerlichkeit irdischen Treibens. Markus schneider
7. Five Leaves Left
Nick Drake Island, 1969
Wie „The Catcher In The Rye“, tschechische Märchenfilme und Liebeskummer kann man die Schönheit von Nick Drakes Musik nur im Jugendalter in ihrer ganzen Dimension erfahren. Danach begleitet sie einen fürs Leben. Doch mit den zu oft bemühten Begriffen Melancholie und Transzendenz ist dieser aus der Zeit gefallenen Kunst nicht beizukommen. Keiner der vielen grandiosen Songwriter der 60er- und 70er-Jahre konnte so direkt aus seinen Träumen schöpfen, keiner derart unbeschwert zum Grund seines Herzens hinabtauchen, um seine Gefühle in unprätentiöse, erhabene Songs wie „Day Is Done“ oder „The Thoughts Of Mary Jane“ zu verwandeln. Und über diese zärtlich versponnenen Oden ranken Robert Kirbys malerische Streicher-Arrangements. Max gösche
8. Tapestry
Carole King Ode, 1971
Mit einem drängenden Klavierakkord geht es los: Die eher metaphysische Bewegung, von der Carole King singt, ist klar zu spüren. Über die Jahre wurde „I Feel The Earth Move“ zum beliebten Ausdruckstanzschlager bei Abschlussfesten feministischer Töpferworkshops, ein toller Song ist er trotzdem. Und „Tapestry“, das zweite „eigene“ Album der früheren Fremdschreiberin ein nahezu makelloses Meisterwerk. Carole Kings warme, geerdete, unprätentiöse Stimme schien befreit von allen Zuschreibungen. Sie klang weder verführerisch, noch schmollend, niedlich oder röhrend, sie klang „natural“. „Tapestry“ setzte den Sound für das, was die kommenden Jahre prägen sollte: Individualistischer Mainstream-Pop, der Manhattan in den Laurel Canyon beamt. sebastian Zabel
9. Nebraska
Bruce Springsteen Columbia, 1982
Im Januar 1982 saß Bruce Springsteen in einem Holzhaus in Colts Neck, New Jersey, und freute sich über ein neues Aufnahmegerät mit vier Spuren. Mit dem kleinen Kasten konnte er sein Gitarren- und Mundharmonikaspiel aufnehmen sowie seinen Gesang und die Skizzen als Demos für die E Street Band verwenden. So entstanden innerhalb eines Monats die Songs von „Nebraska“: Man hört „State Trooper“, „Atlantic City“ und „Open All Night“ an, dass sie als Rocksongs gedacht waren. Springsteen erzählt von der Einsamkeit der Autobahn vor nächtlicher Industriekulisse, von Verlorenheit und Gottlosigkeit. Und er erzählt von Mördern, die ohne Reue ins Nichts blicken, von der Epiphanie einer erleuchteten Villa und der Erinnerung an das Haus des Vaters. arne willander
10. Scott 4
Scott Walker Philips/Fontana, 1969
Einen Wimpernschlag der Geschichte lang, Mitte der 60er-Jahre, ist Noel Scott Engel alias Scott Walker der beliebteste Schnulzenheini der westlichen Welt; mit den Walker Brothers schmettert er dramatische Operettenpopstücke für junge Mädchen und sentimentale Jungs. Dann fällt er in eine ebenso dramatische Schaffenskrise – und kehrt als Operettenpopsänger mit nachtschwarzen Nihilismusstücken zurück. Vier Soloplatten singt er bis 1969 ein, die tollste von ihnen – und die erste, die er alleine textet und komponiert – ist auch die letzte: „Scott 4“. Zu schwelgerischen Streichern und lieblichem Glöckchengeklingel singt Walker über das siebente Siegel der Apokalypse und die Dialektik des stalinistischen Personenkults. Und das alles mit dem schönsten Bariton, den man sich vorstellen kann. Jens Balzer
11. Paris 1919
John Cale Reprise, 1973
Für seinen deliziösen, von den politischen und kulturellen Umwälzungen in Europa während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts inspirierten Liederreigen (der Albumtitel bezieht sich auf den Vertrag von Versailles) ließ der Avantgardist John Cale sich von Lowell George, Richard Hayward und Bill Payne begleiten – Mitglieder der amerikanischsten aller amerikanischen Bands: Little Feat.
12. Our Mother The Mountain
Townes van Zandt Tomato, 1969
Die Flöten und Geigen, mit denen Produzent Jack Clement das zweite Album von Townes van Zandt verzierte, haben die Zeit nicht an jeder Stelle überdauert. Die Songs hingegen schon. „Kathleen“, „St. John The Gambler“, „Why She’s Acting This Way“ und der Titelsong zeigen den texanischen Songwriter auf der einsamen, dunkel umwölkten Höhe seiner Kunst.
13. Sail Away
Randy Newman Reprise, 1972
Zu anschwellenden Hollywood-Streichern rührt Randy Newman im Titelsong die Werbetrommel für die Sklaverei. Die anderen Stücke auf diesem Album sind nicht weniger perfide, in allen Lebenslagen gibt Newman den Confidence Man, nimmt er den Hörer ins Vertrauen, um ihn dann übers Ohr zu hauen und hinter seinem Rücken laut aufzulachen. „That’s why I love mankind.“
14. Highway 61 Revisited
Bob Dylan Columbia, 1965
Eine Wortlawine wälzt sich durch die Vereinigten Staaten – nicht von Ost nach West wie in Kerouacs „On The Road“, sondern in Nord-Süd-Richtung. Über den Highway 61, von Dylans Geburtsort Duluth, an den Vorstädten von Elvis Presleys Heimat Memphis vorbei, bis ins Mississippi-Delta. „Highway 61 Revisited“ beginnt wie ein Märchen („Once upon a time …“) und endet im Trakt der Verzweifelten.
15. Blue
Joni Mitchell Reprise, 1971
Es war der Songwriter David Blue, der Joni Mitchell zu diesem Liederzyklus über das Zwischenmenschliche inspirierte. Heute gilt „Blue“ als die introspektive Songwriter-Platte schlechthin. Schonungslos legt Mitchell hier ihre Gefühle bloß. So durchsichtig und schutzlos wie die Zellophanhülle einer Zigarettenschachtel habe sie sich in dieser Zeit gefühlt, sagte die Kettenraucherin später.
16. Either/Or
Elliot Smith Kill Rock Stars, 1997
Er sah aus, wie man sich in den Neunzigern einen prolligen Rocker vorstellte, doch er wisperte wie ein Engel. Auf seinem dritten Album, das schon im Kierkegaard zitierenden Titel zur Transzendenz schielt, wurde dann auch die Musik himmlisch, denn Smith ließ sich von den späten Beatles inspirieren. Die Texte handelten immer noch im irdischen Jammertal, waren durchzogen von tiefen Zweifeln und Ängsten.
17. Bryter/Layter
Nick Drake Island, 1970
Der junge Mann sitzt zusammengesunken auf einem Hocker, die Haare im Gesicht, den Blick gesenkt, den Kopf voller Fragen. Ein Wunder, wie dieser gepeinigten Künstlerseele ein so elegantes, musikalisch helles Album gelingen konnte. Produzent Joe Boyd, Arrangeur Robert Kirby, John Cale und Richard Thompson hatten ihren Anteil daran. „If songs were lines in a conversation the situation would be fine.“
18. The Freewheelin‘ …
Bob Dylan Columbia, 1963
Das Songschreiben sei gar nicht so schwer, hat Woody Guthrie seinem jungen Bewunderer Bob Dylan anvertraut. Melodien gebe es schließlich schon genügend, man müsse nur die richtigen Worte dazu finden. Gesagt, getan. Auf seinem zweiten Album bediente sich der junge Songwriter der alten Folksongs und erfand sie neu, in dem er all seine Fragen, seine Wut, seine Komik, seine Liebe und seine Eifersucht hineinlegte.
19. Rock Bottom
Robert Wyatt Virgin, 1974
Robert Wyatt schrieb diese Liebeslieder, während er auf einer Insel vor Venedig auf seine Freundin Alfie wartete, die vor Ort als Schnittassistentin für Nicolas Roegs „Don’t Look Now“ arbeitete. Dann fiel er in London aus einem Fenster. Querschnittsgelähmt sang er die Songs ein halbes Jahr später ein. Freunde aus der Canterbury-Scene ließen sie klingen, als kämen sie direkt vom Meeresgrund vor Venedig.
20. Song Cycle
Van Dyke Parks Warner, 1968
Warner Bros. investierte viel in das erste Soloalbum des Wunderkindes und erwartete nach dem „Smile“-Debakel den großen Wurf. Van Dyke Parks zitierte sich jedoch wenig benutzerfreundlich durch die gesamte amerikanische Kulturgeschichte von Mark Twain über Busby Berkeley bis zu John Ford. Warner nahm’s mit Humor, in einer Anzeige hieß es: „How we lost $35,509.50 on ‚The Album of the Year‘ (Dammit)“.
21. Pink Moon
Nick Drake Island, 1972
Sein drittes und letztes Album nahm das depressive, stets am eigenen Talent zweifelnde Genie ohne magische Streicher-Arrangements auf: Zur Gitarre sang Nick Drake die traurigsten seiner traurigen Lieder, suchte „Things Behind The Sun“ und einen „Place To Be“. Zwei Jahre später starb der größte britische Song-Poet in seinem Elternhaus an den Medikamenten, die ihn leben lassen sollten.
22. On The Beach
Neil Young Reprise, 1974
Die Verhöhnung des heuchlerischen Hippietums seiner Wegbegleiter Crosby, Stills und Nash und eine der schwärzesten Platten überhaupt: „The world is turning/ I hope it don’t turn away“, singt Neil Young fatalistsich. Im zeitlupenhaften „Ambulance Blues“ höhnt er müde: „You’re all just pissing in the wind.“ Bei allem Weltekel heißt das erste Stück dennoch „Walk On“ und das tat Young eindrucksvoll.
23. Hejira
Joni Mitchell Asylum, 1976
Nach „Court And Spark“ und „The Hissing Of Summer Lawns“ die letzte Evolutionsstufe von Mitchells einzigartigem Songwriter-Jazz. Für diese hatte sie den Bass-Künstler Jaco Pastorius gewinnen können, der die eleganten, karg anmutenden Gitarren-Landschaften zum Schwingen bringt. Und mit dem lyrischen Impressionismus von „Coyote“ und „Black Crow“ hängt sie bis heute alle Kontrahentinnen ab.
24. Histoire de Melody Nelson
Serge Gainsbourg Philips, 1971
In London nahm Serge Gainsbourg dieses Album auf, das seinen Ruf als genialischer Schweinigel zemenierte: Zu Jean-Claude Vanniers Arrangements fantasierte er die Geschichte der 17-jährigen Melody Nelson, die einen reichen Lustmolch verführt und bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Dazu mischte er das aufreizende Kichern von Jane Birkin und schroffe Jazz-Riffs.
25. Bringing It All Back Home
Bob Dylan Columbia, 1965
Vielleicht waren es die Drogen, die Dylan befeuerten: Auf der ersten Seite hören wir eine neue Rockmusik: elektrisch, sardonisch, poetisch. Auf der zweiten singt Dylan drei seiner größten Songs: „Mr. Tambourine Man“, „It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)“ und „It’s All Over Now, Baby Blue“. Dann die England-Tournee, der Judas-Ruf, der Pennebaker-Film alles Mythos.
26. Grievous Angel
Gram Parsons Reprise, 1974
Kaum zu sagen, welche Gram-Platte die schönere ist. „Grievous Angel“ jedenfalls hat „1000 Dollar Wedding“, „Brass Buttons“, „Hickory Wind“. „Love Hurts“ und „In My Hour Of Darkness“. „With Emmylou Harris“ steht auf der Rückseite der Plattenhülle: Sie und Parsons harmonierten perfekt bei dieser ingeniösen Umdeutung von Country Music. Der Neuerer starb ein Jahr später an einer Heroin-Überdosis.
27. After The Goldrush
Neil Young Virgin, 1970
Das Meisterwerk, das alle Talente miteinander in Einklang brachte: die sentimentale Ballade, das große Rock-Epos, die kleine Country-Vignette, den munteren Folksong. Neben dem surrealistischen „After The Gold Rush“ stehen die Crazy-Horse-Stücke „Southern Man“ und „When You Dance I Can Really Love“. Die Vermählung von Dylan und den Rolling Stones.
28. Little Criminals
Randy Newman Warner, 1977
Der kalifornische Spötter singt über irische Mädchen, Kleinkriminelle, Albert Einstein in Amerika, eine Polizeiparade, zu kurz geratene Menschen, einen Kindesmord, einen alten Mann auf seiner Farm und eine sterbende Stadt. Newman, der präziseste Erforscher menschlichen Strebens und Scheiterns, hatte mit „Short People“ einen irren Skandalhit, doch „In Germany Before The War“ schneidet ins Herz.
29. I’m Your Man
Leonard Cohen Columbia, 1988
Er galt als Mann von gestern und litt an Depressionen, als ihm tapfere Musen zum größten Comeback seit Jesus verhalfen. Der souveräne Sarkasmus von „I’m Your Man“ lässt Cohens Schreibkrise nur erahnen: Zu moderat modernem Instrumentarium intoniert der alte Erotiker und Blasphemiker fabelhafte Songs wie „First We Take Manhattan“, und „Everybody Knows“. Unübertroffen an Lässigkeit, Witz und Würde.
30. Late For The Sky
Jackson Browne Asylum, 1974
Der Sensibilissimus und Frauenliebling der West Coast vereinte apokylptische Ängste mit den Sorgen des Moments und universellem Spiritualismus. Vor allem aber schrieb Jackson Browne die schönsten Songs, während David Lindley die Slide Guitar mäandern lässt: „Fountain Of Sorrow“, „For A Dancer“ und „Before The Deluge“; ersteres erklingt sogar in Martin Scorseses Film „Taxi Driver“.
31. Ys
Joanna Newsom Drag City, 2006
Björk im Märchen, Joni Mitchell im Wunderland: Joanna Newsom schrieb auf ihrer Harfe ein harmonisch komplexes Werk aus fünf überlangen Stücken. Diese Stimme – hier viel reifer und veredelter als auf dem Vorgänger – ist einzigartig, der Mut der Künstlerin zur Eigenart beachtlich. Van Dyke Parks‘ impressionistische Streicher-Arrangements lassen das Album hier und da wie ein 60er-Jahre-Musical klingen.
32. Tonight’s The Night
Neil Young Reprise, 1975
Young betrauert zwei Drogentote in seinem Freundeskreis – mit einem schwankenden, schief gesungenen Album, das sich mit Leibeskräften gegen glatte Oberflächen stemmt. Es schwingt etwas berührend Feierliches in diesen wunderbaren Klagegesängen. Und wenn die Band rockt, dann patzig und allem zum Trotz: dem Tod, dem Ruhm, der Einsamkeit.
33. Grace
Jeff Buckley Columbia, 1994
Mit nur einem einzigen Album wurde Jeff Buckley zur Legende: „Grace“ ist das unfassbar dichte Fanal eines Frühvollendeten. Die von Buckleys flehendem Gesang getriebenen Lieder beben und flüstern, sind ekstatisch und sakral. Buckleys Band spielt großartig und kann vom psychedelischen Led-Zep-Folkrock („Last Goodbye“) bis zum ultraleisen Songwriter-Jazz-Chanson („Lilac Wine“) alles. Unsterblich.
34. Transformer
Lou Reed RCA, 1972
Mit der Hilfe von David Bowie und Mick Ronson gelang Lou Reed doch noch der Start in die Solokarriere: Auf „Transformer“ vermischt sich Reeds ungelenker New-York-Rezitatrock mit Bowies saftigem Glam. Einiges wirkt im Rückblick etwas arg aufgesetzt, doch die fabelhaft blechernen Gitarren und Reeds ultracool vorgetragenen Stadtbeobachtungen sind zu Ikonen geworden. Take a walk on the wild side.
35. Sometimes I Wish We Were An Eagle
Bill Callahan Drag City, 2009
Nach einer kurzen Liaison mit eher herkömmlich arrangierter Musik kehrte Bill Callahan zur kargen Schönheit von Smog zurück. Callahan rezitiert kryptische Texte zu einer reduziert, bewusst schmucklos spielenden Band – und kreiert wunderschöne, überhaupt nicht distanzierte oder fremdelnde Musikpoeme, die über den Dingen schweben wie der Adler über Amerika.
36. Born To Run
Bruce Springsteen Columbia, 1975
Nach 14 quälenden Monaten im Studio hatte Springsteen seinen Sound gefunden: die große Romantik des kleinen amerikanischen Lebens, besungen in feierlichen Rock’n’Roll-Songs. In den dick (aber nie zu dick) aufgetragenen Liedern von „Born To Run“ steckt eine überlebensgroße Sehnsucht. Und die E Street Band war mit einem Schlag das beste Ensemble der Rockmusik.
37. For Emma, Forever Ago
Bon Iver Jagjaguwar, 2008
Der Waldmeister: Justin Vernon hatte Kummer und versteckte sich mit ein paar Instrumenten in einer Holzhütte. Heraus kam ein betörendes Lo-Fi-Songwriter-Album, das von Vernons vielfach geschichtetem Falsett und einer ungewöhnlich intuitiven, suchenden Musik aus Indie-Soul und Songwriter-Folk lebt. Der Wald, die Liebe, ein heiliger Moment.
38. Songs Of Love And Hate
Leonard Cohen Columbia, 1971
Schwarz-weiße Lie-der über Freundschaft, Liebe, Sex und Hass. Cohen singt hier besser als auf den vorherigen zwei Alben und treibt seine Kompositionskunst auf einen vorläufigen Höhepunkt. Produzent Bob Johnston ist gut beraten, die Lieder nur vorsichtig anzureichern – so entsteht der klassische Cohen-Chanson, wortgetrieben, elegant, romantisch.
39. Eli And The Thirteenth Confession
Laura Nyro Columbia, 1968
Auf ihrem zweiten Werk verabschiedet sich die New Yorker Songschreiberin von Kindheit und Jugend. Mit einer Mixtur aus Soul, Großstadtjazz und Pop, die das Selbstbewusstsein der Künstlerin trägt. Die eigenwilligen Arrangements, der unbeirrte Alleingang: Für viele Sängerinnen von Alicia Keys bis Sara Bareilles ist Laura Nyro mit diesem Album zum Vorbild geworden.
40. Ram
Paul McCartney Apple/EMI, 1971
Beleidigt ob der öffentlichen Schmähung, zieht Paul McCartney sich mit Gattin Linda zurück und zelebriert ein fabelhaftes Album lang die eigenen kreativen Möglichkeiten. Wieder gibt es nicht die von ihm erwarteten Singalongs, dafür viele harmonische Großtaten. Umwerfende Melodien bleiben bewusst skizzenhaft, kleine Akkordfolgen werden zu verschachtelten Harmonieetüden, der Rock’n’Roll geht surfen.
41. John Lennon/ Plastic Ono Band
John Lennon Apple/EMI, 1970
Bei Lennons erstem wirklichen Soloalbum wirkte die Urschreitherapie, die er mit Yoko gemacht hatte, noch nach: „Mother“, „Working Class Hero“, „Isolation“, „Love“, „God“ hier werden alle entscheidenden Lebensthemen verhandelt. Dass Phil Spector produzierte, hört man kaum – es sind eher karge Arrangements, die diese essenziellen Songs noch deutlicher hervortreten lassen.
42. Talking With The Taxman About Poetry
Billy Bragg Go!/Elektra, 1986
Das dritte Album des Poeten und Klassenkämpfers vereint alles, was man an Billy Bragg lieben muss: seinen Gesang, der an Woody Guthrie geschult und doch so britisch ist. Den Idealismus, der nie dem Zynismus weicht. Seinen Humor, den er auch in den zornigen Momenten nie vernachlässigt. Und die herrlichen Melodien, die all die Agitation erst so unwiderstehlich machen.
43. Rain Dogs
Tom Waits Island, 1985
Zwischen „Swordfishtrombones“ und „Franks Wild Years“ gelang Waits auch noch dieses Meisterwerk: „Rain Dogs“ erzählt vom Leben auf der Straße – jenseits der Neonlichter, im Pappkarton. Trinker und Heimatlose, Huren und Taugenichtse, Mörder und Versehrte bevölkern diese Songs, durch die Waits mit seiner einzigartigen Stimme torkelt, während einem das dunkle Klavier und Keith Richards den Rest geben.
44. Good Old Boys
Randy Newman Reprise, 1974
Der US-ROLLING STONE nannte ihn einmal den „Ambrose Bierce Of Rock’n‘ Roll“, und auch wenn man streiten kann, ob die Klavier-Attacken noch als Rock durchgehen: Newmans fünftes Album steckt voller messerscharf beobachteter Geschichten über menschliches Versagen und andere Katastrophen, (Südstaaten-)Stereotypen und ein bisschen Liebe. Und wie immer bleibt einem das Lachen im Halse stecken.
45. What’s Going On
Marvin Gaye Tamla, 1971
Das erste Album, das Gaye komplett selbst (mit-)schrieb, ist ein Song-Zyklus über einen Vietnam-Veteranen, der in ein verändertes Land zurückkehrt: Er sieht Leid, Ungerechtigkeit, Abhängigkeiten, Hass. Die unverschleierte Sozialkritik war damals eine Sensation, berührt aber heute noch genauso. Was natürlich auch an der einmaligen Stimme liegt, die einem suggeriert, dass irgendwann vielleicht doch alles gut werden könnte.
46. Desire
Bob Dylan Columbia, 1976
Streng genommen schrieb Dylan nur „One More Cup Of Coffee“ und „Sara“ allein, den Rest mit Jacques Levy. Aber auch auf „Desire“ zeigt der Meister wieder seine ganze Songwriter-Kunst – in der Heldengeschichte vom Boxer Rubin „Hurricane“ Carter, in „Rita May“ (wohl eine Hommage an die Schriftstellerin Rita Mae Brown), im ellenlangen Epos über Gangster „Joey“ Gallo und in der vergeblichen Liebeserklärung „Sara“.
47. Paul Simon
Paul Simon Columbia, 1972
Paul Simons zweites Soloalbum besiegelte die (vorläufige) Trennung des Duos Simon & Garfunkel, aber welch ein Trost: Der gewiefte Amerikaner wagte nicht nur Ausflüge in Richtung Reggae, Latin und Jazz, er hatte auch die schönsten Songtitel – siehe „Mother And Child Reunion“ (angeblich von einem chinesischen Gericht inspiriert) und „Me And Julio Down By The Schoolyard“. Perfekte Drei-Minuten-Kunstwerke.
48. Heartbreaker
Ryan Adams Bloodshot, 2000
Das Ende der wunderbaren Americana-Band Whiskeytown war auch der Beginn des wunderbaren, wundersamen Solokünstlers Ryan Adams: Manisch veröffentlichte er ein Album nach dem anderen, doch schon mit dem Debüt „Heartbreaker“ stellte er all seine Stärken aus: himmelstürmende Melodien, herzzerreißender Gesang. Es ging um nicht weniger als sein Leben: „To Be Young (Is To Be Sad, Is To Be High)“.
49. Little Earthquakes
Tori Amos Atlantic, 1992
Die Pfarrerstochter begann ihre Karriere mit einem Erdbeben: Tori Amos setzte sich ans Klavier, und ihre Verletzungen, ihre Wut und ihre Verzweiflung wurden zu kleinen, stolzen Hymnen auf das Leben (Raten Sie mal, wo Fiona Apple das gelernt hat.) Aus dem Befreiungsschlag „Silent All These Years“ wurde überraschenderweise sogar ein Hit, das Vergewaltigungsdrama „Me And A Gun“ wird man nie vergessen.
50. To Bring You My Love
PJ Harvey Island, 1995
Auf ihrem dritten Album übertraf die britische Songschreiberin sogar noch die Hoffnungen, die man in sie gesetzt hatte. Ihr Trio ließ sie hinter sich und fand stattdessen in Flood und John Parish kongeniale Produzenten für ihre Visionen. Bibelreferenzen und Blues, kühne Gitarren und Streicher, verschmolzen zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk.
51. The North Star Grassman & The Ravens
Sandy Denny Island, 1971
1969 schufen Fairport Convention mit „Liege And Lief“ das Meisterwerk des britischen Folkrocks, danach fiel die Band beständig auseinander. Sängerin Sandy Denny nahm zwei Jahre später mit Richard Thompson „The North Star Grassman“ auf, ihre glockenklare, puristische Stimme entfaltet sich hier im Kontrast zu oft überraschenden Harmoniewechseln auf das Wunderbarste.
52. John Prine
John Prine Atlantic, 1971
„There’s a hole in daddy’s arm/ Where all the money goes“ – eher lakonisch als anklagend singt John Prine die Ballade vom Kriegsheimkehrer und Junkie „Sam Stone“, mit zartem Bass und aufgerauter Stimme. Heute ein vielzitierter Klassiker, blieb dem zwischen Folk und Country oszillierenden Songwriter aus Chicago der Erfolg lange verwehrt. Es sollte 20 Jahre dauern, bis er mit „The Missing Years“ einen Hit hatte.
53. Sea Change
Beck Geffen, 2002
Das Album, mit dem Beck Hansen das Image als ironisches Sampling-Genie über Bord warf. „Sea Change“ ist ein ernster, um Einsamkeit und Enttäuschung kreisender, weitgehend akustischer Songzirkel, und eines von nur zwei Alben, die 2002 fünf Sterne im amerikanischen ROLLING STONE bekamen – das andere war Springsteens „The Rising“. Unterm Strich wohl Becks bestes, zumindest reifstes Werk.
54. Tim Hardin 2
Tim Hardin Verve Forecast, 1967
Tim Hardin schrieb einige der schönsten Songs der Popgeschichte, und einige sind auf diesem, seinem besten Album: „If I Were A Carpenter“, „Black Sheep Boy“, „Speak Like A Child“. Das Cover zeigt Hardin mit seiner schwangeren Frau Susan. Die Ehe hielt nicht, auch Hardins Leben zerbröckelte. Der Singer/Songwriter mit der sanft wimmernden Stimme starb 39-jährig an den Folgen seiner Heroinsucht.
55. Freedom
Neil Young Reprise, 1989
Hier beerdigt Neil Young die für ihn künstlerisch desaströsen 80er-Jahre. Er schrieb dazu eine stampfende Hymne, „Rockin‘ In The Free World“, und definierte Rock’n’Roll als Sound der Freiheit in einer unfreien Welt. Wie schon Youngs Hymne zur Abschiedsparty der 70er, „My My, Hey Hey“, gibt es sie elektrisch und akustisch. Insgesamt zählt „Freedom“ nicht zu Youngs besten, aber zu seinen wichtigsten Werken.
56. Imagine
John Lennon Apple/EMI, 1971
Kaum ein Lied ist so totgenudelt worden wie „Imagine“. Dabei ist es hübsch und gar nicht dumm. Man müsste es einfach noch einmal zum ersten Mal hören können. Zum Glück finden sich auf Lennons zweitstärkstem Soloalbum auch so brillante Songs wie „How Do You Sleep?“, seine Attacke auf Paul McCartney, „Give Me Some Truth“ und natürlich das unkaputtbare „Jealous Guy“. Ein Jahrzehntsong. Mindestens.
57. Graceland
Paul Simon Warner, 1986
Ein Trip nach Johannesburg rettete 1986 Paul Simons abflauende Karriere und verschaffte ihm einen neuen kreativen Schub. Filigrane, rhythmisch vertrackte Songs wie „The Boy In The Bubble“ oder „Diamonds On The Soles Of Her Shoes“ wurden sogar Simons größte Solohits. Neben südafrikanischen Musikern hatten auch Los Lobos erheblichen Anteil an „Graceland“ – was Simon in den Credits verschwieg.
58. Everybody Knows This Is Nowhere
Neil Young Reprise, 1969
Noch ein Abschied, der vom Hippie Neil Young. Mit seiner neuen Band Crazy Horse fand er 1969 zu dem impulsiven Sound, der ihm bis heute die stärksten Momente seines Schaffens beschert. Die kargen, düsteren Epen „Cowgirl In The Sand“ und „Down By The River“ haben nichts von ihrer Magie eingebüßt, Neil Youngs Wimmerkralle lebt sich erstmals richtig aus. Herrlich!
59. Hunky Dory
David Bowie RCA, 1971
Wenn es ein Singer/Songwriter-Album von Bowie gibt, dann dieses. Bis auf einen sind alle Songs von ihm selbst geschrieben und produziert. „Hunky Dory“ ist eine zugleich wackelige wie artistische Verbeugung vor Dylan, Velvet Underground und Warhol, eine Übung in akustischer Pop-Art und eines seiner besten Werke. Zu seiner Zeit ein Flop, heute unumstrittener Teil des Popkanons (ziemlich weit vorne).
60. The Thorn In Mrs. Rose’s Side
Biff Rose Tetragrammaton, 1968
Traurig, dass der Mann vielen nur in Erinnerung ist, weil er David Bowie beeinflusste: Der coverte nicht nur Biff Roses „Fill Your Heart“, er machte sich auch dessen brüchigen Falsettgesang zu eigen. Das Debüt des Vaudeville-Hippies aus New Orleans zählt mit seinen von Klimperklavier und Streichern begleiteten Bröckelmelodien zu einem der übersehenen Edelsteine des Pop.
61. No Other
Gene Clark Asylum, 1974
Clark war schon 1974 ein Ausgebrannter, dessen Genialität auf „No Other“ noch einmal in glühendem Größenwahn erstrahlte, bevor sein Stern in der Pop-Atmosphäre der späten 70er-Jahre verlosch. Im Studio verwob er Chöre und Overdubs zu einem dichten Sound. Das Ergebnis: ein kommerziell enttäuschendes, kreativ überbordendes Meisterwerk zwischen Folk, Psychedelia und Westcoast-Rock.
62. Still Crazy After All These Years
Paul Simon Warner, 1975
Von der eleganten Gershwin-Grandezza des Titelstücks bis zum schockierend-schönen Klagelied „Silent Eyes“ ist dies Simons vollkommenste Platte. Und so viel Wehmut war nie mehr. Mit Art Garfunkel besuchte er in „My Little Town“ die Plätze seiner Kindheit, schwelgte in „Some Folks‘ Lives Roll Easy“ im betörenden Brill-Building-Sound und ersann „50 Ways To Leave Your Lover“.
63. Excitable Boy
Warren Zevon Asylum, 1978
Der erregbare Junge war Zevon natürlich selbst. Und wie sich Gewalt in Kunst und Politik niederschlägt, hat musikalisch niemand besser ausgelotet als der genialische Sarkastiker. Auf „Excitable Boy“ verblüffen das Söldner-Epos „Roland The Headless Thompson Gunner“, das von Kid Rock dummdreist beklaute „Werewolves Of London“ sowie der unerbittliche Funk-Klopfer „Nighttime In The Switching Yard“.
64. Oh Mercy
Bob Dylan Columbia, 1989
Als auch die treuesten Jünger sich von ihm abwenden wollten, kehrte Dylan 1989 mit dieser von Daniel Lanois produzierten, nächtlich funkelnden Selbstvergewisserung zurück. „Political World“ bilanziert zum treibenden Talking-Blues-Shuffle den Egoismus der 80er-Jahre, „Ring Them Bells“ und „Shooting Star“ verströmen einen entspannt-feierlich Gospel, den Dylan wohl bei Leonard Cohen abgelauscht hatte.
65. Darkness On The Edge Of Town
Bruce Springsteen Columbia, 1978
Wenn „Born To Run“ die Explosion von Springsteens Rock’n’Roll-Vision war, ist „Darkness“ ein wütender, manchmal defätistischer Blick nach innen. Energieausbrüche wie „Badlands“ und „Streets Of Fire“ beschwören Gesellschaftsverlierer mal in aufrechtem Pathos, mal in zerquältem Winseln. Allein die Endgültigkeit von „Racing In The Street“ übertrifft das alles.
66. Nashville Skyline
Bob Dylan Columbia, 1969
Auch wenn man das Er-hat-sich-immer-wieder-neu-erfunden-Gefasel nicht mehr ertragen kann, ist es bei keiner Platte so augenscheinlich wie auf dieser countryfizierten. Dabei schien Dylan 1969 nach Nashville geflüchtet zu sein, um ebenjener Wandlungspflicht zu entgehen. Mit Johnny Cash als Duettpartner und mindestens fünf seiner besten Songs zeigte er dennoch faszinierende neue Facetten. Und eine neue Stimme.
67. The Madcap Laughs
Syd Barrett Harvest/EMI, 1970
Das erste Soloalbum des erratischen Sonderlings wird heute kultisch verehrt. Hört man das übersteuerte Gitarren-Fiepen in „No Man’s Land“, hört man die zwischen Glücksgefühlen und Selbstzerstörung torkelnden Melodien in „No Good Trying“, begreift man warum. Barrett stellte Jazz und Psychedelic in einen unerhörten Kontext und schuf so das, was wir heute als Lo-Fi und Indie etikettieren.
68. Wild Wood
Paul Weller Go! Discs, 1993
Was den musikalischen Reichtum betrifft, überflügelt Weller bis heute alle Epigonen, die denken, zum Talent genügt es, sich eine Mod-Frisur stehen zu lassen. „Wild Wood“ wirkt wie alle Weller-Alben zu lang, zu ausschweifend – und genau das ist das Tolle daran. Mit staubtrockenem 60s-Folk, beschwingtem 70s-Soul und einigen Instrumentalschlaufen gelingt ihm hier ein beinahe hippiesk ausgefranstes Rockalbum.
69. Court And Spark
Joni Mitchell Asylum, 1974
Dylan – so die Legende – sei eingeschlafen, als Mitchell ihm zum ersten Mal „Court And Spark“ vorspielte. Vermutlich waren ihm die kühnen Jazzkonstruktionen entgangen, auf denen federnde Folk-Pop-Meisterstücke wie „Free Man In Paris“ fußen. Mitchell vollzog hier die Emanzipation von der Folk-Elfe zur ambitionierten Künstlerin – und legte den Grundstein für Songwriterinnen wie Rickie Lee Jones.
70. Goodbye & Hello
Tim Buckley Elektra, 1967
Er sah so blendend aus wie später der junge Richard Gere und sang mit der Dringlichkeit eines vom Himmel gestiegenen Engels. Im Gegensatz zu Buckleys anschließendem Jazz-Irrsinn lebt „Goodbye And Hello“ noch von Psychedelia, von Jefferson Airplane und Love. Der „Carnival Song“ evoziert ein apokalyptisches Jahrmarktsszenario, „I Never Asked To Be Your Man“ gerät zum orgiastischen Höhepunkt.
71. Horses
Patti Smith Arista, 1975
Eine SoHo-Songwriterin Smith tritt alle Hippie-Klischees in die Tonne – und aus Poesie wird Punk. Garagenrock trifft auf französischen Symbolismus. Lenny Kaye leistet spartanische Gitarrenarbeit dazu. Im Songzyklus „Land“ plündert Smith kunstvoll das Erbe der Altvorderen, von den Doors bis zum Soul, während „Gloria“ auch als Stadionrock funktioniert. Produzent John Cale lässt die Energien einfach fließen.
72. Jonanthan Sings!
Jonathan Richman Sire, 1983
Der Befreiungsschlag. Nach seiner spartanischen Frühphase mit den Modern Lovers, in der Instrumental-Hits wie „Egyptian Reggae“ entstanden, taucht Richman 1983 mit einem gemalten Retro-Cover wieder auf. Ein rundherum poppiger Neustart voller Romantik („You’re The One For Me“), Reisefieber („Give Paris One More Chance“) und Herzensglück im Sonnenuntergang („That Summer Feeling“).
73. Mule Variations
Tom Waits ANTI-, 1999
Nach sechs Jahren Kunstpause kehrt der Mann mit der Raspelstimme 1999 zurück; mit schlammigen Stiefeln und abgeschabter Arbeiterkluft. Die Metropolen-Tristesse ist passé, stattdessen huldigt er der ländlichen Scholle. Während anfangs das höllische Hämmern von „Big In Japan“ nach Avantgarde klingt, dominiert bald eine erdige Atmosphäre. Das Erbe von Leadbelly und Blind Lemon Jefferson flackert auf.
74. Someday Man
Paul Williams Reprise, 1970
Ein Meister mit vielen Talenten. Er hat als Schauspieler gearbeitet und für die Carpenters, die Monkees und die Muppets Show komponiert. Ein genialer Handwerker, der sich 1970 mit „Someday Man“ selbst auf die Suche nach dem perfekt arrangierten Seventies-Popsong begibt. „So Many People“ ist Martin Luther King gewidmet. Bläser, Geigen, Emotionen werden zur weißen Soulmusik.
75. Gillian Welch
Revival Almo Sounds, 1996
Die Carter Family und andere Pioniere des Hillbilly stehen Pate, als Welch im klassisch gepunkteten Kleid auf dem „Revival“-Cover zum neuen Star des Alternative Country wird. Stimme und Gitarre müssen reichen, um nicht nur mit „Orphan Girl“ eine ganz besondere Magie zu entfalten. Es ist Welchs hypertraditionalistischer Ansatz, ohne Kitsch und Schmalz, der das Genre entschlackt und wieder modern gemacht hat.
76. Illinoise
Sufjan Stevens Asthmatic Kitty, 2005
Verschmitzt, komplex, vertrackt. Stevens‘ Songgebilde klingen wie poetische Zirkusnummern. Hier ein Glöckchen, dort eine Orgel oder ein Bläsersatz. Ähnlich dem auch groß angelegten „Michigan“ beinhaltet der „Illinoise“-Zyklus über 20 Stücke. „Chicago“ wird zur Minirevue, und in „To The Workers Of The Rock River Valley Region“ perlt es so gemächlich bei Lambchop.
77. Bachelor No. 2
Aimee Mann SuperEgo, 2000
Der ausgestorbene Riesenvogel Dodo, dem Mann ihr drittes Album widmet, bringt ihr Glück. Anfangs nur im Eigenvertrieb erschienen, findet die Platte nach den Erfolgen des Soundtracks zum Film „Magnolia“ (der einige „Bachelor“-Songs enthält) eine weltweite Fanschar. Die blonde Gitarristin zelebriert Wehmut ohne Pathos und ihre sphärischen Melodien in „Deathly“ oder „I Do“ werden zum sphärischen Trip.
78. Hounds Of Love
Kate Bush Novercia/EMI, 1985
Mit der famosen Single „Running Up That Hill“ meldete sich die Glöckchenfee von einst zurück. Aus dem wundersam-genialen Teenagerstar war eine Frau geworden, die selbst über ihre Kunst bestimmte. Ihre Arrangements sind purer Opern-Pop. Die B-Seite der damaligen LP verarbeitet als Konzeptstück („Ninth Wave“) die Überlebens-träume einer im Wasser treibenden Schiffbrüchigen.
79. Wildflowers
Tom Petty Warner, 1994
Pettys Karriere gestaltet sich als ausgedehnte Pendelmisssion zwischen Rock und Folk. Gelegentliche Ausflüge mal außen vor. Mit dem zehnten Album vertraut er auf die belebende Wirkung des Produzenten Rick Rubin. Und der verordnet ihm eine Direktheit ohne viel Brimborium. Mundharmonika und Piano statt großer Besetzung. Selbst wenn es mal kracht, wie bei „You Wreck Me“, darf es ruhig nach Garage klingen.
80. Pacific Ocean Blue
Dennis Wilson Caribou, 1977
Nachdem die Beach Boys in die schöpferische Todesspirale geraten waren, wagte ein Wilson-Bruder ein Soloalbum. Zwar hatte sich Dennis mit seiner Vision, einen zeitgemäßen Westcoast-Sound zu schaffen, schon früher beschäftigt. Doch erst 1977 ist es so weit: Wie in einem Kaleidoskop verschränken sich Harmonien, Riffs und Bassläufe zu bunten, flüchtigen Klangbildern.
81. Gold
Ryan Adams Lost Highway, 2001
Es ist natürlich das Adams-Album, auf das sich alle einigen können, eben weil es am besten jedes einzelne seiner Talente exemplarisch ausstellt, etwa im balladesk-stoneshaften „Answering Bell“, im Neil-Young-Brachial-Rock „Enemy Fire“ oder im Otis-Redding-Soul von „Touch, Feel & Lose“. Doch es sind die typischen Adams-Balladen „La Cinega Just Smiled“ und „Wild Flowers“, die einem das Herz brechen.
82. Bert Jansch
Bert Jansch Transatlantic, 1965
Jansch gilt neben Richard Thompson als einflussreichster Folk-Gitarrist Großbritanniens, zählen immerhin Paul Simon, Johnny Marr, Jimmy Page und Graham Coxon zu seinen Bewunderern, geschweige denn viele New-Weird-Americana-Eiferer. Sein trockenes Fingerpicking verbindet bereits auf dem Debüt flinke Instrumentalstücke mit bitteren Klageliedern und beklemmenden Einsamkeitsstudien.
83. Just Another Diamond Day
Vashti Bunyan Philips, 1970
Diese frohlockenden Flötenklänge, diese flatterhafte Stimme, bei der man mitbibbert, ob sie den nächsten Ton überhaupt noch meistern kann vor lauter Zartheit. So verzaubert das Folk-Märchen jener Fee, deren Name allein schon wundersame Rätsel aufgibt. „Diamond Day“ genügte Vashti Bunyan, um sich als sagenumwittertste Minnesängerin des 20. Jahrhunderts zu stilisieren.
84. I Am A Bird Now
Antony & The Johnsons Secretly Canadian, 2005
Die Geschichte von Antony Hegarty ist die vom hässlichen Entlein, das zum schönen Schwan wird. Sein wimmerndes Vibrato, seine fragil schwebenden Kunstlieder wie „For Today I Am A Bouy“ oder „You Are My Sister“ rührt auch homophobe Rockhörer zu Tränen. Und „Fistful Of Love“ mit Lou Reeds Rezitat-Intro ist das überwältigendste Stück Soul der Nullerjahre.
85. Joy Of A Toy
Kevin Ayers Enigma, 1969
Mit den Soft-Machine-Kollegen Robert Wyatt, Mike Ratledge und Hugh Hopper schraubte Ayers sein Debüt zu einem beschwipsten Kasperletheater zusammen, in dem das närrische Mittelaltertreiben von „Joy Of A Toy Continued“ herrscht und ein paar Gauner „The Clarietta Rag“ anstimmen. Natürlich hatte der Schelm das meiste von „Village Green Preservation Society“ und „Sgt. Pepper’s“ stibitzt.
86. The Reminder
Feist Polydor, 2007
Inzwischen ist dieser verhalten-experimentelle Pop-Sound diskreditiert durch die Heerscharen von Nachahmerinnen, die in jeder Shopping Mall im Hintergrund säuseln. Dabei hatte sich die Kanadierin Leslie Feist selbst äußerst clever einige melodische Kniffe von Chan Marshall und Rickie Lee Jones abgehört. Oder sie suchte sich gleich einen Kollegen wie Ron Sexsmith für das liebliche „Brandy Alexander“.
87. Lucinda Williams
Lucinda Williams Rough Trade, 1988
Vielleicht hat die Williams bessere Alben gemacht, aber nie klang sie verletzlicher als auf dieser schmucklosen Country-Platte. Der blecherne Sound konterkariert wunderbar ihre damals schon von den Enttäuschungen der Liebe zerfurchte Stimme. Sie warnte den Ex-Freund in „Changed The Locks“, Abstand zu halten, und fragte doch: „Am I Too Blue“?
88. The Pretender
Jackson Browne Asylum, 1976
Allein die Tatsache, dass sich Browne nach dem Selbstmord seiner Ehefrau überhaupt aufrappeln konnte, wieder etwas zu veröffentlichen, macht „The Pretender“ zu einem Dokument der Selbstbehauptung. Im Harfen-Mariachi-Stück „Linda Paloma“ hält man die Melancholie kaum aus. Und niemand von den Eagles bis Bob Seeger schrieb solch ergreifende Sehnsuchts-Balladen wie „Your Bright Baby Blues“.
89. Mark Hollis
Mark Hollis Polydor, 1998
Es dauert 19 Sekunden bis zum ersten Ton von Mark Hollis‘ bis heute einzigem Soloalbum. Dann folgen sparsame Klavierakkorde und dieser unverkennbar barmende Tenor in „The Colour Of Spring“ – die Reprise zum schönsten Talk-Talk-Album von 1986. Doch Hollis hatte sich seitdem kontinuierlich isoliert. Wie er hier Pop und Jazz transzendiert, ohne in die Esoterik-Falle zu tappen, ist schlicht meisterlich.
90. Running On Empty
Jackson Browne Asylum, 1977
Teils live eingespielt wie der Titelsong, der durch „Forrest Gump“ zu Brownes berühmtestem Song werden sollte, teils in Hotelzimmern und im Tourbus aufgenommen, fängt das Album perfekt das Gefühl des ständigen Unterwegsseins ein. Und es steckt voller Abgesänge: „The Load-Out“ ist der Road-Crew gewidmet, und in „Stay“ darf der treue Gitarrist David Lindley auch mal singen.
91. Friends Of Mine
Adam Green Rough Trade, 2003
3 Minuten 8 Sekunden (im Epilog „We’re Not Supposed To Be Lovers“) benötigt Adam Green, um bitter, böse, banal, absurd, obszön, charmant und clever zu sein. „Jessica“ (Simpson) ist fast ein zu leichtes Opfer für einen Stadtneurotiker, der auch „Salty Candy“ und „The Prince’s Bed“ im Angebot hat. Doch was wären einige Songs ohne die passgenauen Streicher von Jane Scarpantoni?
92. Heart Food
Judee Sill Asylum, 1973
Der unglücklichste, schon mit 35 verschiedene Engel der Früh-70er-L.A.-Szene vergisst Jesus, wenn er als wichtigste Einflüsse „Pythagoras, Bach und Ray Charles“ nennt. Auf „Heart Food“ arrangiert Judee Sill ihren barock-präzisen Country-Gospel üppiger, vielseitiger als auf ihrem Debüt von „There’s A Rugged Road“ bis zu „The Donor“, in dem sie ein Kyrie-Eleison-Mantra aus Stimmen und Piano-Akkorden webt.
93. David Ackles
David Ackles Elektra, 1968
Wenn Elton John und Elvis Costello gemeinsam ein Cover singen – und sich beide wünschen, sie hätten das selbst geschrieben – dann kann es sich nur um einen Song des melancholischen Wahlkaliforniers aus Illinois handeln. Allein „Down River“ und „The Road To Cairo“, die beiläufig Existenzielles verhandeln, reichen, um zu das verstehen. Und warum niemand diese Songs singen kann wie David Ackles selbst.
94. Old No. 1
Guy Clark RCA, 1975
Texas schmeckte selten so lebensnah wie auf diesem großen Debüt. Dabei gelingt es Guy Clark, hemmungslos nostalgisch zu klingen ( „Texas 1947“), aber auch ganz gegenwärtig und plastisch, in der Nachlese eines One-Night-Stands („Instant Coffee Blues“) oder im swingenden Porträt der wilden „Rita Ballou“. Dazu der bewegende Generationen-Schwur „Desperados Waiting For A Train“ als Klassiker in spe.
95. My Aim Is True
Elvis Costello 1977, Stiff
82 Sekunden „Welcome To The Working Week“ reichten, um 1977 die Ankunft eines neuen „Miracle Man“ zu annoncieren. Elvis Costello hat bessere, kreativere Etc.pp.-Alben gemacht. Doch die Alles-oder-nichts-Haltung und der raue Charme dieses mit der Leihband Clover und Nick Lowe aufgenomenen Low-Budget-Debüts bleiben unerreicht. Frühe Klassiker wie „Alison“ und „Red Shoes“ inklusive.
96. GP
Gram Parsons Reprise, 1973
Um Country gegen allen Zeitgeist noch mal funky werden zu lassen, hatte Gram Parsons für sein Solodebüt die beste Studioband gebucht, in der noch fast geisthaften Präsenz von Emmylou Harris die ideale Harmonie- und Duett-Stimme gefunden und Genre-Stücke („Still Feeling Blue“, „How Much I’ve Lied“) geschrieben, die auch neben Vintage-Material („Streets Of Baltimore“, „That’s All It Took“) bestehen.
97. Back To The World
Curtis Mayfield Curtom, 1973
Im Titelsong spricht Curtis Mayfield nicht nur schwarzen Vietnam-Versehrten aus der Seele, doch die frühe Öko-Warnung „Future Shock“ und das zeitlose Statement „Right On For The Darkness“ verdichten seinen Inner-City-Funk musikalisch noch kraftvoller. In Erinnerung bleiben auch das rührend-naive „If I Were Only A Child Again“ und die Beziehungsfrage „Keep On Trippin'“.
98. Into The Music
Van Morrison Mercury, 1979
Zum Ende der 70er gelingt Van Morrison sein bestes Album seit „Moondance“. „Bright Side Of The Road“ und „Full Force Gale“ treffen den optimistischen Grundton gleich ohne Umschweife und auch die munteren Bläser-Arrangements von Pee Wee Ellis. Doch überzeugt gerade die stillere zweite Seite des Albums mit magischen Versenkungen wie „You Know What They’re Writing About“.
99. Pirates
Rickie Lee Jones Warner, 1981
Noch schöner als Jones‘ Lieder ist die Art, mit der sie selbige inszeniert, wie sie ihre Stimme einsetzt, mal als Background-Klangbogen, mal als Jazz-Virtuosin, mal wispernd, mal flehentlich fordernd. Wie unsicher getupfte Piano-Akkorde zu einem Popsong wie „We Belong Together“ anschwellen. Oder Fingerschnippen und Slap-Bass für den Groove von „Woody And Dutch On The Slow Train To Peking“ genügen.
100. Rockin‘ The Suburbs
Ben Folds Epic, 2001
„Y’all don’t know what it’s like, being male, middle class, and white …“ Es ist von kruder Ironie, dass Folds seine kleine Titelsong-Hymne für die gelangweilte US-Vorstadtjugend ausgerechnet an dem 11. September veröffentlichte. Auf seinem Solodebüt gelingen ihm melodiestarke Milieu- und Charakterskizzen wie der Waltz „Fred Jones Part 2“ oder die Erleuchtung „Not The Same“.
Prediger der Apokalypse
Time Of The Last Seduction Bill Fay Deram Records, 1971
Das Ende ist nah Anfang der 70er-Jahre: Von überall erheben sich apokalyptische Stimmen, die vor dem Atomkrieg, dem Ökokollaps oder dem Tag des Jüngsten Gerichts warnen. Die zugleich tollste und flotteste Apokalyptikerplatte der Ära gelingt dem britischen Barden Bill Fay: Auf „Time Of The Last Persecution“ beschwört er die baldige Ankunft des Antichristen in schwarzen Himmelsschiffen. Dunkel funkeln die Folksongs, in denen Fay die Menschheit zu Besinnung und Umkehr ermahnt; mit ihren flatternden Arrangements wirkt seine Musik zugleich jazz-artig befreit. Hoffnung zu spenden vermag sie aber kaum: Rettung wähnt Fay nur in der Flucht aus der feindlichen Welt in die geheime Idylle. Mit zärtlich barmender, manchmal wimmernder Stimme ruft er die Gewillten zur heiligen Gemeinde der letzten Tage zusammen. jens balzer
Soulig, sozial, sarkastisch
Baduizm Erykah Badu Kedar/Universal, 1997
Erykah Badus Neo-Soul-Debüt lässt die erratische Weite ihres kommenden psychedelischen Universums kaum ahnen. Aber schon in diesen ersten, mit einer Ausnahme selbst komponierten Songs erkennt man die selbstbewusste wie eigenwillige Vision. Ihre bezaubernde Phrasierung kommt vom Jazz und erinnert an die introvertierte Kontrolle Billie Holidays; die soziale Wachheit greift den frühen Siebziger-Soul auf. Dabei lebt die Musik mit ihrer transparenten, basslastigen Funkyness und den sparsamen HipHop-Beats ebenso wie ihr zärtlicher, oft kryptischer Sarkasmus ganz in der materialistischen Gegenwart. Es geht um die Beziehungen der Geschlechter, die soziale Unwucht der USA und allgemein die Spannungen der Gesellschaft. Dieser wiederum raunt sie zuversichtliche Wärme, ein wenig Afrozentrismus und lustige numerologische Andeutungen entgegen. Markus schneider
Zähes Herz, große Kunst
West Of Rome Vic Chesnutt Texas Hotel, 1991
Singer? Vic Chesnutt sang nicht, er greinte, flüsterte, grollte. Songwriter? Es war das Leben, das ihm die Lieder schrieb – seine Grausamkeit, seine Schönheit, seine unerbittliche Unberechenbarkeit. Man musste diesen Mann aus Athens, Georgia nicht kennen, man brauchte nur „West Of Rome“ anzuhören, um zu wissen, dass hier ein einzigartiger Mensch von einem beschädigten Leben erzählt. Dass er dazu die schönsten Melodien schrieb, manche sofort ans Herz gehend, manche fast unerträglich zäh – das war seine Kunst. Seit Chesnutt an Weihnachten 2009 starb, fällt es schwer, seine Musik zu hören. „Y’all are all innocent/ I’m just bitching at your expense“, behauptete er in „Stupid Preoccupations“, aber das stimmte nie. In einer besseren Welt wäre ein Großer wie er gefeiert worden – und nicht verbittert und fast mittellos gestorben. The world, it is a sponge. Birgit Fuss
Britisch wie ein 5-Uhr-Tee
I Often Dream Of Trains Robin Hitchcock Midnight Music, 1984
Eine Platte, so britisch wie ein Fünf-Uhr-Tee mit Syd Barrett. Die anfängliche „Nocturne“ setzt die Stimmung: Das Album klingt, als hätte Hitchcock die Stücke bei Kerzenschein in einem englischen Schloss auf moosüberwuchertem Instrumentarium aufgenommen. Sein Thema ist das Organische, Uneindeutige: Die Lieder spielen dort, wo Mann und Frau ununterscheidbar werden, wo alte Häuser verfaulen und der Tod etwas Verführerisches bekommt: „It might sound dodgy now/ But it sounds great when you’re dead.“ Also auch ein Album mit viel Humor – als hätten Monty Python und die Incredible String Band gemeinsame Sache gemacht. Hitchcock hat seit Ende der Siebziger mit wechselnden Musikern an die 30 Alben aufgenommen. Am besten ist er aber, wenn er seine Spleens solo auslebt. Sechs Jahre später folgte das ebenfalls akustische Werk „Eye“. eric pfeil
Folk als Easy-Listening
A Distant Shore Tracey Thorn Cherry Red, 1982
This is all too much for such a small town girl …“ Mit dieser programmatischen Zeile beginnt das Solodebüt der 1982 gerade 20-jährigen Marine-Girls-Sängerin. Der 23 Minuten kurze Langzeit-Seller begeistert durch spartanischen Zauber: Außer Tracey und ihrer Gitarre gibt es nichts – keine Arrangements, keine Overdubs. Die Aufnahmekosten betrugen ganze 138 Britische Pfund, Marine-Girls-Bassistin Sam Fox zeichnete das Cover als Freundschaftsdienst. Tracey Thorn, die ihren Eigenkompositionen eine Version von Velvet Undergrounds „Femme Fatale“ hinzufügte, sang später für Style Council und Massive Attack und feierte Hits an der Seite ihres Lebenspartners Ben Watt als Everything But The Girl. Dass bis zum Nachfolgewerk „Out Of The Woods“ 25 Jahre ins Land gingen und dass dieses ein Dancepop-Album wurde, ist ein Treppenwitz der Musikgeschichte. frank lähnemann
Spuren des Gestern
Danger In The Past Robert Forster Beggars, 1990
In der Vergangenheit lagen Brisbane, London und Sydney, der gescheiterte Versuch, die Welt von der bloßen Tatsache zu überzeugen, dass der Pop seiner Band, The Go-Betweens, der schlauste und schönste des Jahrzehnts war, der Frühlingsregen und die versunkene Erinnerung, ein halbes Herz und eine halbe Seele. Robert Forster lebte als gefallene Diva im Exil. In einem kleinen Bauernhaus, irgendwo südlich von Regensburg. Er studierte die texanischen Schmerzensmänner Townes van Zandt und Guy Clark, trank viel Bier und folgte den Blutspuren ins Gestern. So entstanden diese Lieder über die Reise in die tiefste Nacht und die Liebe, die am frühen Morgen kam. Mit den Bad Seeds beschwor er in den Berliner Hansa-Studios die schwarze Magie von Nick Caves „Your Funeral … My Trial“. Er war angekommen, aber noch nicht am Ziel. „I’m a lucky man/ The best is yet to come.“ Maik Brüggemeyer
Country-Neuland
The Love Album John Hartford RCA, 1968
Ende der 60er-Jahre gelang es einer Hand-voll Singer/Songwriter, mit nur einem einzigen Song dauerhaft finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Am besten traf es John Hartford mit „Gentle On My Mind“, einer fiebrig-rhapsodischen Liebeserklärung an Julie Christies Charakter in „Dr. Schiwago“. Aus dem bemerkenswerten Frühwerk Hartfords sticht vor allem „The Love Album“ heraus, da Hartford hier nicht nur sein Ziel erreicht, „den Wortschatz der Country-Musik zu erweitern“, sondern mit einigen gelungenen Experimenten gleich das ganze Genre Liebeslied um etliche Hektar auszudehnen, etwa gleich zu Beginn mit dem Beziehungskrisendrama „Why Do You Do Me Like You Do?“ und mit dem von William Carlos Williams inspirierten, die Kunst des Weglassens perfektionierenden „The Six O’Clock Train And A Girl With Green Eyes“. detlef diederichsen
Keine Regeln
Wie Songwriter arbeiten: Paul Weller, Billy Bragg und Burt Bacharach verraten Tricks und Tücken. Ein kleiner Leitfaden in zwölf Schritten
Von John Lewis
1.
Nimm ein Notizbuch mit
„Alle Songwriter haben ein Notizbuch bei sich“, sagt Billy Bragg. „Immer. Man weiß ja nie, wann einem etwas einfällt.“ Peter Waterman ergänzt: „Du hörst kleine Schnipsel einer Unterhaltung, Witzeleien, Klischees, Wortspiele, solche Sachen eben. Und das ständig. Phrasen wie ‚I should be so lucky‘, ‚Better the devil you know‘, ‚Showing out‘, ‚Roadblock‘ – das waren alles Sprachfetzen, die ich bei Unterhaltungen aufgeschnappt habe. Ich weiß auch noch, wie ich sie alle aufgeschrieben habe. Urplötzlich ergeben sich lauter Verbindungen, und damit kannst du arbeiten.“
„Man sollte immer einen Block und einen Stift auf dem Nachttisch liegen haben“, rät Elvis Costello. „Wenn diese witzige Zeile oder die geniale und schon völlig ausgeformte Idee mitten in der Nacht kommt, erinnerst du dich sonst am nächsten Morgen nicht mehr daran. Und man sollte üben, im Dunkeln zu schreiben.“
2.
Unsinn singen
Eine Melodie ist da und auch schon ein paar Akkorde dazu. Jetzt fehlt also noch ein Text. Legendär, wie Paul McCartney die Arbeit an „Yesterday“ mit dem Zweizeiler „Scrambled eggs/ How I love the smell of scrambled eggs“ begann. Paul Weller dagegen hat bei „Going Underground“ mit einem Gitarrenriff angefangen und gemerkt, dass sich Worte daraus ergaben. „Ich habe immer wieder ‚The public gets what the public wants‘ über die Akkordfolge gesungen. Das hat dann angefangen, die Stimmung des Songs zu prägen.“
Unsinn zu singen, ist eine bei Songwritern sehr beliebte Arbeitsweise. „Ich habe so einen alten Ghetto-Blaster am Piano stehen“, sagt Gilbert O’Sullivan. „Sobald ich Akkordfolge und Melodie habe, fange ich an, bedeutungslose Silben darüberzusingen. Das nehme ich dann auf, und beim Anhören klingt immer etwas von dem Zeug wie richtige Worte oder Sätze.“ So hat das auch Frank Black mit den Pixies gemacht. Einiges von diesen Nonsensgesängen hat bis zu den abschließenden Sessions überlebt.
3.
Einfach drauflosspielen …
„Wenn du eine Schreibblockade hast, dann nur, weil du verdammt noch mal dein Instrument nicht spielst“, sagt Paul Weller. „Du musst einfach dein Instrument greifen und irgendetwas spielen. Daraus ergeben sich Ideen. Ein Riff führt zu einem Akkord, der zum nächsten Akkord führt. Und bevor du es merkst, hast du den Anfang eines Songs.“
Jamie Reynolds von den Klaxons arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip. „Geh in ein Studio, bastle dir einen Groove, sing irgendeinen völligen Blödsinn dazu, leg noch einen Breakbeat dahinter, und los geht’s.“
… nicht unbedingt auf dem eigenen Instrument
John Lennon hatte seine produktivste Phase als Songwriter in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren, als er die Gitarre zur Seite legte und damit begann, auf dem Klavier zu komponieren. Weil er auf dem Klavier nicht so gewieft war, vermied er die abgedroschenen Phrasen, die er sonst auf der Gitarre gespielt hätte. „Ein Zweitinstrument zu spielen, ist ein guter Weg aus der kreativen Sackgasse“, findet auch Paul Weller. „Sich auf Neuland zu begeben, hilft oft. Zum Beispiel spiele ich mit der rechten Hand einen Klavierakkord und mit der linken Hand eine davon völlig losgelöste Basslinie – so was bekommt man mit der Gitarre nicht hin.“
4.
Nicht mit jedem zusammenarbeiten
Schallplattenfirmen sind immer scharf darauf, hoffnungsvolle junge Musiker mit anderen Schreibern in einen Raum zu sperren; in der Hoffnung, dass es so funkt wie etwa zwischen Robbie Williams und Guy Chambers. So hätten sie es auch im Brill Building gemacht, sagt Burt Bacharach. „Die haben uns in einem Raum mit einem Piano gesteckt. Man muss bedenken, dass wir damals Kids waren, gerade mal dem Teenager-Alter entsprungen, und sie haben uns dazu gebracht, Songs innerhalb von ein paar Stunden zu schreiben. Aber dieser Druck hat oft funktioniert.“
Das funktioniert nicht immer, aber auch die schlimms-ten Erfahrungen haben ihren Vorteil. „Manchmal bist du mit einem erfahrenen Songschreiber in einem Raum“, sagt KT Tunstall. „Auch wenn vielleicht nichts dabei herauskommt, aber du lernst eine Menge einfach nur dadurch, dass du siehst, wie andere arbeiten.“
Das findet Weller nicht. „Mit Co-Autoren bin ich nie klargekommen. Bei Style Council bin ich manchmal mit einem Text angekommen, zudem Mick (Talbot) dann die Musik geschrieben hat. Aber mich mit jemand anderem in einen Raum setzen, auf zwei Gitarren zu klimpern und herumzudiskutieren – ich glaube, das könnte ich nicht. Dafür bin ich zu gehemmt. Songs zu schreiben, ist für mich etwas sehr Persönliches. Ich und Noel (Gallagher) oder Bobby G (Gillespie) haben immer mal wieder darüber gesprochen, etwas gemeinsam zu schreiben. Aber wir würden das nicht zusammen in einem Raum tun. Ich mag das Konzept vom Langstrecken-Komponieren, ein Riff oder einen Backingtrack aufzunehmen und das dann zu versenden; die andere Person bringt Ideen ein, werkelt ein wenig daran herum und sendet das zurück. So haben es Graham Coxon und ich kürzlich gemacht. Und es funktioniert prima.“
5.
Disziplin bewahren
„Songschreiben ist Arbeit“, sagt Peter Waterman. „Du kannst nicht erwarten, dass dir Gott mit einem fertigen Song eins auf die Rübe gibt. Du musst daran arbeiten.“ Genau wie Paul McCartney, Gilbert O’Sullivan, Randy Newman und Chris Difford arbeitet auch Waterman vom Büro aus. Wenn sie schreiben, verlassen sie das Haus und gehen einem Neun-bis-fünf-Job als Songwriter nach.
Ian Dury wiederum arbeitete nachts mit einem DIN-A3-Block an seinen Ideen. Den großen Weißraum füllte er mit Zweizeilern, Handlungen, Beschreibungen von Songcharakteren und generellen Ideen. Elvis Costello macht etwas Ähnliches. Er benutzt DIN-A2-Blöcke, um darauf Notizfragmente zu übertragen, die sich in Kladden und auf Diktafonen angesammelt haben. „In kürzester Zeit“, sagt Costello, „sieht die Seite aus wie so eine irre Gleichung – mit all diesen bunten Markern, die eine Strophe mit der anderen verbinden.“
Es gibt andere, die eine etwas willkürlichere Arbeitsweise vorziehen. Paul Heaton etwa schnappt sich gern seine gesammelten Notizen, fliegt in ein fremdes Land, um dort an ihnen in einem Hotel zu arbeiten. „Meine besten Texte schreibe ich, wo niemand Englisch spricht“, sagt er. „Da bist du einsam und isoliert, was gut für die Kreativität ist.“
6.
Sich auf eine Geschichte fokussieren
Smokey Robinson überredete einst Stevie Wonder, Erzählstrukturen für seine Songs zu entwerfen. „Stevies Musik war immer brillant“, sagt Smokey, „aber als er noch ein Teenager war, waren seine Texte ein einziges Durcheinander. Da stand jemand im Regen, im nächsten Augenblick befand er sich in einer Beziehung, dann ging es plötzlich wieder um eine ganz andere Person. Er hat mir erzählt, dass er nur Sachen kopiert hat, die er in meinen Songs gehört hatte. Aber er hat gelernt, dass man eine Story, einen erzählerischen roten Faden braucht, der die Worte verbindet.“
„Bei jedem Song, den ich geschrieben habe, hatte ich dieses Mädchen im Kopf. Sie hieß Bernadette“, erzählt Lamont Dozier über eine frühere Kollegin bei Motown. „Ich habe alle Emotionen zusammengefasst, die sie bei mir ausgelöst hat, und habe dann versucht, diese in einem Song nachzuempfinden. Große Songs handeln von Aufrichtigkeit, von Dingen, die dein Herz bewegen. Wenn es dir gelingt, diese Gefühle in eine Geschichte zu kleiden, hast du den Anfang eines großen Songs.“
7.
Mehr schreiben als nötig
„Ich tendiere dazu, zu viele Verse zu schreiben“, sagt Nick Cave. „Sobald ich eine Geschichte habe, empfinde ich das Schreiben als einfach. Im Studio streiche ich sie dann zusammen, sodass die Story manchmal von einer Stelle zur nächsten springt. Ich mag diese Lücken in der Erzählstruktur.“
„Zu viel zu schreiben, ist wichtig“, pflichtet Elvis Costello bei. „Das Herausstreichen schafft etwas Geheimnisvolles. Der Hörer muss sich die fehlenden Verbindungen selbst erarbeiten.“
8.
Pausen machen
David Byrne kommen Ideen beim Radfahren. „Ich halte auf dem Gehweg an und singe meine Ideen in ein Diktafon“, sagt er. Rufus Wainwright liegt gern in der Badewanne und schreibt Texte dort, wo „die Akustik gut ist“. Billy Bragg bevorzugt einen Spaziergang. „Ich gehe mit meinem imaginären Hund raus, solange wie nötig. Wenn ich nur zwei Verse brauche, laufe ich eben nur zwei Verse lang. Wenn ich zwei Verse, Refrain und Zwischenteil brauche, muss ich ein bisschen länger laufen. Das schwirrt dann in meinem Kopf herum, und wenn ich nach Hause komme, schreibe ich alles auf.“
9.
Andere Medien nutzen
„So ziemlich jeder Song, den ich bisher geschrieben habe, hat seinen Anfang beim Filmesehen genommen“, sagt Daniel Kessler von Interpol. „Gewöhnlich beginne ich den Tag damit, mir eine DVD anzusehen. Dazu spiele ich auf meiner klassischen Gitarre. Es hat etwas Meditatives, sich am Morgen in einen Film zu versenken. Das ist der Kreativität sehr zuträglich.“
Paddy McAloon findet für seine Songs oft Charaktere und Szenarios in Romanen und Kurzgeschichten; Brian Eno hat entdeckt, dass der Besuch einer Kunstgalerie bestimmte Klanglandschaften entstehen lassen kann, während Björk sich schon von vielem hat anregen lassen – von Philosophie-Wälzern bis hin zu klassischen Kompositionen. Marilyn Manson hingegen nennt als seine wichtigsten Einflüsse Nietzsche, den Satanisten-Autor Anton LaVey und Willy Wonka.
10.
Nutze die Technik, aber lasse dich nicht von ihr benutzen
„Technologie sollte als Hilfsmittel benutzt werden, aber nicht als Standard-Requisite“, sagt Peter Waterman. „Sie ist beispielsweise praktisch, um einen Drum-Loop auszuarbeiten. Das kann dich in die Stimmung bringen, einen Song zu schreiben, oder den Ideenfluss in Gang bringen. Es wird aber problematisch, wenn jeder dieselbe Technologie benutzt, dieselben programmierten Stimmen. Songschreiber-Programme wie GarageBand können hilfreich sein, aber sie verführen die Leute auch dazu, ihre Songs in einem einzigen Schema zu denken und zu strukturieren. Man hört heute viel Musik, bei der man merkt, wie das komplette Programm genutzt wurde. Zu großartigen Songs führt das nicht.“
„Leute, die hippe neue Beats so behandeln, als wären sie die Handtasche der Saison, öden mich zunehmend an“, gibt Björk zu. „Manchmal braucht man einfach das knallige Live-Schlagzeug, den Krach, die Quinte und die ganzen Unebenheiten, die sich daraus ergeben.“
11.
Deine Songs sind nicht mehr deine, wenn sie fertig sind
„Wenn du einen Song schreibst, wird er fast so etwas wie öffentliches Eigentum“, erklärt Paul Weller. „Er gehört nicht mehr dir. Er wird Teil des Lebens anderer Menschen. Dreißig Jahre lang haben andere zu meinen Songs getanzt, geknutscht, sich dazu geprügelt oder gebumst. Ein Teil von mir muss den Besitzanspruch aufgeben. Das ist schon ein bisschen demütigend.“
12.
Vergiss alles
Napalm Death haben Songs geschrieben, die nur ein paar Sekunden dauern, Burt Bacharach und John Lennon konnten sich nicht mit Songs im Viervierteltakt begnügen. Manche Songs bestehen nur aus einem Akkord. Viele Texte sind Unsinn.
Die wichtigste Regel beim Songwriting ist: Es gibt keine Regeln.
Den Text haben wir aus dem „Time Out Guide“ zum Thema „1000 Songs To Change Your Life“ entnommen. Das Buch kann online unter shop.timeout.com bestellt werden und kostet ca. 13 Euro.