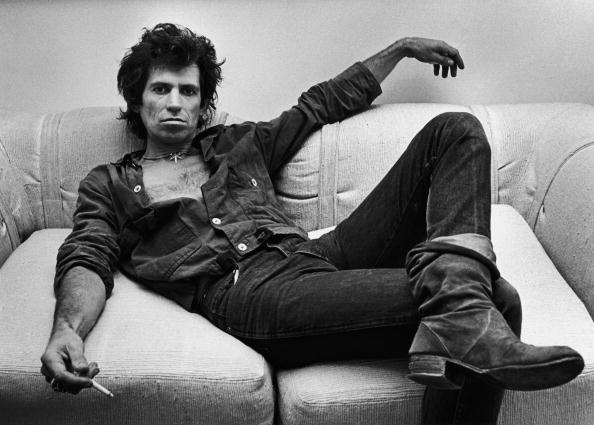Yoko Ono: It’s getting better
Sonne und Mond, Wind und Wasser: Yoko Ono findet Kraft und Kunst in den elementaren Dingen des Seins.
„Sie sollten solche Wörter nicht gebrauchen“, tadelt mich Yoko Ono mit schelmischem Lächeln, „sie haben keine Bedeutung, sind nur Bezeichnungen für etwas, das man fühlen muss, und ich weiß, dass Sie das fühlen.“ Da wisse sie mehr über mich als ich, gebe ich skeptisch zurück. „Aber ja, da bin ich ganz sicher“, erwidert Yoko, deren Lächeln nun eine Güte innewohnt, eine freundliche Intimität, die ich mir einbilden muss, denn wir sitzen uns erst seit zehn Minuten gegenüber und reden seither aneinander vorbei. Optimismus, Zukunftsvertrauen, Glauben: Begriffe, die ich also unbedingt meiden sollte. Dabei hatte ich sie mit Fragezeichen versehen, etwa so: „Woher nehmen Sie dieses unendliche Zukunftsvertrauen, das aus Ihren Songs spricht?“. Aus Songs wie „Healing“, zunächst appellativ: „Let’s change the negative energy to create the beautiful future“, dann anleitend: „It’s very simple, clean the water. Each one of us, are 90% water.“ Yoko Ono legt keinen Wert darauf, ihre Gedanken zu literarisieren. „Das ist überflüssig, denn es geht mir nur darum, die Vibrationen meiner Worte in Einklang zu bringen mit den Vibrationen des Universums“, sagt sie, „eins zu werden mit diesem Mysterium“. Weshalb sie ihre Texte extemporiert, während der Aufnahmen im Studio, „als ob ich meinen eigenen Gedanken lauschte und sie in Töne verwandelte“: „Imagine peace. The sun is rising. The ocean is shining. We are smiling. It’s getting better.“
„Between My Head And The Sky“ heißt sinnigerweise Yokos neues Album, das erste seit 1975 unter dem Moniker Plastic Ono Band. Sohn Sean, der die musikalischen Fäden zu Moms Spontanpoesie zog, hatte darauf bestanden. „Für ihn ist der Bandname vielleicht so wichtig“, mutmaßt Ono, „weil er ihn an die Zeit vor seiner Zeit erinnert, die er nur als Legende kennt.“
Die Musik, die Sean der Mutter ursprünglich zu Gehör gebracht hatte, „war sehr interessant, doch es fehlte ihr an Feuer, also betrachtete ich es als meine Aufgabe, Feuer darin zu entfachen“. Sie tat dies mit Improvisationen, die den vordergründigen Sounds zwischen Electro-Beats, Gitarrenjaulen, abstraktem Funk und konventionellen Piano-Pastoralen etwas Kostbares, weil Unverwechselbares beimengten: Yokos Stimme.
Ein Instrument, das mühelos alles esoterische Gesäusel der Worte vergessen macht, ein Heulen, Kreischen, Gurgeln und Schreien, das spitz ins Mark dringt, indes schon lange nicht mehr so weh tut wie vor gut 40 Jahren, als Yoko ihre Gesangskunst im „Rock’n’Roll Circus“ der Rolling Stones zum Besten gab. Eine Mutprobe, nicht weniger. „Niemand mochte das, niemand“, erzählt sie, „keiner der Beteiligten sagte etwas dagegen, und ich weiß es zu schätzen, dass sie meinen Auftritt nicht löschten, aber in Wahrheit fanden das alle schrecklich damals. Auch Sie, oder nicht?“. Yoko lächelt nachsichtig, während ich wortreich versuche, aus dieser Nummer herauszukommen. „Lassen Sie nur, das ist okay“, bremst die Künstlerin meinen Redeschwall, „aber ich werde Ihnen sagen, was mich ärgert: dass die Stones nicht den besseren der beiden Takes genommen haben. So weit ich mich erinnere, war meine Performance bei der anderen Aufnahme, die keiner zu hören oder zu sehen bekam, viel eindringlicher.“
Abends bei der Vernissage mit einigen ihrer Installationen wird Yoko Glitzerjäckchen und Zylinder tragen, jetzt sitzt sie barfuß auf dem Sofa ihrer Suite, die Beine angezogen, den Berliner Bären auf einer Jacke, die es für 29.90 in den Souvenirshops am benachbarten Kudamm gibt. Vor fünf Jahren habe sie das Textil gekauft, lacht sie, und es gehöre zu ihren bevorzugten Kleidungsstücken, weil es unheimlich bequem sei. Eine bizarre Bescheidenheit, weiß man um den materiellen Reichtum dieser Frau. Yoko hält das nicht für erwähnenswert, verweist stattdessen auf den schmerzlichen Antagonismus zwischen Avantgarde-Kunst und jenem Mangel an Bildung und kultureller Partizipation, der seinen Ursprung in Armut hat. „Mir ging elitäres Getue schon immer gegen den Strich, all meine Bemühungen, das Publikum auch sinnlich in meine Kunst einzubeziehen, gründen nicht zuletzt in rigoros demokratischer Gesinnung“, sagt die vor fast 77 Jahren in eine der privilegiertesten Banker-Familien Japans Geborene.
Durch Onos Kunst zieht sich die Einbindung des Jedermann wie ein roter Faden, ob sie das Publikum aufforderte, ihr Werk buchstäblich zu betreten, es zu zerteilen, ihr die Kleider vom Leib zu schnipseln oder sich zu verstecken „until everybody dies“, stets stand der Gedanke im Vordergrund, das bloße Betrachten sei nichts, erst die Einmischung des Betrachters und eine Dosis Dada-Humor bei der Bilderstürmerei erwecke ihre Kunst zum Leben. Einst dafür geschmäht, füllt Onos agitativer Konzeptualismus längst ganze Seiten in Handbüchern über moderne Kunstgeschichte. Meist unter dem Stichwort Fluxus, obwohl sie sich dieser Bewegung nie zugehörig fühlte.
Was die Frage aufwirft, wie Yokos so eigenwilliger wie eigenständiger Beitrag zur Musikgeschichte in Erinnerung bleiben soll, in fernerer Zukunft. „Was meinen Sie genau?“, fragt Yoko argwöhnisch. Nun, ihren unverwechselbaren Gesangsstil, dieses expressive Intonieren ohne Worte: wailing, howling, squealing? „Oh das“, entspannt sie sich, „sicher, man könnte das schon als spezifischen Beitrag zur Musik ansehen, immerhin tut das ja sonst niemand.“