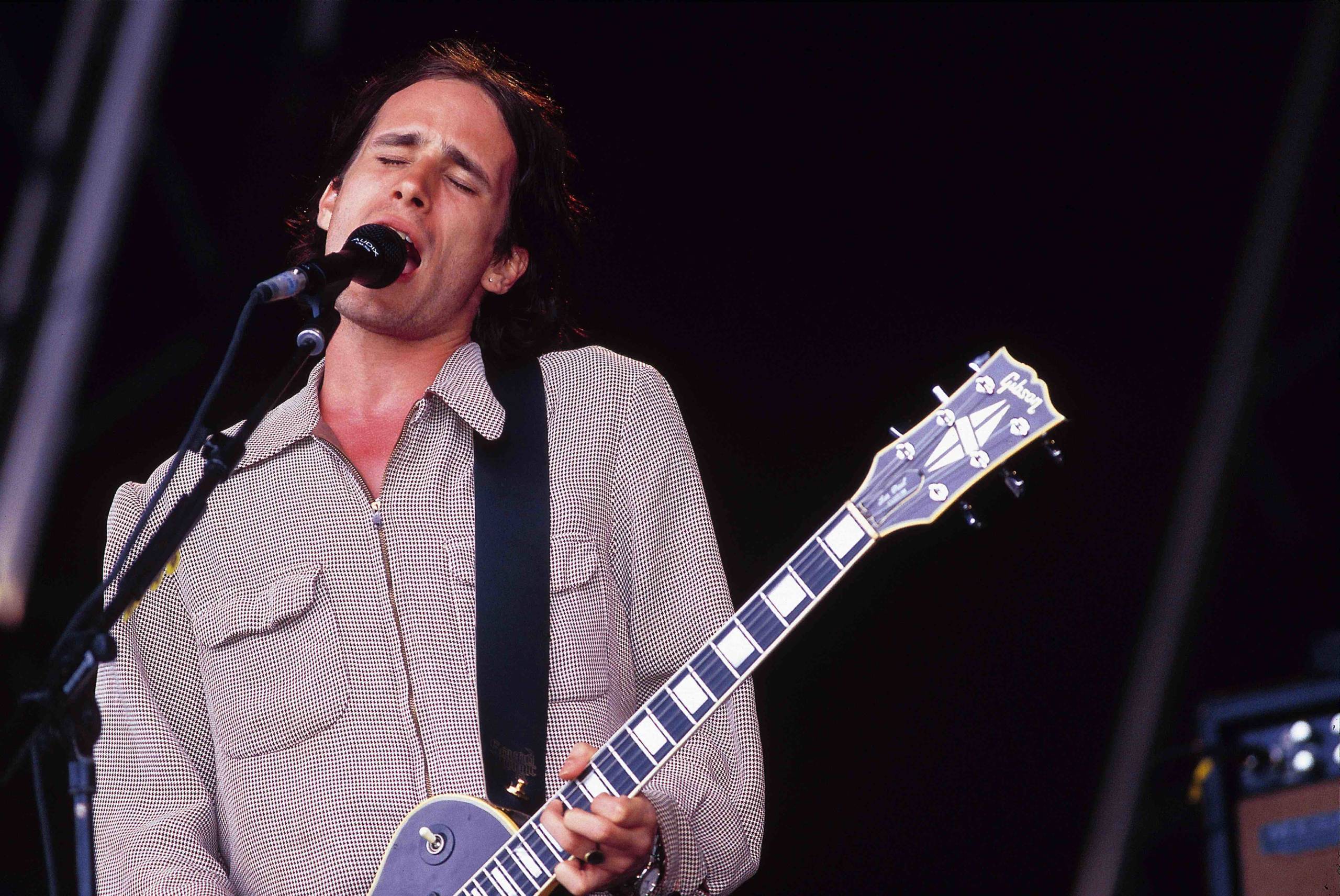WORKING ON MAGGIES FARM – Pop und Politik

Der Rausch war gewaltig, der Kater um so größer. Nach 18 Jahren Tory-Trauma hatte Englands Pop-Elite fast geschlossen für Tony getrommelt. Der Kontrast zu Major und Thatcher, diesen grauhäutigen Polit-Zombies, konnte nicht krasser sein: Der Bursche hatte früher tatsächlich in einer Rockband gespielt – Glam-Rock. Cool! Und quälte die Queen mit dem impertinenten Ansinnen, die britische Nationalhymne „afro-karibisch“ aufzupeppen. Cool! Er versprach, in der immer wieder verdrängten Diskussion um die Legalisierung weicher Drogen endlich mit vorsintflutlichen Ressentiments aufzuräumen. Cool!
Nicht mal zwölf Monate später ist in Blairs „Cool Britannia“ Heulen und Zähneknirschen angesagt. Verraten und verschaukelt habe man sie, zetern die betrogenen Wahlhelfer – nichts, aber auch gar nichts sei von den vollmundigen Versprechungen Wirklichkeit geworden. Mehr noch: Blair packe plötzlich sozialpolitische Marterpfahle aus, die selbst die Tones wohlweislich in ihrer Folterkammer versteckt hielten. Obenan: die Streichung des Arbeitslosengeldes für Jugendliche unter 25 Jahren. (Wer nicht umschult, wird nach sechs Monaten zum gesetzlichen Mindestlohn zwangsrekrutiert.) Dabei sei es doch nachweislich die „Stütze“, die für den Britpop-Boom verantwortlich sei; nur dank des staatlichen Almosens seien zigtausende arbeitsloser Talente in der Lage gewesen, die britische Musikszene zu dem Dorado zu machen, um das die ganze Welt England beneide. (Was argumentativ wohl arg krude sei, spöttelte prompt der „Economist“. Schließlich gäbe es gleich vor der Haustür den schlagenden Beweis, daß ein soziales Himmelbett nicht in kausalem Zusammenhang zu musikalischer Kreativität stehe: Deutschland!)
Just hier, im beschaulichen Hort teutonisch-tumber Zufriedenheit, sollen wir nun aber Zeuge werden, wie das Modell Blair auf seine internationale Kompatibilität getestet wird.
Sicher, Gerhard spielt nicht Saxophon. (Bei den Scorpions durfte er nicht mal die Maracas schütteln!) Trotzdem dürfte selbst einem phantasielosen Macher wie ihm nicht verborgen geblieben sein, daß die beiden Prototypen des Pop-Präsidenten nicht etwa deshalb erfolgreich waren, weil sie brav ihre demographischen Hausaufgaben machten und ein paar unentschlossene Jungwähler fischten. Es geht ums nackte Image, um die Projektion jugendlicher Unverbrauchtheit und mentaler Flexibilität (Wir müssen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts annehmen!) – und diesen Trüffel können selbst gänzlich amusische Machtmenschen finden, so sie nur lange genug im Pop buddeln.
Vor 30 Jahren waren es Literaten, die „Real-Politik“ mit dem Gütesiegel humanistischer Nachdenklichkeit zu verbrämen hatten. Willy Brandt ließ sich von Günther Grass staatsmännische Größe andichten – und lernte schnell, mit stirngefaltetem Pathos über „Lebensqualität“ und andere Nebulösitäten zu bramarbasieren.
Inzwischen kann man sich den Besuch bei der PEN-Tagung in Worpswede getrost schenken. Wer Pop kommunizieren will, muß die pop-mediale Klaviatur beherrschen. Bill Clinton beherrscht sie meisterlich. Es war gelebte Volksnahe, ab er im US-Fernsehen sein Saxophon auspackte; es war ein wahlkampftaktischer Volltreffer, ab er sich der Clip-Kid-Generation im MTV-Studio stellte. Nach wie vor holt er sich die Eltons und Jackos ins (Weiße) Haus – und hat auch keine Scheu, auf dem Cover von „Vanity Fair“ als graumeliertes Fotomodell zu posieren („Bill Clinton wears pants by Donna Karan“). Das ist Pop. Und das zählt mehr als tausend Reden.
Gerhard muß vorerst noch kleine Brötchen backen. Guten Willen kann man ihm nicht absprechen. Er propagiert die Realisierung des deutschen „Rock-Radios“, fördert – als Schirmherr der „VW Sound Foundation“ – engagiert den deutschen Nachwuchs (darauf haben wir gewartet!), kündigt sein Erscheinen bei der „Echo“-Verleihung an (kommt, zur Enttäuschung aller, dann aber doch nicht), gibt so fitfor-funnigen Magazinen wie „Amica“ ausführliche Interviews, in denen man ihn erstmals „so richtig als Mensch“ kennenlernen darf.
Die kollektive Unterstützung des deutschen Pop-Schaffenden aber wird er sich abschminken müssen. Von seinem „guten Freund Udo“ abgesehen, winken die potentiellen Kandidaten müde ab. Vielleicht, weil Schröder nicht die politische Alternative ist, die Clinton und Blair für sich reklamieren konnten? Oder weil Pop der deutschen Mentalität noch immer so fremd ist, daß die zwei Königskinder nicht zueinander finden konnten?
Den Liebeskummer der Britpop-Wahlhelfer vor Augen, können sich die deutschen Kollegen nur dazu gratulieren, daß die Affare in Ermanglung gegenseitiger Attraktion bereits im Keime erstickt Für den Politiker mag sich die Schein-Ehe ja in baren Prozenten auszahlen der Musiker ist immer der Depp.
So wird’s immer sein – und so war’s auch schon, als Pop mit den Beatles begann. Stolze Gesichter sieht man auf den alten Fotos, damals, ab sie den Orden des Britischen Empires empfingen. Ab Downing Street dann die US-Vietnam-Politik sanktionierte, schickten die Würdenträger ihre Plaketten kommentarlos an Harold Wilson zurück. Und ein nicht minder desillusionierter Dylan – Thatcher seherisch vorwegnehmend? – schrieb: „I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more.“