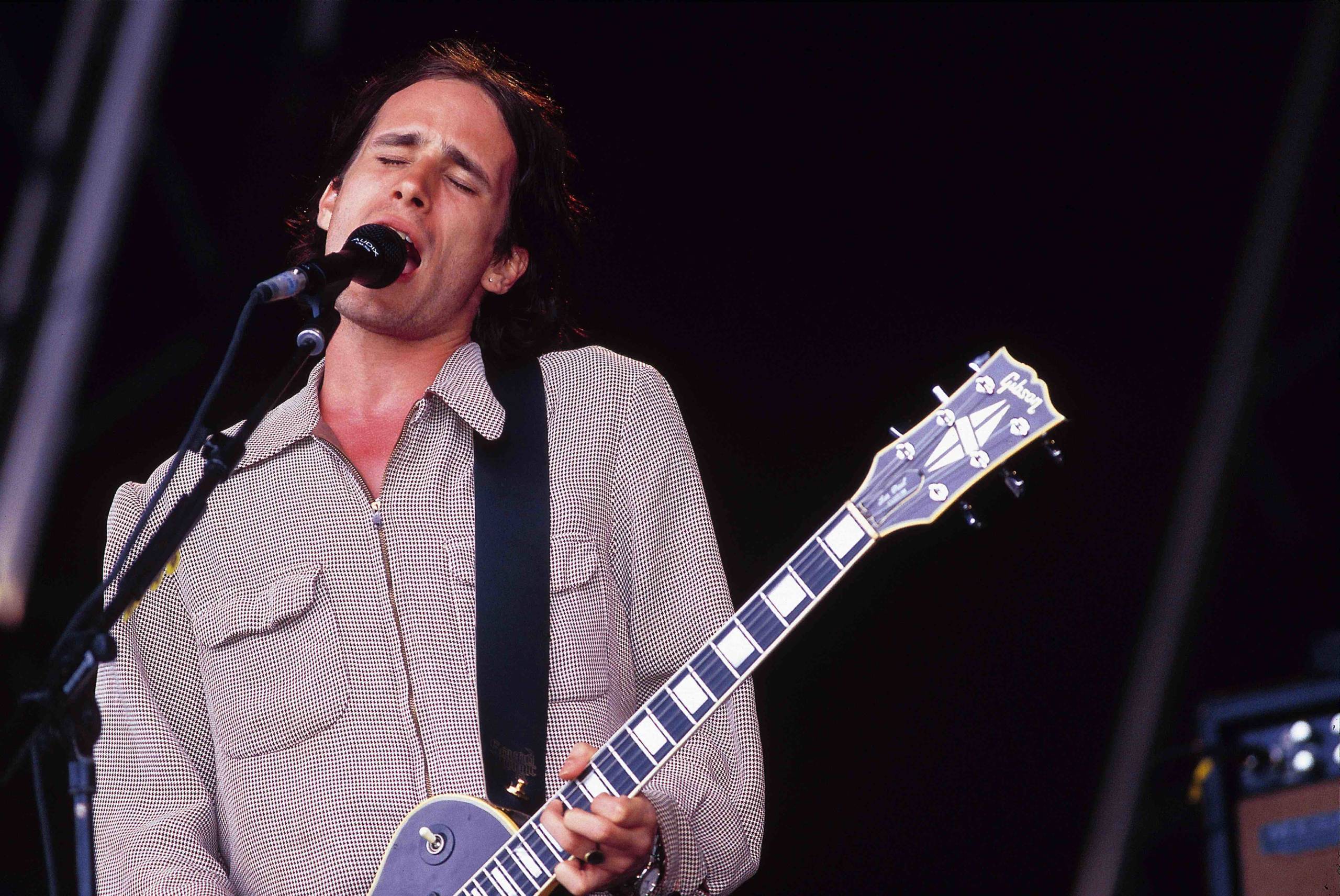Wolfgang Doebeling über das drastische Auseinanderdriften der Pop-Großmächte und die neue, bedenkliche Kleinstädterei

Als eine Gruppe englischer Austausch-Studenten neulich von einer sechsmonatigen Hospitation in amerikanischen Colleges zurückkam und ihre Erfahrungen via BBC-TV mit der Nation teilte, hörte sich das phasenweise an, als hätten sie den Mondkühen beim Kalben zugesehen. Es werde drüben kaum gelesen, aus der hohlen Hand debattiert, und Theorie sei ein Fremdwort. Aber, so hub der Moderator versöhnlerisch an, da gebe es ja auch sicher einen common ground zwischen der Jugend beider Länder. Immerhin höre man ja zum Beispiel diesselbe Popmusik.
Schallendes Gelächter, höhnische Heiterkeit. Nein, meinten die jungen Briten, nachdem sie sich beruhigt hatten, auch diesbezüglich sei ihnen alles fremd vorgekommen. Pop finde nicht statt, Dance noch weniger, und aktuellere Amalgame aus beiden, Drum ’n‘ Bass etwa, kenne keiner. Die schwarzen Kids hörten ausschließlich HipHop, die weißen Rock, und hier wie da klinge alles gleich, sei völlig austauschbar. Namen irgendwelcher Bands hatte man nicht extra memoriert. Das lohne sich nicht, war die einhellige Meinung, diese neuen US-Überflieger hätten weder Songs noch Gesicht oder gar Charakter. „Eine hieß“, volontierte ein Mädchen, „Ever… something“.
Da können wir helfen. Eine Konsultation der „Billboard“-Charts läßt zwei Lösungen zu: Everlast und Everclear. Und wenn wir schon dabei sind, sollen auch ein paar mehr derzeit zwischen den Küsten reüssierende Rock-Acts namentlich Erwähnung finden: Fuel und Eve 6, Creed und Speed, Sevendust, Pushmonkey und Remy Zero. US-Hitparadenstürmer samt und sonders, Nullen in Britannien (und auf dem Euro-Kontinent sowieso). Umgekehrt ist es nicht anders. UK-Lieblinge wie Pulp oder Paul Weller, Catatonia, The Beautiful South oder die Manic Street Preachers werden in der Neuen Welt weitgehend ignoriert; von Tindersticks, Portishead oder Belle & Sebastian einmal ganz zu schweigen.
Die Kluft ist eklatant so wenig Kommunikation zwischen der Popjugend Amerikas und Britanniens war nie, seit Elvis Europa wachküßte und die Beatles im Gegenzug den Mittleren Westen zivilisierten. Schon einmal war seither der transatlantische Faden gerissen, damals, in den Post-Punk-Jahren 77 bis ’80, als sich der Moloch US-Markt selbst von den dornigsten Eigengewächsen nicht aus dem popmusikalischen Tiefschlaf reißen ließ. Patti Smith, Television, Blondie, Talking Heads, die Ramones – sie alle mußten den Umweg über London machen. Im Niemandsland zwischen NYC und LA galten sie sowenig wie die Sex Pistols, Buzzcocks oder The Jam. Trotzdem wiesen die Bestseller-Listen selbst zu jener Zeit mehr Gemeinsamkeiten auf ab heute.
Die Fakten sind frappierend. Ende November okkupierten britische Künstler ganze 6 (sechs) Prozent der US-Album Charts: All Saints, Spice Girls, George Michael, Phil Collins, Black Sabbath, The Rolling Stones. Umgekehrt sah es nicht viel besser aus. Nur zehn der bestverkauften LPs im UK waren amerikanischen Ursprungs, darunter Greatest-Hits-Sammlungen von Aretha Franklin, Mariah Carey und Meat Loaf. Von wegen Kulturaustausch. Pop als Weltsprache hat fürs erste ausgedient, die Zeichen stehen gut 40 Jahre nach dem Urknall der globalen Rock ’n‘ Roll-Revolte auf Isolation, die Perspektiven sind zappenduster.
Das MTV-Konzept „Think global, act local“, Sympton und Katalysator der neuen national-egoistischen Marktstrategien bei Medien- und Plattenkonzernen, hat sich als krasse Fehlspekulation entpuppt. Für MTV sowieso, denn der einstige Monopolist hat sich so lange heillos angepaßt und stillos angebiedert, bis er obsolet wurde. Vom weltumspannend konsensstiftenden Multiplikator an die Peripherie regionaler Egoismen in fünf Jahren. Was für ein Niedergang. Heute albern auf MTV Figuren in der jeweiligen Landessprache, die schon jenseits des nächsten Schlagbaums keiner mehr kennt. One world: what a joke. Vereintes Europa: auch nicht in Sachen Pop. Alles schmort im eigenen Saft. Nicht einmal der Moniker „Music Television“ stimmt noch. Musik ist nur mehr ein Schmiermittel fürs Idiotenkarussell aus Spiel-, Quiz-, Flirt-, Plauder- und Pennäler-Peinlichkeiten. Dazu braucht es kein MTV, das kann VIVA noch ’nen Zacken sinnärmer, also erfolgreicher.
Ein VIVA für jeden Markt und keine Dorfjugend sehnt sich mehr nach dem Duft der großen, weiten Welt. Dieter Gorny, so hört man, will sein lukratives Modell schon bald nach Polen exportieren. Vorreiter in Sachen Kulturchauvinismus ist freilich Frankreich, wo der Schutz der einheimischen Bevölkerung vor ausländischen, sprich: Anglo-Einflüssen bizarrste Blüten treibt. So weit sind wir hier noch nicht. Von der Forderung nach einer Staatsquote für deutsches Liedgut im Radio wollen inzwischen noch nicht einmal die etwas wissen, die den perfiden Wisch seinerzeit signierten (von ein paar trotzig tümelnden Unentwegten abgesehen). Ist ja ohnehin Selbstbetrug, die Sache mit der autonomen deutschen Popmusik. Entfernt man die amerikanischen und britischen Einflüsse, die Beats, die Sounds, den Ghetto-geborenen, armschlenkernden, autistischen Bewegungsablauf (Sie wissen schon, das affige Gefuchtel, das wir, in Anbetracht dessen, daß es offenbar noch keinen Namen hat, „Moronisieren“ taufen), bleibt stets nur Schlager. Oder Räpp. Es ist eng geworden in der Welt des Pop. Elvis weint