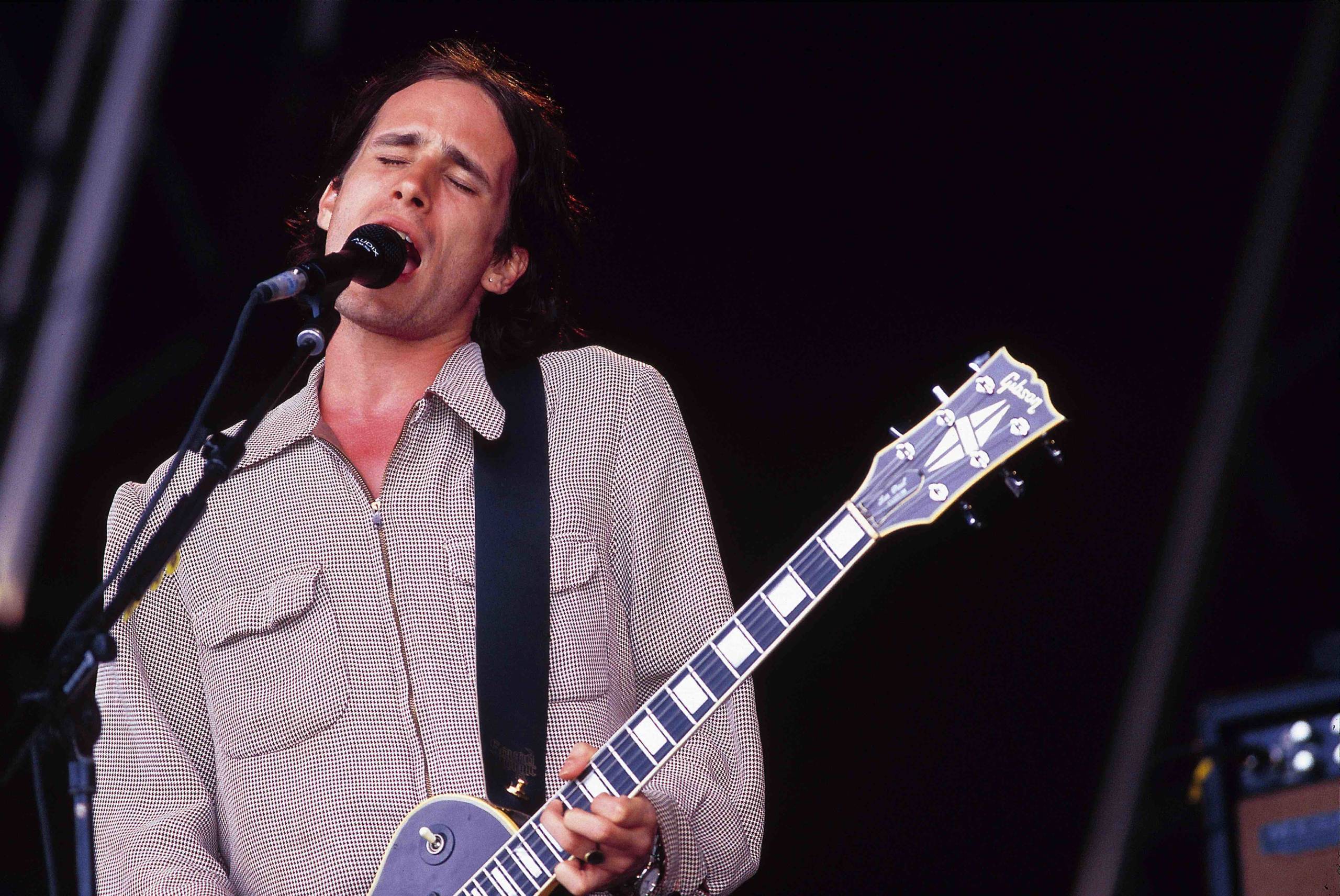Wie der Rock’n’Roll nach Deutschland kam
Gerade mal 40 Jahre sind vergangen, und doch sind die Fünfziger Jahre schon ein Tummelplatz für Klischees, Legenden und Halbwahrheiten geworden. In seinem Buch "Roll Over Beethoven" rückt Rüdiger Bloemeke das Bild der "goldenen Fünfziger" zurecht: Im vorliegenden Vorabdruck beschreibt er Macher und Miesmacher, Visionäre und Verhinderer, die Invasion aus den USA und den Wiederaufbau der deutschen Plattenindustrie.

Wahnsinnszeiten müssen das gewesen sein: Alle Welt tanzte „Rock Around The Clock“, im Radio spielte täglich „Tutti Frutti“, und Elvis kam nach Deutschland. Um die 50er Jahre rankt sich ein Mythos: Es waren angeblich die „wilden Jahre“, die Zeit des Umbruchs, der Modernisierung, der ästhetischen und kulturellen Innovation, in der ein Schlußstrich gezogen wurde nach Jahrzehnten der totalitären Gleichschaltung und beschränkten Deutschtümelei. Das Bild, das von der Adenauer-Ära gemalt wird, gerät so zur Collage aus einzelnen Highlights. Nicht anders erklären sich Einschätzungen des Stils des „Nachkriegsjahrzehnts“ wie diese von „Trendforscher“ Matthias Horx: „Tütenlampen, Petticoats und Nierentische, Rock’n’Roll oder stromlinienförmige Autokotflügel prägten eine kohärente Alltagsästhetik, die überall in der westlichen Welt verbindlich war. Ein bestimmtes Werte-Set wurde von einer Mehrheit für gültig gehalten.“
Selbst wenn man die 50er Jahre nur aus alten Wochenschauen und Fernseh-Rückblicken kennt, kann man nicht übersehen, daß die Mehrheit in Deutschland ein völlig anderes „Werteset“ hatte. Es gab sie nicht, die „schöne neue Welt“ der Fünfziger. Die zehn Jahre, die in der Bundesrepublik mit der Abschaffung der Lebensmittelkarten begannen und mit der Wahl des Bundespräsidenten Heinrich Lübke endeten, werden mit solchen nachträglichen Wertungen verfälscht und mißdeutet. Vor allem waren sie nicht die „verrückten Jahre“, in denen alle Rock’n’Roll tanzten und in Ami-Schlitten mit riesigen Heckflossen durch die Gegend fuhren.
Vergilbte Familienfotos- schwarzweiß mit gezacktem Rand – zeigen uns stolze Besitzer von VW-Käfern, Lloyd-Leukoplastbombern, DKW-Zweitaktern, Messerschmidt-Kabinenrollern oder BMW-Isettas. In den Wohnungen gab’s tatsächlich Nierentische und Tütenlampen, doch aus den Röhrenradios mit dem grünleuchtenden „magischen Auge“ kam kein Rock’n’Roll. Den Sound der 50er Jahre bestimmten Caterina Valente, Vico Torriani, Freddy Quinn, Will Glahe und Ernst Mosch.
Daß nicht Elvis und Little Richard den Ton angaben, dokumentieren die Statistiken der Plattenfirmen. Bei der Deutschen Grammophon, die Bill Haley als auch Buddy Holly im Programm hatte, bekam Rene Carol („Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein“) 1954 die erste Nachkriegs“Goldene“ für 500 000 verkaufte Singles; 1956 folgte Freddy mit „Heimweh“. Erst 1957 – zwei Jahre, nachdem die Platte in Deutschland erschienen war – kam Bill Haley („Rock Around The Clock“) dran. Noch deutlicher zeigt die Chronik der Teldec, wie es um den musikalischen Geschmack bestellt war. Als erste schafften das Rodgers Duo („Das alte Försterhaus“) und Will Glahe 1956 und ’57 Gold. Die nächsten beiden Musiker, deren Singles sich 500 OOOmal verkauften, kamen zwar vom amerikanischen Kontinent, aber ihre Hits von 1958 waren „Instrumentals“, zu deutsch Tanzmusik:
Billy Vaughn („Sail Along Silvery Moon“) und Perez Prado („Patricia“). 1959 führte noch mal Billy Vaughn die Hitliste der Teldec an („Morgen“, ,31ue Hawaii“), aber die Mehrzahl der Goldenen Schallplatten ging an deutschsprachige Interpreten: Caterina Valente („Tschau tschau Bambina“), Gitta Lind („Weißer Holunder“), Lys Assia („O mein Papa“) und nicht zuletzt Vico Torriani. Und das bei der Firma, die all die klassischen Rock’n’Roller im Programm hatte: Elvis Presley, Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry und Jerry Lee Lewis. Erst 1960 war Elvis („O Sole Mio“) einer von drei Teldec-Stars, die eine Goldene erhielten – neben Vico Torriani („Kalkutta liegt am Ganges“) und Caterina Valente („Ein Schilf wird kommen“).
Die 50er Jahre waren die Jahre der deutschen Schnulzen, der engstirnigen Moralvorstellungen, das Jahrzehnt der Spießbürger. Das zeigen nicht nur Fernsehserien („Familie Schölermann“, 1954) und Kinofilme (die Immenhof-Trilogie, ’55 bis ’57), das demonstriert auch die Werbung, der man eher die Nachkriegszeit anmerkt als eine Neuorientierung. Der erfolgreichste Slogan ist der HB-Spruch: „Warum denn gleich in die Luft gehen?“ Nivea Creme wirbt 1953 mit einer strahlenden Hausfrau beim Fensterputzen – Motto: „Für fleißige Hände“. Das Rama-Mädchen präsentiert 1954 die „Delikateß-Marganne“ im Trachtenkleid. Und Persil zeigt 1956 ein Mädchen mit Schleife, das ein Riesen-Waschmittelpaket trägt. Titel des Plakats: , .Kleine Hausfrau“. Noch 1958 wählte auch die Electrola für einen Prospekt das Motiv einer putzenden Hausfrau mit Kopftuch und Staubwedel – am Fuß der Leiter Nipper, der Terrier von His Master’s Voice, samt Grammophon. Kein Petticoat, kein Rock’n’Roll. Der spielte in Deutschland allenfalls bei einer jugendlichen Minderheit eine Rolle.
Auch in den Plattenfirmen setzte niemand wirklich auf diese Mode. Für kommerziell hielt man vielmehr die Themen, die in jenen Jahren mit Vorliebe besungen wurden: „Heideröslein“, „Mütterlein“, „O mein Papa“. Und als mit dem wirtschaftlichen Aufschwung das Reisefieber einsetzte, verließen auch die Schlagertexter, die bislang Wald und Wiese abgegrast hatten, die Heimat. Jetzt war Italien angesagt (vor allem Roma), Paris natürlich und – bei der Bedeutung von Vico Torriani und Lys Assia kein Wunder – die Schweiz. Heimweh und Fernweh bestimmten Ende der Fünfziger die Gemütslage. Der Durchbruch für die Rockmusik ereignete sich erst in den 60er Jahren. Im nachhinein aber wurden die Pionierjahre zum Jahrzehnt des Rock ’n‘ Roll uminterpretiert.
Anfangs fiel sogar die Einordnung der neuen Musik schwer: Amerikanische Schallplatten waren in der Vorkriegszeit als „Negermusik“ verpönt gewesen, Jazz-Schellacks wurden während der Nazi-Herrschaft unter dem Ladentisch gehandelt. Als nach dem Krieg wieder Musik-Importe über den Atlantik gelangten, hielt man sie wie selbstverständlich für Jazz. Auch der Rock’n’Roll galt als eine Jazz-Variante; nur unter diesem – wie man meinte, anspruchsvollen – Etikett gelang ihm das Entree. Selbst in der Diktion hatte man sich nicht weiterentwickelt. Ganz selbstverständlich werden noch im Philips-Katalog .»Amerikanische Serie 1956/ 57″ Spirituals als „geistliche Negerlieder“ übersetzt; der „New-Orleans-Stil“ wird „von Negern interpretiert“.
So trifft es zwar zu, daß „ein bestimmtes Werteset von einer Mehrheit für allgemein gültig gehalten“ wurde- aber Rock’n’Roll hatte keinen Platz darin.
In den Jahren von Caterina Valente und Vico Torriani war der Rock ’n’Roll etwas bislang Ungehörtes, Unerhörtes – und auch Ungehöriges. Wer sich zu ihm bekannte, machte sich zum Außenseiter. Der Rock’n‘ Roll eröffnete dem Fan eine neue Perspektive, eine neue Dimension: eine schöne, bessere Welt, „wo sich drei Minuten lange Singles als Erlösung von der Langeweile eines subalternen bürgerlichen Lebens darstellten“ („Stern“). Neben den Singles von Bill Haley oder Elvis Presley gehörte dazu das Abhören ausländischer Soldatensender wie AFN (Frankfurt, Berlin, Bremerhaven) und BFN (Köln) oder der englischsprachigen Sendungen von Radio Luxemburg. Van Morrison beschreibt die Situation in seinem Song „In The Days Before Rock’n‘ Roll“: Wie er den Knopf an seinem „Telefunken“-Radio dreht und auf der erleuchteten Skala Radio Luxemburg sucht: „Fats did not come in without those wireless knobs, Elvis did not come in without those wireless knobs…“ Das Radio als magische Verbindung zur Welt des Rock’n’Roll.
Aber der Rock’n’Roll wäre im Nachkriegs-Europa eine Episode geblieben, hätte es nicht von der ersten Stunde an – wenn auch zuerst nur vereinzelt – die Platten in den Läden gegeben. Das mag, Jahrzehnte nach Edisons Erfindung, nicht wie eine bahnbrechende Erkenntnis wirken. Doch ohne neue Schallplatten, ohne den Innovationsschub der Single, hätte damals dem Musik-Import aus den USA ein verkaufsförderndes Element gefehlt. Swing, Schlager, Filmmusik – das alles gab es schon auf Schellack. Mit der neuen kleinen Schallplatte kam aber plötzlich auch eine neue Musik.
Die historische Bedeutung der Single faßt Creedence Clearwater Revival-Gründer John Fogerty so zusammen: „I grew up with rock n‘ roll, and the way I looked at it, rock ’n’roll was a singles medium.“
Zwar erleichterte die Erfindung der 17cm-Schallplatte die Verbreitung aller Unterhaltungsmusik-Stile, der Rock’n’Roll profitierte aber besonders von der Vinyl-Platte. Wie hätte ein Teenager sonst in seinem Zimmer „700 litde records – all rock, rhythm and Jazz“ unterbringen sollen, von denen Chuck Berry in „You Never Can Tell“ singt? Die neuen Formate Single und LP sprachen eine neue Generation an. Was nicht heißt, daß Rock’n’Roll-Platten mit einem Mal massenhaft da waren wie 1958/1959 die Hula-Hoop-Reifen. Rock’n’Roll-Platten rotierten zunächst gegen den Trend, sie gehörten nicht zum Zeitgeist, sondern liefen ihm zuwider.
Die Platten waren rar Mitte der 50er Jahre; oft mußten sie bestellt werden. Und wer das tat, konnte von Glück reden, wenn er im Laden keinen Kommentar über die „Negermusik“ zu hören bekam. Zwar verbesserte sich die Versorgungslage mit der Zeit, aber so komplett wie die englischen Läden wurden deutsche Plattengeschäfte nie beliefert. Manche Aufnahmen wie Fats Dominos „Blueberry Hill“ wurden zunächst für die U.S. Army gepreßt, bevor man sie auf dem deutschen Markt veröffentlichte. Wer ins Ausland fuhr, nahm von Freunden Plattenbestellungen für Scheiben mit, die es in Deuschland nicht gab.
Weder in deutschen Familien noch in deutschen Plattenfirmen wurde die neue Musik freudig begrüßt. Kein Vater kaufte seinem Sohn eine Elvis-Single, kein Label-Manager setzte sich an die Spitze der neuen Bewegung. Die Vorstellung, daß jede Menge cleverer Promo-Leute Mitte der 50er Jahre den neuen Trend pushten, ist völlig daneben. Für sie war Rock’n’Roll nur ein neuer Tanzschritt – wie der Mambo – und nicht eine neue kulturelle Bewegung. Erst zu Beginn der 60er Jahre tauchten in der Musikbranche junge Label-Manager auf, denen man nicht mehr den Unterschied zwischen Bebop und Rockabilly erklären mußte.
Es gab nur wenige Männer, die den Erfolg des Rock’n’Roll in Deutschland ermöglichten. Und sie taten es meist halbherzig, ohne Überzeugung oder sogar ohne Absicht. Die Verantwortlichen in den deutschen Plattenfirmen waren in jenen Jahren fast ausnahmslos ältere Herren, deren Berufung es war, deutsche Musik für einen Erwachsenen-Markt zu produzieren: Klassische Musik, Operetten, Volksmusik oder Schlager. Allenfalls Jazz oder US-Unterhaltungsmusik fanden bei ihnen Gehör. Und das Rundschreiben der Deutschen Grammophon an die Einzelhändler, mit dem man noch am 2. Mai 1961 glaubte, „den Verkäuferinnen, die in der englischen Sprache nicht so zu Hause sind, eine kleine Hilfe geben zu können“, hat damals nicht etwa ein verhinderter Satiriker abgefaßt: „In dieser Woche erscheinen die folgenden Titel: Brenda Lee (brenda li) „I’m sorry“ (aim sorri), „That’s all you gotta do“ (dsäts ohlju gotte du); Del Shannon (dell schännen) „Runaway“ (rannewäi), „Jody“ (dschoudi); Connie Francis (konni frahnziss) „Everybody’s somebody’s fool“ (äwriboddies samboddies fuhl), „Jealous of you“ (dschälles offju).“
Der Transfer amerikanischer Kultur in die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit erzeugte Verwirrung und traf die meisten Medien-Manager unvorbereitet. Die Geschichte des Rock’n’Roll in Deutschland ist deshalb eher von Zufallen und Mißverständnissen geprägt als von einer konzertierten Kampagne zu seinen Gunsten. Es ist die Geschichte von ein paar Männern, die im richtigen Moment am richtigen Platz die richtigen Entscheidungen trafen.
Den Weg von der Eilenriede bis zur Podbielskistraße, dem Sitz der Deutschen Grammophon Gesellschaft in Hannover, fuhr Dietrich Schulz-Köhn (Jahrgang 1912) gewöhnlich mit dem Fahrrad. Mit 37 Jahren war der Doktor der Volkswirtschaft bei der ältesten deutschen Plattenfirma Leiter der Abteilung Lizenzen und Urheberrechte – ein akzeptabler Posten, aber nicht gerade das, was er sich erträumt hatte. In seiner Freizeit nahm er im „Studio Maschsee“ Jazz-Sendungen auf, die der Nordwestdeutsche Rundfunk in Köln ausstrahlte. Schulz-Köhn galt mit seiner Sammlung, die 4000 Schellack-Platten umfaßte, als einer der profundesten Jazz-Kenner im Nachkriegs-Deutschland; aus dieser Zeit stammt sein Spitzname „Dr. Jazz“. Sein ganzes Engagement widmete er der Verbreitung der amerikanischen Musik, die in der Nazi-Zeit offiziell verpönt gewesen war. An den Job mit den Urheberrechten war er nur geraten, weil die Grammophon 1949 dringend jemanden brauchte, der Fremdsprachen beherrschte und eine akademische Vorbildung hatte.
Der Eindruck, den der US-Straßenkreuzer auf dem Firmenhof in der Podbielskistraße machte, muß dementsprechend gewaltig gewesen sein. „Alle liefen zusammen und staunten. Als ich zurück in mein Büro ging, klingelte das Telefon. Am Apparat war der kaufmännische Direktor der Deutschen Grammophon, Dr. Walter Betcke. Er sagte: .Kommen Sie mal, ich hab hier Dave Kapp von der amerikanischen Decca.'“
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Deutsche Grammophon Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin Geschäftsbeziehungen zu einer amerikanischen Plattenfirma: Brunswick-Balke-Collander in Chicago. Verantwortlich für das amerikanische Jazz-Repertoire, das in Deutschland auf dem Brunswick-Label veröffentlicht wurde, war seit September 1935 kein anderer als der Königsberger Student Dietrich Schulz (den Beinamen Köhn legte er sich später zu).
14 Jahre später saß Schulz-Köhn in Hannover dem Vice-President der Decca gegenüber, zu der jetzt auch das Brunswick-Label und die Marke Coral gehörten. Dave Kapp hatte seit Gründung der amerikanischen Decca zusammen mit seinem Bruder Jack in verantwortlicher Position bei dem Ableger der englischen Decca gearbeitet. Dave, vor 1945 Leiter der Decca-Country-Abteilung, nahm schon in den 30er Jahren die Carter Family auf Platte auf. (Der Name Kapp spielte später noch eine Rolle, als Dave -Jack war 1949 gestorben -1954 das Kapp-Label gründete.) „Kapp wollte wissen, wie gut vertraut ich mit amerikanischer Musik war“, erinnert sich Schulz-Köhn. „Er saß – typisch amerikanisch – im Sessel, die Beine auf dem Schreibtisch, und wollte hören, wieweit ich Decca und Brunswick kannte. Nun spreche ich ja gut Englisch, und die Namen waren mir alle geläufig. Und der war völlig von den Socken.“ Die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Decca war besiegelt. Vereinbart wurde – wie schon vor dem Krieg mit Brunswick-Balke-Collander – ein Matrizen-Austausch. Schulz-Köhn wurde 1950 der erste deutsche Label-Manager für die Marken der US-Decca; als erstes tauchte 1951 das Brunswick-Label wieder mit Neu-Aufnahmen in deutschen Läden auf.
Die Marke „Brunswick“ war bereits 1926 von den „Polyphon Musikwerken“ (Besitzer der Deutschen Grammophon) mit Schriftzug und Bildzeichen zum Patent angemeldet worden. Geworben wurde vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Slogan „Die beste amerikanische Tanzplatte“. Gemeint war Jazz, und bis in die 50er Jahre galt Brunswick denn auch als Jazz-LabeL Im ersten Brunswick-Katalogvon 1951 wird allerdings darauf hingewiesen, daß nun „alle Spielarten der Musik“ auf Brunswick zu hören sind; für Schulz-Köhn ist es dennoch immer ein Jazz-Label geblieben.
Sein erster Erfolg war Louis Armstrongs „Cest Si Bon“ (Bestellnummer 82 409): „Der Durchbruch, die erste Schellackplatte, die über 100 000 mal verkauft wurde!“ Als Armstrong am 9. Oktober 1952 Deutschland besuchte, holte Schulz-Köhn ihn am Düsseldorfer Flughafen ab. Vor Armstrong war schon Duke Ellington nach Hannover gekommen. Schulz-Köhn: „Der fuhr mit dem Taxi bei mir vor, das weiß ich noch wie heute. Er war bei mir zu Hause. Später kamen sie alle: Woody Herman, Lionel Hampton, Harry James…“
Wenn man einzelnen US-Hits nicht genügend Zugkraft zutraute, um sie als Single herauszubringen, wurden verschiedene Titel zu einer Sampler-LP zusammengestellt. Von diesen „Versuchsballons“ gab es anfangs mehrere auf den Labels Brunswick und Coral. Typisch für diese Hit-Kopplungen ist die Coral-LP „Hits On Parade“ vom Oktober ’55. Fünf der acht Stücke auf der 25cm-Scheibe waren tatsächlich zwischen 1954 und 1955 in den amerikanischen Charts vertreten, vier davon wurden bei Coral allerdings von anderen Interpreten gesungen. Ein übliches Verfahren Mitte der 50er Jahre: Sobald farbige Sänger mit ihren Platten erfolgreich waren, wurden ihre Hits von Weißen „gecovert“. Zum einen, weil man dem Publikum eine „schwarze Scheibe“ nicht glaubte zumuten zu können, zum anderen, um mit einem Stück, das beim schwarzen Publikum ankam, noch mal bei den Weißen abzukassieren.
Für das schwarze Publikum hatte die Industrie eine eigene „Rhythm & Blues“-Hitparade eingerichtet, in der die „Race Records“ aufgelistet waren. Von diesen Produktionen gingen damals die Innovationen aus. Der neueste Trend 1954: Doo-Wop, von Vokalgruppen entwickelte A-capella-Gesänge, die später mit Instrumental-Begleitung unterlegt wurden. Für den europäischen Markt kamen aus damaliger Sicht natürlich auch nur weiße Cover-Versionen in Frage.
Vier der aktuellen Hits auf „Hits On Parade“ sind Doo-Wop-Stücke der ersten Stunde: „Sh-Boom“ vom Billy Williams Quartet, „Hearts Of Stone“ von den Goofers, „Seven Lonely Days“ von den Marlin Sisters und „Goodnight Sweetheart, Goodnight“ von den McGuire Sisters (Original von den Spaniels). Bis auf die Platters kam Doo-Wop meist als Kopie zu uns – das bekannteste Beispiel: „Crying In The Chapel“ von den Orioles, gesungen von Elvis Presley. Vielen anderen Rock’n’Roll-Originalen aus den R 8C B-Charts er ging es nicht anders.
Neben Stücken aus den aktuellen Hitparaden wurden auf Brunswick und Coral vor allem Soundtracks aus Hollywood-Filmen veröffentlicht. Bei allen Plattenfirmen verkauften sich Soundtracks gut, wenn die Filme auch in Deutschland liefen. Das Kino hatte für die Musik-Industrie dieselbe Funktion wie MTV heute. War der Film ein Erfolg, lief auch die Platte bestens. Beispiele auf Brunswick (EPs): „Die Benny Goodman Story“, „The Man With The Golden Arm“, „Schwere Jungen – leichte Mädchen (Guys And Dolls)“, „The Glenn Miller Story“.
Die Musik aus dem MGM-Film „Die Saat der Gewalt“, in Amerika ein gewaltiger Erfolg, mußte deshalb auch hier ein Selbstgänger sein. Die für 1955 revolutionäre Film-Story: Aufmüpfige Schüler in New York (Anführer: Vic Morrow) machen engagiertem Lehrer (Glenn Ford) das Leben schwer. Das Thema, die Rebellion der Jugendlichen, lag in der Luft. 1955 kam auch Nicholas Rays „Denn sie wissen nicht, was sie tun (Rebel Without A Cause)“ heraus, mit James Dean in der Hauptrolle. Ausgerechnet nach einem Louis-Armstrong-Konzert in Frankfurt schlugen am 18. Oktober 1955 Konzertbesucher die Einrichtung des Saales kurz und klein. Im deutschen Film hingegen war nichts von dem veränderten Bewußtsein der jungen Generation zu spüren. Die Uraufführung des Jahres: „Sissi“ mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Die Deutsche Grammophon nutzte die Gunst der Stunde und lenkte das Interesse auf ihr Geschäft: „Lange Jahre hindurch waren die Filmproduzenten der Ansicht, in ihrem Bereiche falle der Musik lediglich die Aufgabe einer Geräuschkulisse zu, die den dramatischen Ablauf der Handlung unterstreichen soll. Inzwischen jedoch sind einige Dutzend Filme über die Leinwand gegangen, deren Musik um ihrer selbst willen Beachtung fand.“ Und dann wird dezent darauf hingewiesen, daß eines der Beispiele „Rock Around The Clock“ sei. „Es wird nicht nur Filmfreunde interessieren, daß Brunswick diese unter die Haut gehende Melodie mit Bill Haley And His Comets in der Originalfassung herausgebracht hat.“ Bill Haley auf dem Label, das von Anfang an dem Jazz gewidmet war! Mit der richtigen Einordnung des Rock’n’Roll hatte man allerdings noch längere Zeit Probleme. Im Presseheft des Filmverleihs heißt es: „So kindisch der Text dieses Liedes, so naiv peitschend sind Melodie und Harmonien. Es grenzt an Jazz. ,Rock Around The Clock‘ grenzt an Jazz.
Im Formalen, könnte man sagen.“ 1955, als Caterina Valente mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ den bundesdeutschen Musikmarkt beherrschte, grenzte Bill Haley an Jazz!
Schon ein Jahr danach wußte man es allerdings besser. Da waren nicht nur sämtliche Hits von Haley in Deutschland veröffentlicht; da hatte auch die Teldec auf ihrem RCA-Label mit einem Schlag 13 Elvis-Singles von „Mystery Train“ bis „Shake, Rattle And Roll“ herausgebracht.
Für die Deutsche Grammophon brachen goldene Zeiten an. Original-Ton aus einem Prospekt vom April 1956: „In Deutschland hat sich die Aufnahme in wenigen Wochen an die Spitze aller Brunswick-Umsätze seit Bestehen der Marke gesetzt.“ Schlag auf Schlag brachte Brunswick die bereits auf US-Decca erschienenen Haley-Hits heraus; sämtliche Singles erschienen auch als Schellacks. „Wir haben alles veröffentlicht, was er aufgenommen hatte“, erinnert sich Schulz-Köhn. „Das nennt man standing order.“
Auf den ersten Auftritt ihres Idols mußten die deutschen Fans noch lange warten. Immerhin spekulierte die „Bild-Zeitung“ am 6. Februar 1957 über einen Deutschland-Besuch: „Bill greift nach Europa“. Anlaß: Haley war zu seiner „Crazy Man, Crazy“-Tour mit der „Queen Elizabeth“ von New York nach Southampton gereist. Schon vor den Konzerten in England plagten „Bild“ aber auch Vorahnungen: „Rock’n’Roll ist zu einem Massenfieber geworden, das stark genug ist, Autos umzustürzen und den Polizeipräsidenten graue Sorgenhaare wachsen zu lassen. Und Bill Haleys heisere Stimme hat daran einen guten Anteil.“
Diesmal kam er noch nicht nach Deutschland. Aber ein Promotion-Manager der Deutschen Grammophon reiste ihm Anfang März entgegen, um ihm in London eine Goldene Schallplatte zu präsentieren – die erste deutsche Auszeichnung für einen ausländischen Künstler.
1958 war es soweit: Der Hamburger Veranstalter Kurt Collien schaffte es, Haley für Konzerte in Berlin, Mannheim und Hamburg zu buchen. Zu einer Zeit, als Elvis Presley einen Millionen-Seiler nach dem anderen landete, als Jerry Lee Lewis, Little Richard und Fats Domino den Pionier des Rock ’n’Roll schon längst aus den Hitparaden verdrängt hatten, reizte Bill Haley die deutsche Jugend tatsächlich zu Tumulten. Ausgerechnet William John Clifton Haley aus Highland Park in Michigan – zehn Jahre älter als Presley und Lewis, ein korpulenter Gitarrist mit Geheimratsecken. Mit seiner karierten Jacke und der „Schmalzlocke“ hätte der 33jährige Quizmaster Peter Frankenfeld Konkurrenz machen können.
Aber Haley war der erste Rock’n‘ Roller, der leibhaftig nach Deutschland kam. Und er war der erste gewesen, dessen Platten unter deutschen Dächern die Ahnung von einer anderen Welt weckten. „Rock Around The Clock“ – das reichte als Stichwort, und jahrelang aufgestaute Emotionen brachen aus, als er die Gitarre anschlug. Der Generationskonflikt der Nachkriegszeit – bislang eher theoretisch ein Thema – wurde mit einem Schlag sichtbar und hörbar. Selbst Pat Boone oder Ricky Nelson hätten 1958 in der Bundesrepublik dieselbe Wirkung wie Bill Haley gehabt. Sogar bei einem Konzert des „Schluchzers“ Johnny Ray flogen im März desselben Jahres in Berlin Stühle. Die Jugendlichen aller Schichten warteten damals nur darauf, daß jemand ihren Protest attikulierte. Daß Bill Haley ihr Wortführer wurde, ergab sich allein aus der Tatsache, daß sein Stern in den USA zu sinken begann. Während seine Konkurrenten dort in ausverkauften Hallen auftraten, mußte er sich sein Publikum in Europa suchen. Hier wurde er dankbar als Superstar empfangen, als Inkarnation des Rock’n’Roll. Im Vorprogramm der Tour trat Kurt Edelhagen mit seiner Big Band auf- wie Haley bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag. Die Firma gab aus diesem Anlaß ein Werbe-Leaflet heraus: „Neben der hemdsärmeligen Vitalität des Rock steht Kurt Edelhagens eleganter, raffiniert unterkühlter Sound, auf den nicht nur Europa hört. Haley/Edelhagen – ein ganz großer Abend der handfesten ,Moderne‘.“ Zum letztenmal hielt man in der Bundesrepublik Rock und Jazz nicht auseinander. „Ich habe als Veranstalter Fehler gemacht“, gibt Kurt Collien zu. „Edelhagen war ein großer Name, paßte aber nicht zu Haley. In Berlin haben Haley-Fans Edelhagen ausgebuht, bis er von der Bühne ging. Es entstand eine lange Pause, bis Haley aus dem Hotel kam. Das Ergebnis: Terror! Über 2000 Stühle, ein Steinway-Flügel und die Beleuchtung gingen kaputt. 80 000 Mark Schaden.“
Damals überlegte auch Collien, ob der Tumult nicht vom Osten gesteuert sein könnte, denn zum Konzert waren auch viele Besucher aus Ost-Berlin gekommen. Heute ist Collien eher überzeugt: „Es war der Aufbruch der deutschen Jugend.“
Das Hamburger Konzert einen Tag später verlief nicht besser. Unter der Überschrift „Empörender Skandal bei Bill Haley“ schrieb das „Hamburger Abendblatt“ am 28. Oktober 1958: „Veranstalter Collien hatte drei Hundertschaften Polizei zur Seite. Demonstrativ rückt eine Rotte von zehn Polizisten durch einen Gang. Gejohle aus drei Ecken. Dort, so wußte man gleich, sitzen Gruppen Halbstarker.“ Als die ersten „Halbstarken“ die Bühne stürmen, zieht Haley sich zurück. „Er war ein sehr ruhiger Mann“, erinnert sich Collien, „der über die Krawalle erschüttert war.“
Bei seinen Konzerten in Frankfurt und Mannheim traf Haley auf jenen Mann, der ihn obsolet gemacht hatte: Elvis Presley, als GI in Friedberg stationiert, war zu den Shows gekommen – „in Uniform und mit einem unmöglichen Haarschnitt“ (Collien). Der „King“ blieb hinter den Kulissen, ohne – wie viele hofften – aufzutreten. Presley ging allerdings nicht ohne ein freundliches Wort für Haley: „Ohne Bill wäre ich bestimmt nie zum Rock’n‘ Roll gekommen.“
Das lag erst vier Jahre zurück, aber es war schon zwei Jahre her, daß Haley mit „See bu Later, Alligator“ einen wirklichen Hit gelandet hatte. Seine Ära ging unwiderruflich zu Ende. Nicht anders ist zu erklären, daß er sich – noch in Deutschland ausgerechnet für einen Film mit Caterina Valente mißbrauchen ließ: „Hier bin ich – hier bleib ich“ versöhnte die Schnulzenfreunde mit dem „Rock’n’Roll-Vater“.
Der Trend im Rock’n‘ Roll dagegen ließ Bill alt aussehen. Die Deutsche Grammophon hatte mit Buddy Holly längst ein neues Idol unter Vertrag. Nur ein paar Jahre noch sollte auch Elvis Rock’n’RoU verkaufen dann wurde eine neue Musik der Schlager auf Singles: Beat.
Die Deutsche Grammophon war nicht die erste Plattenfirma, die nach 1945 die Zusammenarbeit mit den Amerikanern aufnahm. Und sie war auch nicht die erste, die eine Rock ’n’Roll-Nummer in Deutschland ab Platte preßte. Der Coup mit den Amerikanern gelang der Firma Telefiinken, der der Oberregierungs-Präsident in Hannover bereits 1946 die Wiederaufnahme des Betriebs genehmigt hatte. Sitz der Firma war nach wie vor Berlin. Aber anders als die DGG, die in Hannover sofort wieder die Produktion aufnehmen konnte, verfugte Telefunken über kein Werk im Westen. Die Anlagen in Berlin waren zerstört, also mußten die ersten Telefunkenplatten bei der Muttergesellschaft AEG gepreßt werden – auf einer alten Kunststoffpresse. Von Vorkriegs-Matrizen hergestellte Schellack-Platten ließen sich sogar schon wieder im Ausland absetzen. Die erste Künstlerin, die Telefunken neu verpflichtete, war Gitta Lind.
Angeblich war es der schwedische Vertreter der Telefunken, der 1947 den Kontakt zu der erst fünf Jahre zuvor in Hollywood gegründeten Capitol aufnahm. Die Angaben darüber, wann eine Delegation der Capitol nach Berlin geflogen kam, gehen auseinander (1947 oder 1948), aber die Schilderungen der Vertragsverhandlungen gleichen sich. Danach war es ein Mr. Porges, der die Capitol-Delegation anführte. Hans Lieber, später Geschäftsführer der Teldec, holte die Gäste mit einem geliehenen Opel in Tempelhof ab. Die Amerikaner, von dem Wagen nicht gerade beeindruckt, luden ihre deutschen Gastgeber eine Woche lang in US-Clubs ein. Zum Abschied meinte Lieber, nun aber doch die Vertragspartner bewirten zu müssen. Um das finanzieren zu können, verkaufte er ein Telefunken-Radio auf dem Schwarzmarkt Erlös: 3000 Mark (vor der Währungsreform!). Die Investition zahlte sich aus. Schließlich besaß Capitol den modernsten Unterhaltungsmusik-Katalog Amerikas. Und das Geld kam schneller wieder rein als gedacht: Am Abflugtag fuhr Lieber die Delegation wieder nach Tempelhof, und dort drückte ihm Porges sein ganzes deutsches Restgeld in die Hand: 4200 Mark.
Für die Geschichte des Rock’n‘ Roll in Deutschland sollte dieser frühe Vertrag mit einer amerikanischen Gesellschaft aber belanglos bleiben. Erst im Capitol-Katalog von 1956 taucht mit Gene Vincents „Be-Bop-A-Lula“ ein nennenswertes Rock-Stück auf. Vielmehr brachte die Capitol mit ihrem Repertoire typisch amerikanische Mainstream-Musik zu uns: das in Rillen gepreßte Lebensgefühl der Kriegsgeneration – die Jazz-Pianisten Nat King Cole und Stan Kenton, die Crooner Frank Sinatra, AI Martino und Dean Martin, die Country-Größen Tennessee Ernie Ford, Tex Ritter und Hank Thompson – Barmusik und Lieder von der unendlichen Weite der Prärie. Vor allem Les Paul und Mary Ford waren die Zugpferde des Capitol-Labels in Europa.
Hans-Joachim Hoffmann, von 1951 an beim Telefunken-Preßwerk in Nortorf dabei, erinnert sich an Tage, an denen ausschließlich Les Paul und Mary Ford gepreßt wurden. Ihre Platten gingen als Exporte auch in die Benelux-Länder und nach Skandinavien. Und weil dort bereits 1952 die Single-Schallplatte auf dem Markt eingeführt wurde, wurden in Nortorf im selben Jahr auch Paul/Ford-Singles für Skandinavien hergestellt – ein Jahr vor dem offiziellen Start der kleinen Platte in der Bundesrepublik.
as Preßwerk in Norton war der Beginn der Telefunken im Westen: eine alte Kaschemme, in der zuvor Leder zugeschnitten wurde. 1948 war die Zeit der Nürnberger Prozesse, des Marshall-Plans, der Schulspeisung. Wer Arbeit hatte, konnte sich glücklich schätzen; an Schallplatten dachten 1948 die wenigsten. In Nortorf wurden die Lederpressen einfach in Plattenpressen umfunktioniert. Man war erfinderisch – drei Jahre nach dem Krieg.
Zunächst entstanden hier nur Schellacks. Matrizen wurden aus Berlin durch die sowjetisch besetzte Zone geschmuggelt oder von alten Schellacks neu erstellt Die Plattentaschen – später auch noch für die LPs und EPs – wurden angeliefert, für Capitol-Aufnahmen aus den USA.
Der entscheidende Impuls für die Telefunken kam zwei Jahre später aus England. Die englische Decca suchte, wie vorher schon Capitol, einen deutschen Partner, dessen klassisches Repertoire sie zusätzlich übernehmen konnte. Schlüsselfigur in diesem Deal war der Schweizer Maurice Rosengarten. Rosengarten, in Zürich seit 1935 Besitzer der Musikvertrieb AG und Produzent klassischer Aufnahmen, leitete auch die Schweizer Holding der englischen Decca. Er stellte den Kontakt zur Telefunken her. Das Ergebnis war die Gründung einer neuen Gesellschaft: Die Telefunken-Decca Schallplatten GmbH, kurz Teldec, wurde am 10. März 1950 in das Hamburger Handelsregister eingetragen. Von dem Stammkapital von drei Millionen Mark gaben Telefunken und Decca je 49 Prozent, Maurice Rosengarten zwei Prozent Rosengartens Vermittlung ermöglichte, daß die englische Decca als erste ausländische Firma nach dem Krieg mit Genehmigung der Alliierten eine Beteiligung an einer deutschen Plattenfirma erwarb. Und er behielt Zeit seines Lebens (1900 bis 1975) die Fäden in der Hand. Der kühl kalkulierende Geschäftsmann und Liebhaber klassischer Musik stieg in den nächsten Jahren zum Direktor der Londoner Decca und zum Aufsichtsratmitglied bei Decca und Teldec auf. Seine guten Kontakte und seine Spürnase für große Künstler brachten beiden Firmen hervorragende Klassikproduktionen, darunter gewagte Unternehmen wie Wagners „Ring der Nibelungen“.
Rosengartens Hauptinteresse galt der Durchsetzung klassischer Aufnahmen. Aber die konnten sich nur auf lange Sicht amortisieren; das schnelle Geld mußten Schlagerproduktionen bringen. Rosengarten hatte sogar selbst Schlagerstars unter Vertrag, deren Platten über die Teldec (auf Decca) vertrieben wurden: Vico Tbrriani, Will Glahe, Lys Assia, das Golgowsky Quartett, das Rodgers Duo. Einer seiner Vertragskünstler, Anton Karas, hatte schon Anfang der Fünfziger einen Hit mit der Filmmusik aus „Der dritte Mann“: „Das Harry Lime Thema“. Doch im Vergleich zur Deutschen Grammophon mit ihrem Polydor-Label war die Teldec im deutschen Schlagermarkt nur schwach vertreten. Das lag zum Teil auch daran, daß der Vertrieb der Schallplatten von Vertretern der weißen Sparte (Haushaltsgeräte) und der braunen Sparte (Radios etc.) der deutschen Muttergesellschaft AEG-Telefunken mitübernommen wurde, während die Konkurrenz eigene Vertriebsorganisationen eingerichtet hatte. Um so mehr bemühte sich die Teldec, neue Schlagerstars aufzubauen, als die Försterschnulzen der frühen Fünfziger nicht mehr zogen. Mehr als einmal rief Rosengarten in Hamburg an, um die Teldec-Geschäftsfuhrer besorgt zu fragen: „Wo bleibt der deutsche Schlager?“ Ausgerechnet seinem Einfluß war es zu verdanken, daß die BRD ab Mitte der 50er Jahre mit Rock’n’Roü-Aufhahmen aus Amerika überrollt wurde. Sie fielen Teldec durch die Verbindung zur englischen Decca in den Schoß. Die Amerikaner bekamen dafür im Tauschgeschäft Vico Torriani und Will Glahe!
Im Jahre 1945 waren die geschäftichen Verbindungen zwischen der englischen Decca und der amerikanischen Tochtergesellschaft gelöst worden. Beide Firmen waren nun voneinander unabhängige Unternehmen, die weiterhin mit demselben Namen auftraten. Allerdings durfte die US-Decca nicht in Europa als „Decca“ firmieren – und die englische Decca nicht in Amerika. Für den US-Markt gründete deshalb Edward Lewis, Besitzer der englischen Decca, zwei Jahre später ein eigenes Label: London Records. Unter diesem Namen erschienen fortan englische Decca-Aufnahmen auf dem nordamerikanischen Kontinent (etwa von Mantovani und seinem Orchester). Gleichzeitig grasten Lewis‘ Abgesandte die USA nach neuen Produktionen unabhängiger Plattenfirmen ab. Die wurden unter Vertrag genommen und im Gegenzug in England auf dem London-Label veröffentlicht. Im Lauf der 50er Jahre kamen bis zu 30 US-Indies zusammen, deren Aufnahmen vornehmlich Rock’n’Roll – in England auf London erschienen. Eine davon war das Label Essex aus Philadelphia, das seit 1950 Bill Haley unter Vertrag hatte.
Während in England schon 1949 Schellack-Platten mit dem London-Schriftzug moderne amerikanische Musik über den Adantik brachten, ließ man sich in Deutschland noch Zeit, das auf US-Importe spezialisierte Label einzuführen. Englischsprachiges Material veröffentlichte man der Einfachheit halber auf dem Decca-LabeL auch wenn es die Londoner Decca als London-Platte herausgebracht hatte. So kam es, daß in Deutschland die ersten amerikanisehen Rock’n’Roll-Aufnahmen exklusiv auf dem „englischen“ Decca-Label in die Geschäfte gelangten.
Decca – das Label, auf dem sie veröffentlicht wurden – war in Blau und Gold gehalten, über dem Firmenschriftzug thronte Beethovens Büste. Unter seinem strengen Blick veröffentlichte die Teldec ,3ig Mamou“ von Smiley Lewis und Bill Haleys „Crazy Man, Crazy“. Die „Copyright-Information“ der Teldec nennt für Smiley Lewis das Datum 18.1953, für Bill Haley 29.1.1954 – veröffentlicht wurden die Platten allerdings jeweils etwa vier Wochen später. Statt des Namens Decca trägt das Archiv-Blatt bei beiden Aufnahmen den Vermerk „Grünrand“: Im Unterschied zu den eigenen, deutschen Decca-Produktionen versah die Firma damals alle angelsächsischen Aufnahmen mit einem grünen Papier-Plattencover. Diese „Grünrand-Platten“ von Decca waren die Vorläufer der im Mai 1954 gestarteten deutschen London-Serie. In England waren „Big Mamou“ und „Crazy Man, Crazy“ bereits im August 1953 auf dem London-Label erschienen.
Es war wohl eher ein Zufall, daß die beiden Schellacks, die den Rock ’n’Roll nach Deutschland brachten, sowohl die schwarze als auch die weiße Variante dieser Musik berücksichtigten: den schwarzen Boogie, vertreten durch Smiley Lewis – eine Generation älter als Fats Domino, dessen „Stallgefahrte“ er beim US-Label Imperial war – und den weißen Country-Rock, vertreten durch den Hank-Williams-Epigonen Bill Haley.
„Big Mamou“ wurde von der Teldec als „für die Jazz-Fans interessant“ vorgestellt Die erhoffte Resonanz blieb nicht nur wegen der Einordnung in die falsche Musik-Rubrik aus. So erfolglos wie „Big Mamou“ war auch Smiley Lewis‘ einzige Single, die 1957 in Deutschland auf London veröffentlicht wurde: „Shame, Shame,Shame“. Es dauerte, bis schwarzer Rock’n’Roll in Deutschland gesellschaftsfähig wurde. Die weiße Variante, die sich auch in den Vereinigten Staaten erheblich besser vermarkten ließ, bereitete deutsche Ohren zunächst behutsam auf das vor, was noch kommen sollte.
Anfangs wußte bei der Teldec niemand, ob mit den Lizenzen der Decca ein großes Geschäft zu machen sei. Angloamerikanische Musik interessierte zunächst nur eine Minderheit. Allenfalls in deutscher Übersetzung, so glaubte man, ließen sich englische Schlager verkaufen. Herbert Grenzebach, in den 30er Jahren als genialer Produzent klassischer Musik zur Telefunken-Platte gekommen und in den 50er Jahren der künstlerische Leiter der Teldec, erwartete deshalb mehr von Vico Torriani und Gitta Lind als von Importen, es sei denn sie paßten in den biederen Rahmen wie die Engländerin Vera Lynn („Folge dem Rat deines Herzens“). Auf sein Konto gingen auch Telefunken-Größen wie Rosita Serrano, Peter Kreuder, die Egerländer, Oberkrainer und Maria Hellwig. Je mehr die Konkurrenten Polydor und Electrola die Nase vorn hatten, desto mehr versuchte die Teldec, mit zum Teil unsäglichen Produktionen beim deutschen Schlager Marktanteile zu ergattern. Mit Maurice Rosengartens ständiger Forderung im Nacken („Herr Grenzebach, machen Sie mir ’nen deutschen Schlager!“) wurde alles auf diese Karte gesetzt.
Ein vielsagendes Bild der Verkaufsstrategie geben die Werbeplatten, die seit 1955 über den Plattenhandel vertrieben wurden. Titel: „Klingende Post – Eine Auswahl für unsere Schallplattenfreunde“. Die als Warenprobe verpackten Singles mit dem Namen des jeweiligen Plattengeschäftes wurden kostenlos an Kunden abgegeben.
Nach einer Posthorn-Fanfare, die ertönte, um den Namen des Händlers anzukündigen, wurden neue Titel angespielt und kommentiert. Die erste Ausgabe von 1955 ist ein einmaliges Dokument des Geschmacks dieser Zeit Da singt „die charmante Vortragskünstlerin“ Lys Assia ihr „Holland-Mädel“, das Golgowsky-Quartett bittet „Vergiß mein nicht, Blauäugelein“, und neben dem Karnevalsschlager „Am 30. Mai ist der Weltuntergang“ wird ein „Heimat-Song aus Südafrika“ vorgestellt, „Skokiaan“: „Ho, ho, kommst du mit nach Afrika, da singt der Bimbo seine Lieder!“ Und dann kommt eine Premiere, „das neue Klangverfahren True-Sound-Effect“ der Telefunken. „Meine Herren, die Sie Märsche lieben, verlangen Sie Marschplatten mit dem TS-Effekt“ Dessen Wirkung – „einzigartig in Klangfülle, Durchsichtigkeit und besonders in der naturgetreuen Wiedergabe der Blas-Instrumente“ – wird am „Heideröslein“ demonstriert.
Die 5. Folge stellt mit „Zambezi“ den „Cha-Cha“ als den Modetanz vor, und 1956 wird Kay Starts Hit „Rock And Roll Waltz“ in der deutschen Version empfohlen: „Amerikas Spitzenschlager wird auch hier der gemeinsame Lieblingstanz für die jüngere und ältere Generation werden.“ Es folgt Evelyn Künneke mit dem Tanzorchester Günther Fuhlisch, die „zum fröhlichen Boogie im Dreivierteltakt bitten“. Es ist das Jahr, in dem Gitta Lind mit „Weißer Holunder“ die Hitparade stürmt.
Aber es ist auch das Jahr, in dem selbst die „Klingende Post“ nicht mehr unterschlagen kann, daß es noch eine andere Art populärer Musik gibt. Originalton der für das Hamburger Fachgeschäft „Radio Siehler“ zusammengestellten 7. Folge: „Und nun Ohren weit auf für das Allerneueste, die große Überraschung für alle Schallplattenfreunde: der Deutschland-Start der RCA-Platten, die Spitzenstars der Weltklasse nun auch in Ihrem Heim. Hier eine Probe: der Jüngste aus der langen, klangvollen Namensliste der RCA-Favoriten, Elvis Presley, der 21jährige Komet am Himmel der Rock’n’Roll-Ekstase in der Jugend der ganzen Welt Sein ,Hound Dog‘ hat bereits die Verkaufsziffer von zwei Millionen überschritten.“
Die amerikanische RCA war der dickste Fisch, den eine europäische Firma zu jener Zeit an Land ziehen konnte. Bislang waren sämtliche RCA-Aufhahmen in England und Deutschland bei EMI auf dem Label His Master’s Voice erschienen. Es war das Verhandlungsgeschick von Edward R. Lewis und Maurice Rosengarten, das die RCA 1956 zu Decca und damit zur Teldec brachte. Das ließ sie den Verlust der Capitol verschmerzen, die im selben Jahr von EMI aufgekauft wurde. Das Repertoire von RCA: Jazz (Glenn Miller), Klassik (Brahms, Gershwin), Pop (Ferry Como, Harry Belafönte), Country (Hank Snow) und neuerdings Rock’n’Roll. Der Start mit Elvis hätte besser nicht sein können. Am 12. Dezember 1956 widmete „Der Spiegel“ dem „Rock’n’Roll-Singer“ eine Titelgeschichte: „Von Dixieland nach Kinseyland“. „In Deutschland“, so der Kommentar, „rüstete sich in den vergangenen Wochen die Teldec für einen Presley-Boom. Unter dem Slogan ,Er singt, wie Marilyn Monroe geht‘ brachte die Gesellschaft auf einen Schlag zwölf Platten von Presley auf den Markt, und schon zur Mitte des vergangenen Monats zeichnete sich, wie Teldec-Verkaufsleiter Schrade erklärte, ,ein Erfolg von der Größenordnung eines deutschen Bestsellers ab, obwohl einige Radio-Stationen sich hartnäckig weigern, Presley-Platten zu spielen‘.“ Lärmige Rock-Titel wie „Hound Dog“ und „Tutti Frutti“ bedrohten wohl die beschauliche Ruhe im kulturellen Idyll der Bundesrepublik, in dem „Weißer Holunder“ prächtig gedieh und „Das alte Försterhaus“ als Sinnbild für das deutsche Wesen stand. Für die „auf die bürgerliche Moral gegründete Gesellschaft“ faßte „Die Zeit“ die anfanglichen Bedenken gegen Elvis zusammen, der „seine unartikulierten Laute außer mit einer elektrischen Gitarre auch mit konvulsivischen Bewegungen zu begleiten pflegt“: „Er wirkt nur durch die simple, ungenierte Direktheit des Primitiven.“
Die restliche deutsche Presse dagegen war – sofern sie Presley überhaupt zur Kenntnis nahm – weniger herablassend. Besonders bei den auf Prominenten-Klatsch abonnierten Blättern gab es keine Berührungsängste. Schon einen Monat vor dem „Spiegel“ hatte die im selben Verlag erscheinende „Star-Revue“ der neuen Welle drei Seiten gewidmet Zu einem Bild von Elvis stellte sie den Titel: „Macht Platz, hier kommt der Rock’n’Roll“.
Elvis bedeutete für die Teldec bis weit in die 60er Jahre hinein eine sichere Aktie mit steigendem Wert. Mit der Zeit merkte man, daß das Auslands-Repertoire Gold wert war. Es verschaffte den Geschäftsführern die nötige Sicherheit, um die häufigen Konfrontationen mit Rosengarten in Zürich zu überstehen. Um seinen Wunsch nach deutschen Schlagern zu erfüllen und um der New Yorker RCA-Führung entgegenzukommen, die sich in Deutschland unterrepräsentiert fühlte, machte die Teldec sogar deutsche Aufnahmen mit Paul Anka und Rita Pavone und ließ Wolfgang Kabitzky nach Nashville reisen, um Country-Musik – in den USA einer der Verkaufsschlager der RCA – einzudeutschen.
Kabitzky, der für die Teldec von 1955 bis 1980 unzählige Hits produzierte, hatte gerade mit Erfolg aus dem 16jährigen US-Teenager Little Peggy Manch das deutsche Schlagersternchen Peggy March („Mit 17 hat man noch Träume“) gemacht Im Frühjahr 1964 flog er in die Hauptstadt von Tennessee. „Das war damals ein kleines Nest Der Flughafen bestand nur aus einer Baracke, an die die Maschine direkt ranrollte.“ Im RCA-Studio an der Music Row traf er allerdings auf die erste Musiker-Garde der Country-Metropole. Für die deutschen Aufnahmen griff Chet Atkins selbst zur Gitarre, und Floyd Cramer begleitete am Klavier. Beide hatten Elvis bei seiner ersten RCA-Aufnahme „Heartbreak Hotel“ unterstützt. Star der deutsch-amerikanischen Co-Produktion war Bobby Bare, der damals mit,,Detroit City“ einen weltweiten Hit hatte. Kabitzky: „Der sprach einen unglaublichen Cowboy-Slang, mit dem Deutschen kam er gar nicht klar.“ Bares Titel: „Alle glauben, daß ich glücklich bin“ und „Wilder Wolf und Brauner Bär“. Den Chor stellten die Anita-Kerr-Singers, mit denen Kabitzky gleich noch ein paar Playbacks für deutsche Schlager einspielte.
Und weil noch Zeit blieb, drängte Chet Atkins dem Deutschen einen Unbekannten auf: Willie Nelson, mit Kurzhaar-Frisur und Krawatte das totale Gegenteil seines späteren Outlaw-Images. Kabitzky wollte ihn eigentlich nicht produzieren („der war damals völlig unbedeutend“), aber da von der Nelson-Komposition „Pretty Paper“ (zurJahreswende 1963/64 ein Erfolg für Roy Orbison) ein deutscher Text vorlag, durfte Willie singen: „Little Darling, bitte warte auf mich.“ Die Aussprache war kaum besser als die von Bobby Bare. Kabitzky: „In Deutschland kam dafür keine große Begeisterung auf.“ Was die Teldec auch anstellte -Elvis blieb der Trumpf der RCA. Wenn er „Muß i denn zum Städtele hinaus“ sang, auf dem Cover in Uniform abgebildet, ließ sich das selbst an deutsche Omis verkaufen. Nach Willie Nelsons „Whisky-Walzer“ dagegen krähte kein Hahn.
In der bürgerlichen Welt der Bundesrepublik stieß der Rock ’n‘ Roll – daran hatte Presleys Wohlverhalten nichts geändert – auch im zehnten Jahr nach Bill Haleys Ouvertüre auf Unverständnis und Ablehnung. Als ihr Sprachrohr formulierte das „Hamburger Abendblatt“ am 29. Mai 1963 nach einem Jerry Lee Lewis-Auftritt im „Star-Club“, was man hierzulande über Rock’n’Roll dachte: „In dem dunklen Raum steht der Lärm wie ein gewaltiges Tier, er überfallt den Eintretenden mit elementarer Wucht, schlägt ihm hart in den Magen, brutal aufs Trommelfell, auf jeden Nerv. Der Lärm ist rhythmisch stampfend, wie in einer Maschinenhalle.“ Der Vergleich mit der Maschinenhalle gab den Ton an für die Publikumsbeschimpfung, die den Lesern suggerieren sollte: Hier tobt der Pöbel! „Die jungen Leute, zum Teil sehr jung, sind Maschinenarbeiter, Anlernlinge, Industrie-Lehrlinge, Hafenarbeiter, einfach, anspruchslos, stark. Es sind dieselben, die auf dem Dom die Raupenbahn belagern.“ Rock’n’Roll, das dokumentiert der Artikel, ist selbst in der Stadt, von der aus Teldec und DGG halb Europa mit dieser Musik versorgten, nie willkommen gewesen.
Die abgrundtiefe Abneigung gegen eine Musik, die „einfache Gemüter“ begeisterte, war wohl der Grund, warum das Lokalblatt die sensationellen Dinge verschlief, die sich vor seiner Haustür abspielten. Nach Bill Haleys Deutschland-Debüt war die Bundesrepublik zunächst wieder zur Pop-Provinz geworden, in die sich kein internationaler Star verirrte. Und dann das: Dem Manager des „Star-Gub“, Manfred Weißleder, gelang es im Laufe eines Jahres, alles was Rang und Namen hatte, auf die Bühne in St. Pauli zu bringen. bn 1962 an gaben sich die Größen des Rock’n’Roll in dem ehemaligen Kino in der Großen Freiheit die Klinke in die Hand.
Den Anfang machte im Mai Gene Vincent, dann ging es Schlag auf Schlag: Bill Haley, Fats Domino, Little Richard und Chuck Berry, der sich – vergeblich – seine Gage im voraus auszahlen lassen wollte, und erst auftrat, als er um seine körperliche Unversehrtheit furchten mußte.
Der „Fat Man“ Domino kam am 29. Oktober mit einer Charter-Maschine aus Nizza und brachte seine ganze Band mit. Seiner Plattenkarriere ging langsam die Luft aus, seiner Spielfreude aber tat das keinen Abbruch: Nach zwei Auftritten am selben Abend blieb er am Piano sitzen, als seine Band die Instrumente einpackte, und ließ sich von „Gerry And The Pacemakers“ weiterbegleiten. Unter den Bewunderern im Publikum: Siggi Loch, Label-Manager bei der Hamburger Philips, die ein Jahr später den Deutschland-Vertrieb für Dominos neue Vertragsfirma ABC übernahm.
Ein halbes Jahr nach Dominos Show in St. Pauli trat Ray Charles, der schwarze Superstar des ABC-Labels, in der Großen Freiheit auf. Loch, der inzwischen als Produzent im „Star-Club“ ein- und ausging, hielt den großen Moment im Foto fest Wiederum ein Jahr später konnte er mit Jerry Lee Lewis, dessen neue Mercury-Aumahmen auch bei Philips im Katalog standen, sogar eine der wenigen echten „Star-Club“-Platten aufzeichnen.
Der Auftritt von Jerry Lee Lewis markierte schon durch den Veranstaltungsort auf der Großen Freiheit das Ende einer Ära, den Beginn einer neuen Epoche. Die Beatles, die mit ihrer Beat-Musik vom „Star-Club“ aus den Rock’n‘ Roll verdrängt hatten, waren gerade auf dem besten Weg, die Mega-Seiler der EMI-Electrola zu werden einer Plattenfirma, die am Erfolg des Rock’n’Roll nie richtig Anteil hatte. Den Grund für die Rock’n’Roll-Abstinenz sieht Günter Wehrke, Repertoire-Manager bei der Kölner Firma, im damaligen Management „Das waren alles betagte Herren“, so sein Rückblick auf die Geschäftsleitung, die ihn 1961 als Assistent in der internationalen Abteilung einstellte. „Betagt von der Einstellung her, denn die waren kaum älter als 40. Sie hatten einen anderen Geschmack, mehr schnulzenmäßig auf Melodiöses ausgerichtet, so Lale Andersen und das Hellberg Duo.“
Die Electrola war zudem bei der internationalen Musik stark vom Einfluß der englischen Mutter geprägt. Und die hatte in der Nachkriegszeit nicht nur die Einführung der Langspielplatte verschlafen, sondern auch die Marktfiihrerschaft in der Unterhaltungsmusik abgeben müssen. So blieb der deutschen Tochter nicht viel anderes übrig, als das zu übernehmen, was sich aus dem mageren Angebot in den USA oder in England gut verkaufte.
Mit dem Vferlust des Vertriebsvertrages für die amerikanische RCA entging EMI das Geschäft mit Elvis, dem eigentlichen Motor des Rock’n‘ Roll. Während in England die ersten 13 Elvis-Titel noch auf dem EMI-eigenen Label HMV (His Master’s Voice) erschienen, konnte die Electrola/Carl Lindström GmbH, seit 1931 Tochter der Electric & Musical Industries (EMI), nicht mehr von diesem Geschäft profitieren. Was ihr blieb, war das Markenzeichen mit dem Terrier Nipper („Die Stimme seines Herrn“), das in Amerika der RCA gehörte. Daß 1956 die Capitol mit ihrem Repertoire von der Teldec zu Lindström wanderte, war nur ein schwacher Trost – ein Tausch Elvis gegen Sinatra.
Die Electrola, die in Berlin ausgebombt war und 1953 ihre Produktion nach Köln verlegte, hatte schon immer durch die englischen Verbindungen gute Geschäfte gemacht. Die US-Lizenzen dagegen ließen beim Umsatz zu wünschen übrig. Allenfalls die Jazz-Aufnahmen stießen auf mäßige Nachfrage. Aber vor 1956 war mit RCA-Aufhahmen, die auch bei Electrola unter His Master’s Voice liefen, kein Staat zu machen.
Durch den Abgang der RCA verlor Electrola auch den Anschluß beim Rock’n’Roll. Günter Wehrke: „Das Interesse an RockV Roll war ja allgemein nicht sehr groß. Auch die deutschen Musiker sind da kaum drauf eingestiegen. Die haben lieber Swing gespielt – verständlich, nachdem das so lange nicht möglich war. Rock’n’Roll war für die Jugend Und da auch nur für ein paar Fans.“
MGM, das andere amerikanische LabeL das der Electrola schon früh durch die Verbindung zur EMI zur Verfugung stand, brachte zwar den Zugang zum Katalog von Hank Williams, aber der Erfolg blieb auch hier aus. Beim Electrola-Label Odeon sorgten die amerikanischen Aufnahmen der Firma King immerhin für annehmbare Umsätze. Aber selbst Hank Ballard, dessen „Twist“ Auslöser der Twist-Welle war, blieb neben Chubby Checkers Cover-Version kommerziell eine lahme Ente.
Checker, den Electrola – wie auch den Engländer Cliff Richard – später auf dem Columbia-Label in die Läden brachte, ließ immerhin Hoffnung auf bessere Zelten aufkommen. Zum ersten Mal erlebte man, wie sich ein internationaler Hit anbahnte. „Das ging ganz plötzlich los“, erinnert sich Günther Wehrke, „in einem Monat haben wir nur drei, vier Platten vom ,Twist‘ verkauft – im nächsten Monat dann gleich 5000.“
Der Durchbruch gelang Electrola erst mit den Beatles – aber nicht etwa durch Eigeninitiative: Die Kölner waren nicht auf die Idee gekommen, die Fab Four für ihr Odeon-Label zu verpflichten, als diese in Deutschland waren – sie warteten, bis EMI in England sie unter Vertrag hatte.
Philips, am 21. April 1951 von dem gleichnamigen holländischen Unternehmen in Hamburg gegründet, war beim Repertoire in einer vergleichbaren Situation. Auch die Holländer befriedigten zunächst einmal den Nachholbedarf an Jazz, ermöglicht durch einen Vertrag mit der amerikanischen Columbia (CBS), der ältesten Plattenfirma der Welt, die nach Differenzen mit der EMI auf diese Weise wieder Zugang zum europäischen Markt bekam. Und wie bei Capitol und Brunswick machten Filmmelodien (Doris Day!) einen Großteil der Aufnahmen aus.
Im Katalog zu Weihnachten 1956 versuchte Philips zwar, sich an die Rock’n’Roll-Welle zu hängen, aber selber hatte das Label nichts dergleichen anzubieten. Den Anschluß an die „Rock’n’Roll-Masche“ schaffte Philips erst Anfang der 60er Jahre, als die Holländer sowohl ABC als auch Mercury ihrem Label-Spektrum hinzufugen konnten. Aber da war es schon zu spät. Aus Amerika kamen keine Innovationen mehr. Selbst dort begann englische Musik, den Sound der 50er Jahre zu verdrängen.
Der Standort Hamburg erwies sich in dieser Phase jedoch als günstig für den holländischen Konzern. Während Deutsche Grammophon und Teldec den Rückgang ihrer Umsätze beklagten, entdeckte der 22jährige Philips-Label-Manager Siggi Loch den „Star-Club“. „Ich wurde von der Philips als Jazz-Spezialist angestellt“, erzählt Loch, heute selbstständiger Produzent in Hamburg. „Der Vertrag, den die Firma mit Columbia hatte, lief bis 1963. Aber schon 1962, als ich anfing, stellte man sich auf den Repertoire-Verlust ein. Man wollte die Lücke mit Jazz ausgleichen.“ Daß der Rock’n’Roll bei Philips keine Rolle spielte, erklärt auch Loch mit dem Columbia-Material, an das die Holländer vertraglich gebunden waren. Wie Capitol hatte Columbia, einer der vier großen Musik-Konzerne in den USA, die Rock-Revolution verschlafen. Loch:,,Neue Formen der Unterhaltungsmusik sind nie das Thema der großen Firmen gewesen. Die beschäftigen sich erst damit, wenn die von den Kleinen entdeckten Künstler Stars geworden sind. Die Großen hinken immer hinterher, die Subkultur wird von ihnen erst später aufgegriffen.“
Er selbst bewies allerdings die Ausnahme von der Regel: Durch die Initiative des jungen Label-Managers kam Philips an die ersten Beat-Aufnahmen und sah sich unvermittelt in der Rolle des Vorreiters. 1964 entstand aus der geschäftlichen Verbindung von Siggi Loch und Manfred Weißleder das „Star-Club“-Label der Philips – eine einmalige Dokumentation des Höhepunkts der Beat-Welle in Deutschland. Und zugleich ein Dokument vom Ende des Rock’n’Roll.