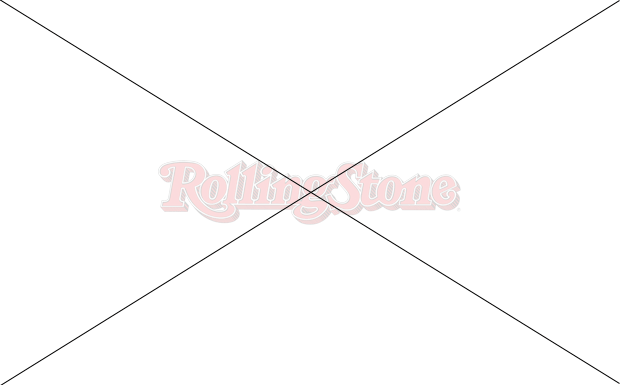Wes Anderson im Interview: Bono statt Marx
Heute werden die Filmfestspiele in Cannes mit dem Film "Moonrise Kingdom" von Wes Anderson eröffnet. Und das, obwohl Anderson selbst erstmalig dabei ist. Joachim Hentschel traf den US-Filmregisseur vorab zum Interview und sprach mit ihm über den typischen Wes Anderson-Gucker, Philosophie und Ankleidegewohnheiten.

Es gibt keinen Grund, warum US-Filmregisseure nicht auch Stilikonen sein könnten – obwohl einem spontan kaum einer einfällt: Lynch, Waters, Hitchcock vielleicht, aber der war Brite. Umso brillanter strahlt an diesem Londoner Morgen der ockerfarbene Cord, in den Wes Anderson praktisch komplett gekleidet ist. Anderson, 42, Texaner, einer der derzeit besten und stilbildendsten Filmemacher Amerikas, trägt zum Anzug farblich passende Wallabee-Schuhe und einen babyblauen Kaschmirpulli, sieht unglaublich gut aus und hat eine noch bessere Begründung dafür. „Ich bestelle bei meinem Schneider immer mehrere Anzüge auf einmal“, sagt er, minimal peinlich berührt. „Man spart so viel Zeit, wenn man jeden Tag die gleichen Sachen trägt und nie nachdenken muss, was man anzieht.“ Was auf paradoxe Art gleich noch die Frage beantwortet, warum Regisseure so selten Stilikonen sind. Außer sie haben Andersons Schneider.
Für ungeheuer farb-, form- und symmetriebewusste Filme ist er ja auch bekannt, „Rushmore“, „Die Royal Tenenbaums“ oder „Darjeeling Limited“, zuletzt das atemberaubende Puppentheater „Der fantastische Mr. Fox“. Filme, die trotzdem vor allem für ihre Charaktere und Geschichten geliebt werden, die desorientierten jungen Männer, depressiven schönen Frauen, komischen Puppenhaus-Familien, für den literarischen Ton, die gute Musik. Wes Andersons neues Werk „Moonrise Kingdom“ (deutscher Kinostart: 24. Mai) hat zwei zwölfjährige Helden, einen Jungen und ein Mädchen, die gemeinsam von zu Hause weglaufen und auf einer kleinen Insel vor der neuenglischen Küste eine irre Verfolgungsjagd lostreten. Edward Norton als Pfadfinderführer, Bruce Willis als Inselpolizist und Bill Murray als Vater des Mädchens begeben sich auf die Spur der Ausreißer, eine Mischung aus Gefängnisflucht- und Katastrophenfilm, auf Anderson-Art natürlich. Die Krönung: „Moonrise Kingdom“ wird am 16. Mai die diesjährigen Filmfestspiele in Cannes eröffnen. Für Anderson eine Ehre, die er noch gar nicht richtig einzuordnen weiß.
Mister Anderson, was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass ihr Film das Cannes-Festival eröffnen wird?
Das war eine sehr aufregende Nachricht, denn ich war noch nie in Cannes dabei. Was könnte großartiger sein, gleich beim ersten Mal? Ich kenne die ganzen Abläufe und Rituale natürlich überhaupt nicht, deshalb erklären mir alle gerade schon mal, wie es in Cannes läuft: „Erst macht man das, dann geht man da hin …“ Wenn ich an Cannes denke, leuchten in mir die Bilder auf, wie Truffaut und Godard im Mai 1968 das Festival zum Abbruch brachten. Oder Postkartenfotos von der Croisette. Ich kenne die Geschichte, aber ich habe keine Ahnung, wie es heute auf dem Festival aussieht.
Aber wieso waren Sie nie dort?
Weil es zeitlich nie passte! Alle meine Filme wurden im Herbst fertig, ich war in Venedig, New York, bei der Berlinale. Aber nie in Cannes.
Was bringt einem Regisseur wie Ihnen überhaupt die Teilnahme an solchen Festivals? Der rote Teppich bedeutet Ihnen doch nichts.
Na ja, als Regisseur verbringt man mit einem Film ja erst mal unglaublich viel Zeit, wenn man ihn dreht. Dann startet er und ist … weg! Man erfährt nicht mal, wo er überall gezeigt wird, wie die Leute reagieren. Das ist das Schöne an Festivals: Man ist dabei, mit einem Publikum, das sich darauf freut! Im Prinzip der einzige Moment, in dem es wirklich eine Art Show um den Film gibt, eine Inszenierung, in der man als Regisseur eine gewisse Rolle spielt.
Wie wenn eine Band auf Tour geht?
Ja, quasi die Live-Performance! Ich sehe das so: Das ist die große Nacht, die wir so intensiv wie möglich genießen sollten – wer weiß, was danach sein wird? Es kann ja gut sein, dass es beim Festival fantastisch läuft, und hinterher geht kein Mensch ins Kino.
Und was war die größte Festivalnacht des Wes Anderson?
Ich weiß nicht … Ich erinnere mich später meistens nur an die schlechten Nächte, nicht an die guten.
Dann eben: die schlechteste?
Für meine ersten zwei Filme machten wir Ende der Neunziger Testvorführungen in Kalifornien. Und die waren desaströs. Richtig, richtig schlimm. Beim ersten, „Bottle Rocket“, saßen rund 350 Leute im Publikum – und hundert von ihnen verließen im Lauf des Screenings den Saal, die meisten während der ersten halben Stunde. Wir schauten fassungslos zu, wie sich der Saal leerte. Die Leute vom Studio meinten, solche Abwanderungen wie bei „Bottle Rocket“ und später bei „Rushmore“ hätten sie noch nie erlebt.
Was macht man da? Haben Sie die Filme dann umgeschnitten?
Bei „Bottle Rocket“ haben wir uns hinterher schon gedacht: Das und das funktioniert vielleicht nicht richtig, da müssen wir nochmal ran. Allerdings kann man meiner Meinung nach mehr Verwertbares über einen Film lernen, wenn das Publikum ihn grundsätzlich mag. Wenn sie ihn hassen – tja, wo soll man anfangen? Bei „Rushmore“ war das Kalifornien-Screening auch grauenvoll, aber der Film war fertig, endgültig. Kurz danach zeigten wir ihn in Toronto, mit anderen Leuten. Und da lief es super!
Sie haben ohnehin Ihr ganz eigenes Publikum: die sprichwörtlichen Wes-Anderson-Gucker. In den Achtzigern aufgewachsen, Großstädter, noch nicht ganz im Erwachsensein angekommen, an Literatur interessiert … Kennen Sie die?
Lassen Sie es mich so sagen: Man ist sehr froh, überhaupt eine Anhängerschaft zu haben. Und so gesehen ist jede Fangemeinde ein guter Ausgangspunkt. Was das für Leute sind? Nun ja – völlig klar, dass man jede Gruppe von Menschen auf ein Stereotyp reduzieren kann. Und dass jeder Einzelne von ihnen dann sagen wird: „Aber so bin ich doch gar nicht!“
Aber Sie kennen das Klischee?
Welches Klischee?
Wie eben gesagt: die romantischen Hipster in ihren Dreißigern oder Vierzigern, die sich mit vielen Ihrer Themen und Stimmungen besonders gut identifizieren können.
Ich weiß, welches … welches … kulturelle Profil Sie zu beschreiben versuchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Realität entspricht. Vielleicht sagen ja manche Zuschauer nur: „So sehe ich die anderen!“ Ich weiß nicht … man liest es halt häufig. Journalisten schreiben das nun mal gerne.
Aber das ist doch schon ein wiederkehrendes Element in Ihren Filmen, besonders jetzt in „Moonrise Kingdom“: Kinder, die sich wie Erwachsene verhalten, und Erwachsene, die wie Kinder sind. Das ist ja eine Tendenz, die man in der jungen urbanen Mittelschicht findet – das Problem mit dem Erwachsenwerden. Ist das nicht Ihr Thema?
Nein! (lacht) So würde ich den neuen Film auch gar nicht sehen. Es geht um zwei Zwölfjährige, aber wie in jeder Geschichte, die man so erzählt, haben alle Personen ihre Probleme, ihre Prägungen, ihre Persönlichkeiten. Außerdem haben wir einen Cast aus großartigen Schauspielern, die sich selbst einbringen in die Rollen. Was Sie beschreiben, ist kein Thema, das mich sonderlich beschäftigt. Aber auch hier: Es ist etwas, das viele Leute oft über meine Filme sagen.
Die laden ja auch dazu ein, tief in ihnen zu lesen. Sie sind ja schließlich auch studierter Philosoph. Sie haben den Philosophie-Bachelor-Abschluss, oder?
Ja, den habe ich. (lacht)
Weil Sie immer schon ein Faible für Philosophie hatten?
Ich habe vor allem deshalb Philosophie gewählt, weil mein älterer Bruder das auch studierte. Das soll nicht heißen, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Auf die Art habe ich Bücher gelesen, die ich sonst nie angefasst hätte. Allerdings: Ich habe nie außerhalb der Uni einen philosophischen Text gelesen. Weder vorher noch nachher.
Sie waren keiner der jungen Männer, die rumlaufen und Hegel oder Marx zitieren?
Nein, ich habe nicht mal Hegel und Marx zitiert, als ich ihre Bücher las. Ich hätte mir auch nie ein solches Zitat merken können.
Wen hat der junge Wes Anderson denn zitiert?
Ich glaube, ich habe nie jemanden zitiert. Und wenn überhaupt, dann höchstens Bono.