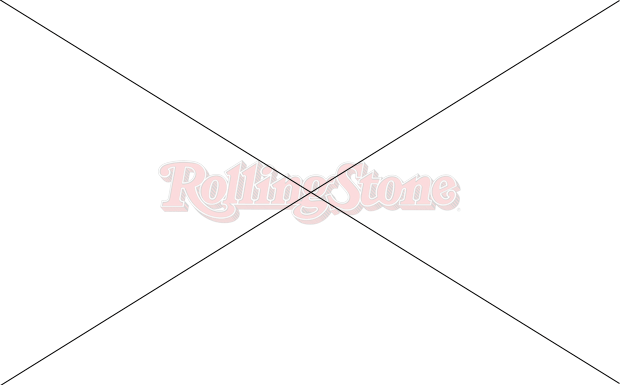Von Bob Dylan empfohlen: Elijah Wald über Greenwich Village
Wald lieferte mit seinem Buch „Dylan Goes Electric" die Vorlage für das Biopic „A Complete Unknown“.

Es waren nur wenige, wenngleich sagenumwobene Jahre, in denen New Yorks Greenwich Village zum Mekka aller Folk-Sänger wurde. Suze Rotolo, Bob Dylans „Freewheelin’“-Freundin, zeichnete einmal eine hübsche Skizze vom Village, auf der sie alle wichtigen Wahrzeichen eintrug: In vier Straßenzügen ballten sich 20 Clubs, Bars und Cafés, davon allein neun in einem einzigen Block der MacDougal Street.
Dave Van Ronk, der dort so häufig auftrat, dass man ihn „The Mayor of MacDougal Street“ taufte, war am Ende aber nur noch genervt. Wenn am Wochenende die Busse mit den Touristen anrollten, um im Village die Freaks und Bohemiens zu begaffen, habe man den Eindruck eines „Nonstop-Karnevals“ gehabt.
Van Ronk war einer der wenigen Folkies, die in New York groß wurden und den explosionsartigen Boom aus nächster Nähe erlebten. Während Anfang der Sechziger junge Gitarristen aus ganz Amerika ins Village strömten, hatte er sich bereits zehn Jahre früher auf den Weg gemacht – mit der Subway aus Brooklyn.
In den Fünfzigern war die Folk-Szene noch eine kleine Clique von idealistischen Amateuren, die sich sonntagnachmittags am Washington Square trafen. Niemand von ihnen hätte je einen Gedanken daran verschwendet, einmal ein kommerziell erfolgreicher Folk-Sänger zu werden. (So wie auch die Beatniks in den benachbarten Jazz- Kneipen keinerlei Bock hatten, eines Tages als illustre Literaten gerühmt zu werden.) Der Grund war einfach: Wer Erfolg haben wollte, musste sich prostituieren und die Authentizität der ländlichen Folk Music dem „fake folk“ eines Harry Belafonte opfern. Der kam zwar auch aus dem Village, hätte aber genauso gut aus einem anderen Universum stammen können.
Die Neo Ethnics
Im Rückblick nannte Van Ronk sein Publikum „Neo Ethnics“ – und beschrieb damit ein reales, wenngleich bizarres Phänomen: dass nämlich Teenager aus New York so zu singen versuchten, als seien sie auf einer Farm in den Südstaaten groß geworden. Gleichzeitig sah er aber auch die ernsthafte künstlerische Ambition – und die weitreichende Wirkung, die ihre Bemühungen haben sollten. Sie kreierten eine neue Ästhetik, die „Authentizität“ als qualitatives Kriterium etablierte – und traditionelle Folk Music als unverfälschte, ernst zu nehmende Kunst.
Die frühere Folk-Generation hatte sich genau das Gegenteil zum Ziel gesetzt: Um dem gesetzten Bürgertum die Musik schmackhaft zu machen, hatte man alles allzu Archaische abgeschmirgelt. Man trug seriöse Anzüge und Abendkleider und sang mit klassisch geschulten Stimmen. Die Weavers- Nummer „Irene, Goodnight“, 1950 ein Nummereins- Hit in den USA, lieferte den Prototypen für diesen kommerziell aufge hübschten Folk, der durch Belafonte, The Tarriers, das Kingston Trio und die Highwaymen weiteren Zulauf bekam. „The Banana Boat Song“, „Cindy“, „Tom Dooley“ und „Michael, Row The Boat Ashore“ schafften es allesamt in die Top 10 der Popcharts.
Sicher, auch am Washington Square wurden diese Lieder gesungen, doch die wirklich beinharten Folkies fühlten sich eher in den esoterischen Nischen zu Hause. An einem sonnigen Nachmittag konnte man hier eine Gruppe von Kids hören, die gerade die kommunistischen Sommer-Camps am Ufer des Hudson River besucht hatten und nun internationale Arbeiterlieder sangen. Gleich daneben gab’s eine zionistische Jugendgruppe, die israelische Volkstänze aufführte.
Die Bluegrass-Gruppe war die lauteste, angeführt von Banjo-Guru Roger Sprung, der vermutlich jeden Bluegrass- und Country-Musiker in New York unter seine Fittiche genommen hatte. Andere Folkies suchten sich ein ruhigeres Plätzchen, wurden aber auch dort – wenn sie denn überdurchschnittlich begabt waren – schnell von kleinen Grüppchen Hör- und Schaulustiger umringt.
Folk v. Pop
Van Ronk erinnert sich daran, dass die Konkurrenz enorm und manchmal auch lästig gewesen sei. Als Solist empfand er die Horden der Protestsänger und Bluegrasser als zu laut und hätte sich mehr Raum für Blues- und Balladen-Sänger gewünscht. Doch niemand hier nahm auf professionelle Interessen Rücksicht. Und auch Van Ronk, der von der Hand in den Mund lebte und bei Freunden übernachtete, hätte nie und nimmer seinen Gitarrenkoffer am Square ausgepackt, um damit Geld zu verdienen. Für ihn und seine Freunde ging’s um etwas völlig anderes.
Die „Neo Ethnics“ lernten und spielten nicht nur die Musik, die sie liebten. Inmitten des Kalten Kriegs und seiner atomaren Bedrohung sahen sie in der traditionellen Musik eine Oase im politischen Wahnsinn – etwas, das weitaus wichtiger und substanzieller war als die Kommerzkultur, die ihnen täglich durch Radio und Fernsehen vorgesetzt wurde. Für sie war Folk Music keine beiläufige Unterhaltung, sondern große, echte Kunst, mit der sich die elementaren menschlichen Gefühle transportieren ließen – und insofern nicht weniger bedeutsam als Jazz oder klassische Musik.
Beim Studium dieser Musik wollten sie sich auch nicht mit Oberflächlichkeiten aufhalten, sondern selbst die vertracktesten Fingerpicking-Styles lernen, die sie bei den Blues- und Country-Größen der 20er- und 30er-Jahre gehört hatten – Musikern wie Lead Belly, Mississippi John Hurt, Clarence Ashley oder Dock Boggs. Sie wussten, dass sie damit kein Geld verdienen konnten, doch das Wissen um den Wert dieser Musik war ihnen Belohnung genug. Wie bei der „Alte Musik“-Bewegung, die zur gleichen Zeit Bach und Vivaldi entstaubte, war man damit zufrieden, ein kleines Grüppchen echter Kenner anzusprechen, mit denen man dieses geheime, kostbare Wissen teilte.
Die ersten Folk-Clubs
Es gab vergleichbare Folk-Zellen in anderen amerikanischen Städten – nicht zuletzt in Cambridge, Massachusetts, wo Joan Baez in einem Café namens Club 47 residierte –, aber New York war nun einmal das Zentrum der Musikindustrie und allein deswegen eine andere Nummer. Und selbst wenn sie diese Industrie hassten, so waren die Folkies doch von geschäftstüchtigen Agenten umgeben, die weniger Interesse an Kunst als an Kohle hatten.
Ende der Fünfziger registrierten einige dieser Geschäftsleute, dass immer mehr Zuschauer zum Washington Square pilgerten, um sich im Park die kostenlose Musik anzuhören. Der erste Folk-Club hatte 1957 seine Pforten geöffnet, gleich an der Ecke von 3rd Street und MacDougal: Das Café Bizarre war für die Biedermänner gedacht, die sich im Village die Beatniks und andere Verrückte anschauen wollten.
Die Inneneinrichtung gemahnte an ein billiges Geisterhaus: Kerzen auf den Tischen, Spinnengewebe an den Dachsparren, gruselige Artefakte an den Wänden und Kellnerinnen mit rabenschwarzen Eyelinern. Auf der Bühne wechselten sich Folk-Sänger und Beat-Poeten ab.
Ein Jahr später kam das Café Wha?, das mit einer Illustration warb, auf der man einen prototypischen Beatnik mit Berét, Bart und Sonnenbrille sah. Auf dem Programm standen „folk singing, comedy, calypso, poetry, and congas“. Wie die meisten Clubs in diesen Jahren war es ein „basket house“: Die Musiker bekamen keine Gage, sondern ließen das Körbchen kreisen.
Die Clubs lieferten ihnen erste Auftrittsmöglichkeiten, waren unter Musikern aber trotzdem als Touristenfallen verschrieen. Das eigentliche Herz der Village-Gemeinde schlug in einem kleinen Laden auf MacDougal, der 1957 von einem Folk-Aficionado namens Israel Young gegründet worden war und auf den Namen „Folklore Center“ hörte. Young verkaufte Bücher, Platten, Musikalien (Zithern, Mundharmonikas, Gitarrensaiten) und war – wie Dylan in „Chronicles“ schrieb – „Kreuzung und Knotenpunkt aller nur erdenklichen Folk-Aktivitäten“.
Zu Bob Dylans erstem Auftritt kamen 51 Besucher
Musiker schauten rein, um sich Plektrons und Saiten zu kaufen, hingen dann aber den ganzen Nachmittag herum und tauschten sich mit Kollegen aus. Einige von ihnen kreuzten hier so regelmäßig auf, dass sie den Laden als ihre Postadresse benutzten. Dylan erinnerte sich an einen Ort, an dem er Jug-Band-Pioniere wie Gus Cannon aus Memphis kennenlernte, aber auch lokale Größen wie Van Ronk, der ihn einlud, nebenan im Gaslight Café aufzutreten. Neben seinem Laden organisierte Young auch kleine Konzerte (u.a. Dylans ersten Auftritt, der genau 51 Besucher zählte) und überredete 1960 einen Bar-Besitzer namens Mike Porco, ihm seine Kneipe für gelegentliche Konzerte zu überlassen.
Der Laden hieß Gerdes, war sechs Häuserblöcke von MacDougal entfernt und im Nu ein voller Erfolg. Bereits nach wenigen Monaten entschloss sich Porco, von nun an regelmäßig Folkies auf die Bühne zu holen. Die Kneipe, inzwischen in Folk City umbenannt, sollte der prominenteste Folk-Club im ganzen Village werden.
Folk City engagierte keine Beat-Poeten – und da man eine Alkohol-Lizenz besaß, konnte man den auftretenden Musikern sogar eine kleine Gage zahlen. Über Nacht wurde Folk City der gefragteste Club der ganzen Stadt – auch wenn die Konkurrenten sich explosionsartig vermehrten.
Das Gaslight Café
Einer von ihnen war das Gaslight, ein Keller-Kaffeehaus auf MacDougal, in dem Van Ronk jeden Dienstag seinen „hoot“ veranstaltete. In ihrem Film „Inside Llewyn Davis“ lassen die Coen-Brüder diese beiden Lokalitäten verschmelzen: Das Ambiente von Llewyns Stammlokal stammt aus Folk City, doch benannt wurde es nach dem Gaslight.
Im Laufe weniger Jahre sollten diese Clubs das Selbstverständnis der Folk-Szene verändern. Einige der Amateure vom Washington Square weigerten sich grundsätzlich, in diesen Läden aufzutreten, während andere dankbar waren, von ihrem Hobby leben zu können. Wobei es sicher kein luxuriöses Leben war – und nur wenige der frühen Folkies die Fünfziger überlebten.
Andererseits strömten nun aus dem ganzen Land junge Musiker ins Village: Tom Paxton aus Oklahoma, Carolyn Hester aus Texas, Bob Dylan aus Minnesota, Phil Ochs aus Ohio. Auch New Yorker Sänger, die sich bislang für Folk nicht erwärmen konnten, kamen ins Village, um das Phänomen unter die Lupe zu nehmen.
Fred Neil war ursprünglich ein Pop-Songschreiber, zog dann aber ins Village, weil er lieber vor ernsthaften Erwachsenen singen wollte als vor tanzenden Teenagern. Im Wha? institutionalisierte er eine „Open Mike“-Nacht, in der jeder auf die Bühne durfte, der sich berufen fühlte. (Wozu auch ein gewisser Bob Dylan zählte.)
Touristenfallen
Arbeit gab es in den Clubs mehr als genug. War man gewillt, für einen Teil der Trinkgelder zu spielen, konnte man praktisch jede Nacht auftreten. Was wiederum dazu führte, dass die einstigen Amateure in kurzer Zeit zu routinierten Performern reiften. „Es war eine Schweine-Arbeit“, so Van Ronk, „weil die Touristen meist in den reinen Bars anfingen und schon hackevoll waren, wenn sie bei uns aufkreuzten. Wir spielten also für 50 oder 100 besoffene Provinzler, die sich einen Dreck um die Musik scherten. Sie wollten nur ein paar Freaks sehen und auf den Putz hauen. In einer derartigen Situation lernt man sehr schnell, wie man sich auf der Bühne verhält – oder sucht sich lieber eine andere Arbeit. Und die Leute, die genug Stehvermögen hatten, waren am Ende absolut geübte Profis.“
Der Prozess veränderte nicht nur die Musiker, sondern auch die Musik. Anfang der Sechziger spielten Leute wie Van Ronk, Joan Baez, Ramblin’ Jack Elliott, The New Lost City Ramblers und die Jim Kweskin Jug Band weiterhin die alten Folk-Songs und fanden damit ein wachsendes Publikum, das sich für die ländlichen Traditionen begeistern konnte.
Einige authentische Südstaatler – ältere wie John Hurt, aber auch jüngere wie Doc Watson – machten im Windschatten des Folk-Revivals sogar eine unerwartete und durchaus profitable Karriere. Der Schwerpunkt lag noch immer auf der Tradition – und nicht auf dem Kreieren neuer, eigenständiger Kunst. Immerhin: Viele von denen, die später einmal als Singer/Songwriter oder Rockstar Erfolge feierten, machten ihre Gesellenprüfung hier – bei den „Neo Ethnics“, die von Blues, Balladen und alter Country Music gar nicht genug kriegen konnten.
Folk als Starmaschine
Niemand hätte sich allerdings träumen lassen, dass diese verschworene Gemeinschaft einmal den Sound der weltweiten Popmusik prägen sollte. Die Veränderung machte sich zunächst auch nur in der hermetischen Folk-Welt bemerkbar, wo Dylans schnarrende, nasale Stimme wie das authentische Relikt einer ländlichen Vergangenheit klang. Was auf Außenstehende wie ein kommerzielles Handicap wirken musste, war in Wahrheit der Ritterschlag der Redlichkeit. Selbst seine späteren Hits lebten nicht zuletzt davon, dass mit seiner Stimme Authentizität und Unangepasstheit assoziiert wurden – und nicht die hübsche, vergängliche Welt der Popmusik.
Sein Erfolg öffnete die Tür für andere unorthodoxe Stimmen, die Schmerz und Leidenschaft als selbst erlebte Wirklichkeit artikulierten: Janis Joplin und Neil Young waren frühe Beispiele, aber selbst der rohe Rotz der Sex Pistols oder der breite Slang eines Snoop Dogg bekamen die Weihen der Pop-Coolness letztlich nur deshalb, weil ihre Stimmen den unbedingten Individualismus der frühen Folkies reflektierten.
Doch zurück zur MacDougal Street. Die erste Welle der Traditionalisten wurde inzwischen von einem Tsunami aus Beat-Poeten und Folk-Rockern überrollt. Die Revolution nahm 1961 ihren Lauf, als ein cleverer Promoter namens Albert Grossman drei Solisten überredete, künftig als Peter, Paul and Mary aufzutreten und traditionellen Folk mit neuen Kompositionen von Van Ronk und Dylan zu kombinieren. Ihr Debüt sollte 1962 das bestverkaufte Album in den USA sein – und Greenwich Village zur Folk-Metropole der Welt machen. Die Clubs schossen wie Pilze aus dem Boden –, und Hunderte neuer Performer kletterten auf die Bühnen des Villages.
Allerdings mochten sie inzwischen nicht mehr die Lieder anderer Leute singen, sondern schrieben ihre eigenen Songs. Viele von ihnen verfügten auch über attraktive Stimmen und sangen ausgetüftelte Harmonien – und konnten dem kargen Duktus der Delta-Blueser oder Tennessee-Farmer nichts abgewinnen.
Plattenfirmen standen Schlange
Einige der MacDougal-Favoriten, Judy Collins etwa, waren für die neue Geschmacksrichtung geradezu prädestiniert, aber auch Neuzugänge wie Simon & Garfunkel, ursprünglich im Teen-Pop zu Hause, nutzten die Village-Clubs als Sprungbrett zum Erfolg. Van Ronk nannte es „the great folk scare“ – die beunruhigende Phase, in der praktisch jedermann zu Ruhm und Reichtum kommen konnte, wenn er denn nur eine Gitarre und ein wenig Glück hatte. „Das Ding wurde größer, als es sich selbst die größten Optimisten unter uns hatten vorstellen können.
Plötzlich drückten dir die großen Plattenfirmen Verträge in die Hand, als seien es Baseball-Karten in einer ,Cracker Jack‘-Box. Es regnete geradezu Geld. Leute, die auf dem Fußboden geschlafen hatten und sich kaum ernähren konnten, kauften sich plötzlich Anzüge, Autos, Häuser. Wobei der Mainstream-Erfolg auch bemerkenswerte Veränderungen in der kreativen Ausrichtung auslöste:
Viele talentierte Leute stießen zum Folk, die eigentlich mit dieser Musik nichts am Hut hatten.“ Es war eine endlose Party, eine unglaublich aufgekratzte Zeit, die viele Akteure noch heute als die beste Phase ihres Lebens in Erinnerung haben.
Andere wiederum sehen mit Enttäuschung und Verbitterung auf diese Jahre zurück: Auf jeden Dylan, auf jede Joan Baez oder Joni Mitchell kamen halt Hunderte hoffnungsvoller Musiker wie Llewyn Davis, die talentiert waren, aber vielleicht nicht talentiert genug – oder aus einem anderen, ganz banalen Grund nie ihre Chance bekamen. Als 1965 ins Land zog, war die Götterdämmerung jedenfalls schon vorbei.
Der Autor
ELIJAH WALD ist Musiker und Autor. Zu seinen Büchern zählen „Escaping the Delta: Robert Johnson and the Invention of the Blues“ (in Deutschland als „Vom Mississippi zum Mainstream“ bei Rogner & Bernhard erschienen) und, zusammen mit Dave Van Ronk: „The Mayor of MacDougal Street“ („Der König von Greenwich Village“, Heyne Hardcore), das die Vorlage für den Film „Inside Llewyn Davis“ der Coen-Brüder lieferte. Sein Buch „Dylan Goes Electric“ , das Bob Dylan auf X empfahl, war für James Mangold die wichtigste Quelle für sein Drehbuch zu „A Complete Unknown“.