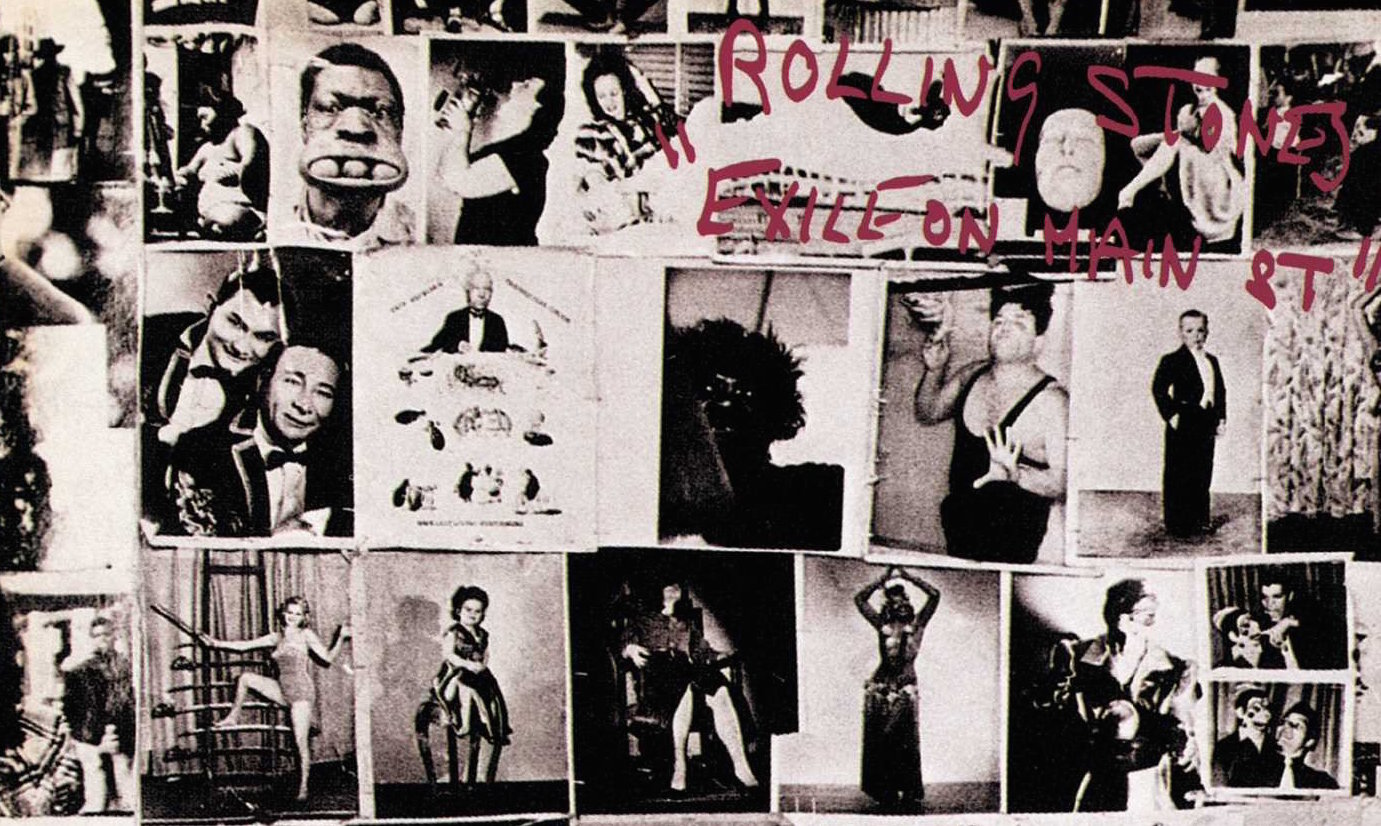Unglaublich: „Fear The Walking Dead“ ist besser als „The Walking Dead“
Die Ableger-Serie des immens erfolgreichen Zombie-Formats strauchelt zwar in den Quoten, hat aber die interessanteren Themen: Nach der Apokalypse werden die Machtverhältnisse zwischen den USA und Mexiko neu verhandelt

„Vorher war das noch Mexiko“, sagt Jeremiah Otto (Dayton Callie) und zeigt auf den sandigen Boden seines Grundbesitzes. „Davor war es Spanien. Davor das Land der Rothäute.“ Jetzt haben seine Siedler und er sich hier ihre Heimat ausgesucht. Umringt sind sie natürlich, wir befinden uns in der Apokalypse, von Untoten. Ländergrenzen zählen nicht mehr. Und die Amerikaner haben wieder einmal Territorium erobert.
Zwar offenbart auch die dritte Staffel von „Fear The Walking Dead“, von der bislang fünf Episoden ausgestrahlt wurden, dass sie wohl keine großartige Serie mehr wird. Es fehlt ein Blick auf das „Big Picture“, es gibt keinen Hinweis darauf, wohin die Story will. Die Produzenten hatten vor Serienstart 2015 angekündigt, den Ursprung der Zombie-Seuche zu erklären (der Vorläufer „The Walking Dead“ hatte sich eh nie damit aufgehalten), was aber nicht eingehalten wurde.
Keiner kann die Lücke füllen
Es fehlt auch eine Entwicklung der Figuren. Der plötzliche Tod von Leistungsträger Travis Manawa (Cliff Curtis) legte Schwächen offen, demonstrierte, wie unausgebaut die anderen Figuren sind. Keiner der anderen Darsteller, etwa Kim Dickens (als Madison Clark) Frank Dillane (Nick) oder Colman Domingo (Victor Strand), konnten die Lücke, die der Anti-Held Travis hinterließ, füllen. Zur Diskussion steht auch, ob es dramaturgisch klug war, die persönlichen Schwierigkeiten zwischen den Familien Madison und Manawa, bislang treibende Erzählmomente, dadurch zu beenden, indem eine der Familien nun komplett ausgelöscht wurde (Travis Manawa, Chris Manawa, Liza Ortiz).

Aber „Fear The Walking Dead“ wird trotzdem immer besser, weil es immer politischer wird. Die Serie behandelt, ganz im Gegensatz zum immens erfolgreicheren, großen Bruder „The Walking Dead“, zumindest die Auswirkungen der Apokalypse auf die Beziehungen zwischen Nachbarländern. Dass Staatschefs nicht mehr miteinander verhandeln, scheint angesichts des nicht mehr zu kontrollierenden Weltuntergangs zwar klar; sie sitzen wahrscheinlich in ihren Luxus-Bunkern. Aber alle anderen müssen untereinander klarkommen. Der Trupp um Madison, in Season zwei noch mit dem Boot von Los Angeles aus aufgebrochen, ist in Mexiko angelangt.
Bislang haben die AMC-Showrunner um Greg Nicotero der naheliegenden Versuchung widerstanden, ihre Geschichte mit Anspielungen auf Donald Trump zu versehen, dem US-Präsidenten, der an der Grenze so gerne eine Mauer zwischen den Amerikanern und Mexikanern errichten würde. Der glaubt ja, dass sonst zu viele Vergewaltiger und Jobsucher in die USA kämen.
Kampf ums Wasser
Aber in „Fear The Walking Dead“ sieht es eher danach aus, als brächten die Amis Probleme nach Mexiko. Das Trinkwasser wird auch dort knapp, es gibt Kämpfe, und amerikanische Paramilitärs zerstören jede Form von Diplomatie. Zwar sind es auch auf mexikanischer Seite nicht gerade Peacekeeper, die für Ordnung sorgen, sondern Gangster, etwa die um Dante Esquivel (Jason Manuel Olazabal), der Tijuana gerne im Griff gehabt hätte. Aber die Fragen: Wer war zuerst hier, wer hat Gewohnheitsrecht, zählen Ländergrenzen noch – sie bieten Denkanstöße, die das populärere „The Walking Dead“ mit seinen sieben Staffeln längst nicht auf dem Schirm hat.
In den dortigen Wäldern um Atlanta gibt es seit einigen Seasons Stellungskriege, aktuell zwischen Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Negan (Jeffrey Dean Morgan). Sie kämpfen im Radius von wenigen Kilometern. Als Zuschauer freut man sich deshalb über jeden kurzen Blick über die Baumwipfel und auf die Skyline Atlantas, das ist wie eine Gedankenflucht. Ricks und Negans Auseinandersetzungen finden aus Macht-Motiven statt, die den Zuschauer faszinieren können, aber nicht müssen.

„Fear The Walking Dead“ bewegt sich in Richtung des großartigen Romans „World War Z“ von Max Brooks. In seiner Oral History vom Kampf der Menschheit gegen die Zombies schildert Brooks eindrucksvoll, welche Nationen die Oberhand gewinnen können, falls die Untoten angreifen. Es sind Inseln wie Kuba, vormals isolierte Länder, die zu neuen Weltmächten aufsteigen; oder abgelegene Regionen am Polarkreis und unter dem Gefrierpunkt, wo keine Leiche langschlurfen will.
Nationen werden zu Global Playern (und zu Migrationszielen), die in der bisherigen Weltordnung, welche die Länder nach Wirtschaftsleistung und militärischer Bündnis-Stärke bemessen hatte, unbedeutend waren. Es gibt nach der Apokalypse bestimmt Staaten, die sicherer sind als Mexiko, aber es scheint für unsere kalifornischen Helden dort doch besser zu laufen als im brennenden Moloch Los Angeles, wo keinerlei Übersicht möglich ist (dennoch: Städte bieten, zumindest für den Zuschauer, die reizvolleren Szenarien, mehr Winkel, Dunkelheit, Schrecken). So scheint es zwar nicht klar, ob diese Serie noch lange in Mexiko spielen wird – die Folgen hangeln sich eben von Schauplatz zu Schauplatz – aber dort, wo die Figuren derzeit sind, ist noch viel Spielraum.
Episode fünf von „Fear The Walking Dead“, „Burning In Water“, Drowning in Flame“, behandelt auch einen Aspekt, der in keiner der beiden AMC-Zombieserien bislang untergekommen ist – obwohl er essentiell erscheint. Natürlich kann man sich in „Gated Communities“ von den Zombies abschirmen, damit man nicht von ihnen gebissen wird. Aber was passiert eigentlich, wenn drinnen jemand unerwartet stirbt – an Altersschwäche – wie verhindert man die Zombie-Epidemie von innen?