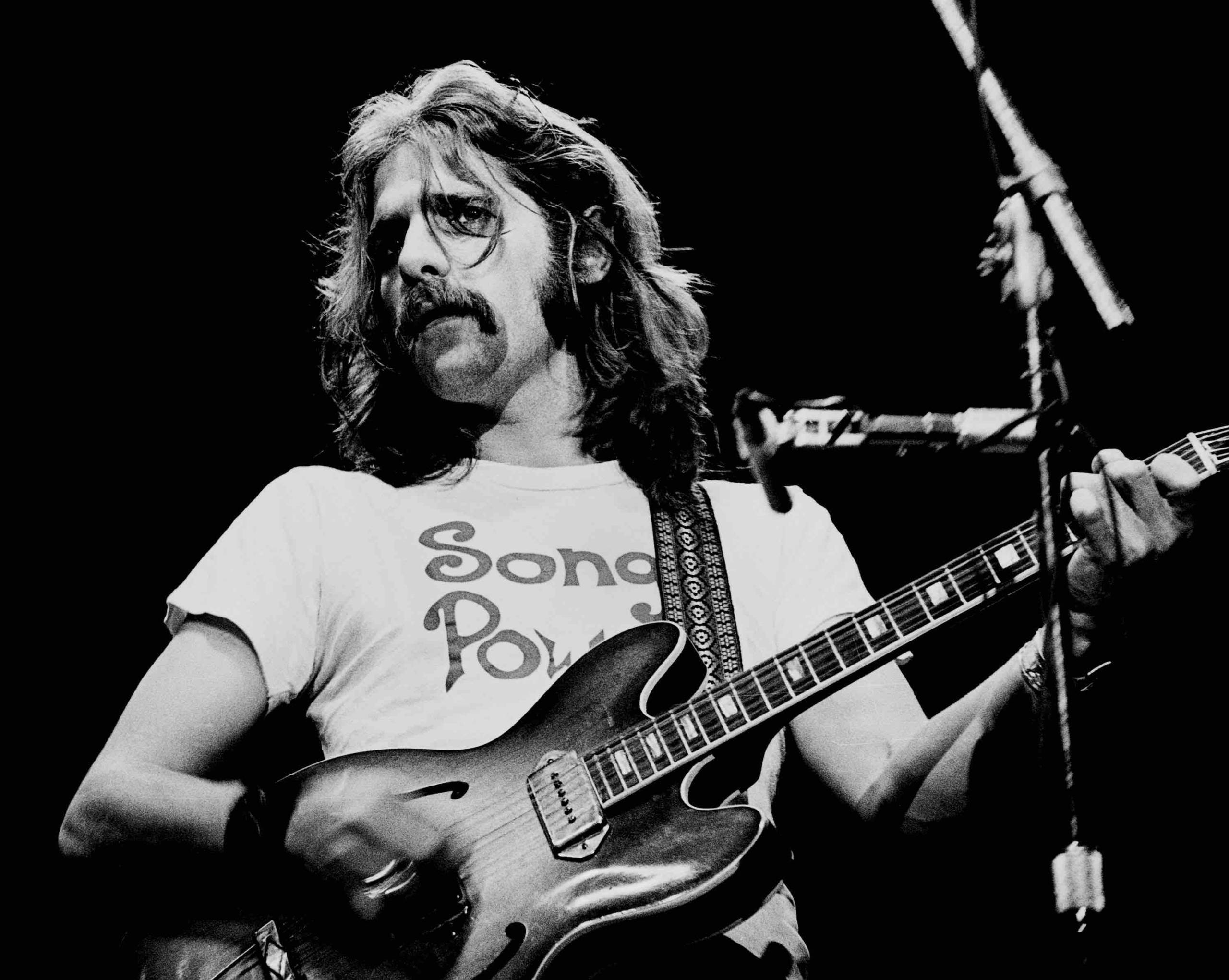Tour der Leiden
Neue Liebe, neues Leben - Sheryl Crow hat alle persönlichen Krisen überwunden und verarbeitet sie im Hitformat

Die Gespräche mit Sheryl Crow anläßlich ihres letzten Albums „C’mon C’mon“ von 2003 – waren keine erquickliche Angelegenheit. Man hatte von schwerwiegenden inneren Krisen und Schwierigkeiten bei der Produktion gehört, doch darüber reden konnte man nicht. Crow antwortete – egal auf welche Frage – mit Promo-Platitüden und war ganz die im Umgang mit den Medien durchtrainierte US-Amerikanerin, die die offizielle Marketing-Botschaft auf jeden Fall überbringt – sonst aber auch nichts.
„Es war eine schlimme Zeit, ja“, seufzt Crow knapp drei Jahre später und redet endlich Tacheles. „Ich stand kurz vor meinem 40. Geburtstag, hatte jede Menge persönlicher Probleme und fühlte mich extrem unsicher: Habe ich überhaupt noch ein Publikum? Passe ich in ein Musikbiz, dessen Zielgruppe ausschließlich Teenager sind? Ich war völlig verkrampft, und folglich würden die Aufnahmen zu ,C’mon C’mon‘ ein totaler Kampf. Ich glaube schon, daß ein paar gute Songs dabei rausgekommen sind. Aber viele nicht.“ Ein ehrliches Wort, das tut gut.
Wie Crow da sitzt, hingefletzt in den Sessel eines in die Jahre gekommenen Londoner Design-Hotels, wirkt sie viel entspannter als zu besagter Krisenzeit, geradezu friedlich. „Es ist dann ja alles besser geworden, und das hat natürlich mit Lance zu tun“, spricht Crow sogar die Liebe zum Fahrradchampion an, „mein Leben begann buchstäblich an dem Tag zu heilen, an dem wir uns trafen.“ Crow erzählt von viel Zeit ohne Musik, vom Ausatmen und sich auf sich selbst Besinnen, bei dem eine fernöstliche Meditationsform eine entscheidende Rolle gespielt habe. Die Musik, die schließlich entstand, mußte die großen Veränderungen natürlich bezeugen. „Ich wollte eine Platte machen, die in die Tiefe geht, die von den Worten genauso wie von der Musik charakterisiert ist. Ich war in der Vergangenheit viel zu sehr auf Singles fixiert.“
Und so macht Crow just in dem Moment eine eher schwermütige, eingekehrte Platte, in dem sie so glücklich ist wie lange nicht mehr. „Wildflower“ leuchtet ins Innere, legt Wunden frei und zerrt ans Licht, was zuletzt unter den Teppich gekehrt war. „Für mich ist, Wildflower‘ eine hoffnungsvolle Platte“, wägt Crow ab, „natürlich geht es um Kämpfe und ungelöste Konflikte. Aber man kann diese Dinge ja nur bewältigen, wenn man sich ihnen stellt! Dieser Prozeß hat begonnen; für mich ist das eine gute Nachricht.“
Der neue Mut, sagt Crow, sollte sich auch in der Produktion widerspiegeln. „Ich wollte eine intime, direkte Atmosphäre, wie auf Neil Youngs ,Harvest‘.“ Jetzt muß man stutzen: Daß Crow „Harvest“ im Kopf hat und „Wildflower“ macht, auf der vieles unnötig opulent und nur weniges kammerklein ist, ist nun doch wieder ein Widerspruch.
Die Intimität, das ehrliche Gefühl, die Seelensuche, all das spielt sich bestimmt in Crows Kopf ab und steckt sowohl in den Songs als auch in den fragilen Gesängen. Daß dann aber am Pult ausgerechnet „C’mon C’mon „-Produzent John Shanks sitzt, der durch seine Arbeiten für Anastacia, Celine Dion und andere auf große Räume und pompöse, radiotaugliche Arrangements abonniert ist, heißt: Vor allem will Crow den Anschluß ans große Geschäft nicht verpassen und weiterhin gern vom massenhaften Publikum geliebt werden. Mit ein bißchen mehr Mut wäre „Wildflower“ aber vermutlich eine bessere Platte geworden.
„Ich habe ja versucht, John daran zu hindern, alles mit Overdubs voll zu machen“, verteidigt sich Crow mit einem Lächeln, „aber am Ende waren es dann doch ziemlich viele Streicher und Gitarrenspuren.“ Wie gesagt: Der Prozeß hat begonnen.