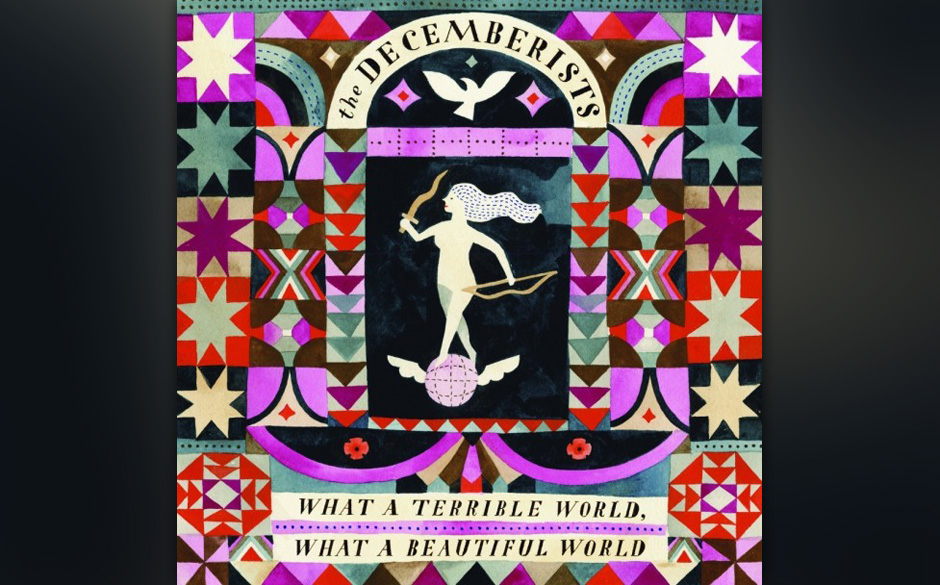The Decemberists – Knust, Hamburg
The Decembensts präsentieren historische Melancholie akademisch nüchtern

Wer weiß, wie lange sie das geprobt haben. Seit Siegfried & Roy, Christos Reichstagsverhüllung und der Mötley Crüe-Tour mit dem tanzenden Gnom weiß das Publikum, wie großes Pop-Theater aussehen muß. Und allein dieses Effekt-Kunststück, das die Decemberists hier aufführen, läßt die 400 Schaulustigen ungläubig stierend zurück. Es passiert bei „The Sporting Life“, dem gewaltig schunkelnden Lied, das davon erzählt, wie demütigend es ist, beim Football-Spiel hinzufallen: Sänger Colin Meloy hat seinen Tamburin-Teil beendet, holt aus, wirft den silbernen Kringel in die Luft, wo er sich dreht wie der Affen-Knochen bei Stanley Kubrick. Und Geigerin Rachel Blumberg… fängt das Tamburin auf. Mit einer Hand. Was soll danach noch kommen?
Im Ernst: Als die Leute im CD-Booklet des Albums „Picaresque“, das die Decemberists aus Portland im vergangenen Jahr etwas bekannter machte, die bunten Bilder sahen, auf denen die Mitglieder als historische Gestalten, Komödiencharaktere und, tja, Bäume posierten, da glaubten viele, man habe es mit einer klampfenden Amateur-Theatergruppe zu tun. Was bestens zur Musik gepaßt hätte, dem antiquierten Vokabular der Stanzen, dem Kleinkunst-haften dieses halbakustischen Pop. Tatsächlich sind die Decemberists auf der Bühne eine der am nachlässigsten gekleideten Bands, an die man sich erinnert. Der grobschlächtige Gitarrist Chris Funk wirkt in seiner braunen Jacke wie ein Buskartenkontrolleur, und Frontmann Colin Meloy (der dem Pop-Kritiker Diedrich Diederichsen verdächtig ähnlich sieht) hat sein weiß-blaugestreiftes Sakko sicher sehr kurz vor Ladenschluß gekauft. Kein Theater, nur ein kurzer Tamburinwurf, und der war wohl auch nicht geplant.
Daß hier Studenten für Studenten singen, der Eindruck bestätigt sich, aber es ist ja niemand da, den das stören würde. Die Band hat das Glück, sich den Europäern gleich mit den besten Liedern aus drei traumhaften Alben vorstellen zu können – kaum auszumalen, wie viele Blütenschock-Melodien man in anderthalb Stunden hineinkriegt, ältere Höhepunkte wie „The Legionnaire’s Lament“ und „Billy Liar“, neue wie „The Engine Driver“ und „We Both Go Down Together“. Akkordeonistin Jenny Conlee steht im Hintergrund, während Meloy das Risiko, hier könne alles zu süß und tränendrüsig werden, durch akademische Erläuterungen abfängt: „Wenn ich kurz zusammenfassen dürfte: Das eben war ein Geheimagenten-Drama, und jetzt kommt eine Gespenstergeschichte.“
Etwas Kasperletheater gibt es am Ende, wo sich im Saal eh schon alle betrunken in den Armen liegen, die Band Fragmente aus „Hava Nagila“ und „Rosamunde“ einbaut und der strenge Colin Meloy sich kurz vergißt und wie ein Känguruh über die Bühne hüpft. Beim epischen Seemannslied „The Mariner’s Revenge Song“ muß das Publikum schreien, als werde es vom Wal gefressen. Hätten die Pogues den Magister gemacht und Milch getrunken, so hätten sie geklungen. Die Decemberists haben gute Zähne: die allerbeste Weicheier-Band.