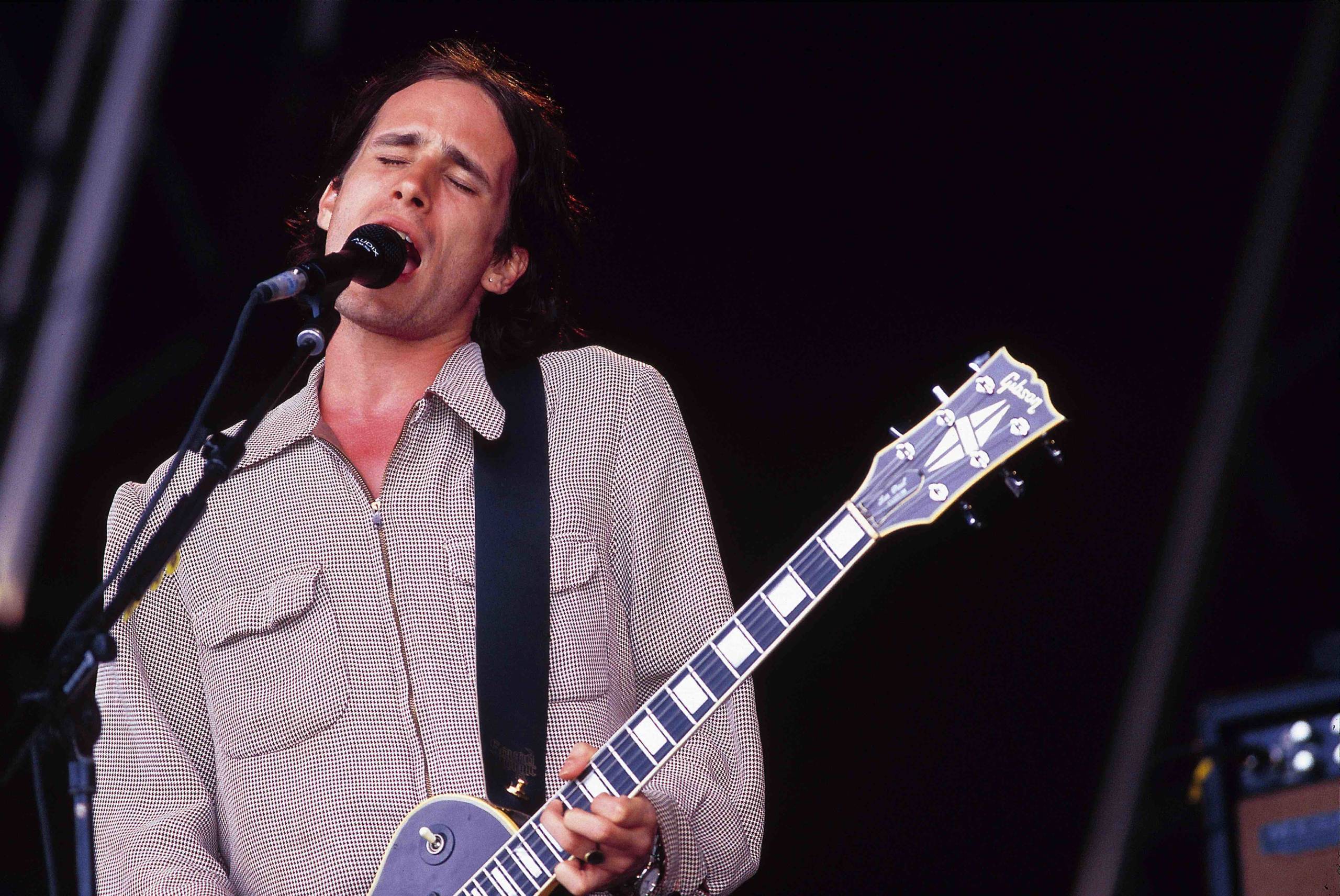„Süß singt der Engelschor“: Götz Alsmann über seine Leidenschaft für Weihnachtsschlager
Streifzug durchs Winterwunderland: Götz Alsmann über das Faszinosum Weihnachtsalben

Jeder kennt sie, die typischen bundesdeutschen Weihnachtslangspielplatten der Vergangenheit. Man betrat das Wohnzimmer, die Kerzen am Baum brannten, der Raum war erfüllt vom typischen Weihnachtsduft und Wunderkerzengeknatter, die Eltern standen erwartungsvoll und in Gönnerstimmung neben dem Christbaum, und vom Plattenspieler kam das alljährlich neu eingesetzte konfektionierte Festgeläut, dem sich nach etwa einer Minute ein von glockenreinen Knabenstimmen gesungenes Weihnachtslied anschloss.
Das Repertoire war vorgegeben: All die Lieder kamen zum Zuge, auf deren Interpretation man sich auch beim familiären Selbersingen einigen konnte. Bei der Gelegenheit stellte man immer wieder verblüfft fest, dass sämtliche Standardweihnachtslieder tatsächlich mehr als nur eine Strophe hatten. Fand sich auf so einem Album mal eine deutschsprachige Fassung von „Jingle Bells“ („Ringelding, ringelding, klingt’s im Winterwald“) oder gar „White Christmas“ („Süß singt der Engelschor“), galt das als fast schon frivoler Ausrutscher – schließlich waren das doch Ami-Nummern!
Weihnachtsschlager sind Ami-Sache
Genau. Denn sowohl das Verfassen als auch das Singen von Weihnachtsschlagern (eben nicht Weihnachtsliedern) war und ist seit Urzeiten eine amerikanische Spezialität, genauso wie das meisterliche Produzieren humorvoller Weihnachtsfilme. Beides konnte wohl nur einer Kultur entstammen, deren Auffassung vom Weihnachtsfest eher mit unserer Tradition der Silvesterparty vergleichbar ist.
Meine erste von mir selbst gekaufte Langspielplatte war ein solches amerikanisches Weihnachtsalbum. 1968, ich war elf Jahre alt, reichte ein mir von einem meiner Onkel beim jährlichen Familien- weihnachtsbankett zugesteckter 20-Mark-Schein zum Kauf eines Albums zum damals üblichen Einheitspreis von 19,80 DM.
Mir war von vornherein klar, dass es sich nur um eine Scheibe der Beach Boys handeln konnte, meiner damals unangefochtenen Lieblingsband. Die Kiste mit Beach-Boys-LPs im lokalen Radiogeschäft war rappelvoll. Es gab anscheinend unzählige Beach-Boys-LPs. Hunderte. Aus irgendeinem postweihnachtlichen Gefühlsimpuls heraus wählte ich das „Beach Boys’ Christmas Album“. Das Cover ließ keine Fragen offen, waren die fünf Strandbuben doch dabei zu sehen, wie sie den Weihnachtsbaum schmückten. Im vollen Bewusstsein, dass die Weihnachtszeit bald endgültig vorüber sein würde, gab ich meinen Zwanziger für dieses Saisonprodukt aus, radelte heim und legte die Scheibe umgehend auf.
Die erste Seite enthielt den typischen Beach-Boys-Sound, den ich so liebte. Da ich Quintaner mit Latein statt mit Englisch als erster Fremdsprache war (so was gab’s damals …), hatte ich keinen Schimmer vom in der Tat sehr weihnachtlich gestalteten Text-inhalt der flotten Beat-Nummern. Erst als ich das Album umdrehte, wurde mir klar, dass die brennende Aktualität des mir vorliegenden LP-Repertoires spätestens mit dem Dreikönigstag ein jähes Ende finden würde.
Beat, Easy-Listening und Humor
Alles dabei: „White Christmas“, „Blue Christmas“, „Santa Claus Is Comin’ To Town“ und „Frosty The Snowman“, Lieder, die man zur Vorweihnachtszeit häufig in anderen Versionen im Radio hören konnte. Die Sänger hießen dann Johnny Mathis, Nat King Cole, Mel Tormé, Dean Martin, Doris Day, Ella Fitzgerald, Perry Como und natürlich Bing Crosby. Jeder schien alles schon mal aufgenommen zu haben. Und jetzt auch noch die Beach Boys. Ich war begeistert! Und ich hörte das Album das ganze Jahr über! Die Beat-Seite laut und bei offenem Fenster in der stillen Hoffnung, dass niemand die Songs als Weihnachtsschlager identifizieren würde; die Easy-Listening-Seite eher diskret und unter hermetisch abgeriegelten Bedingungen. War doch irgendwie peinlich, das Ganze. Dachte ich damals. Denke ich heute nicht mehr.
Irgendwann begann ich mich in das amerikanische Weihnachtsplattenrepertoire hineinzuarbeiten und wurde nicht nur immer wieder verwöhnt durch exzellent gesungene und arrangierte Versionen des üblichen Repertoires, sondern vor allem immer wieder überrascht durch ganz besondere humorvolle Kabinettstückchen jener großen amerikanischen Interpreten:
[facebooklikebox titletext=’Folgt uns auf Facebook!‘]
• Nat King Cole, dessen „Christmas Song“ 1946 erstmals in den Hitparaden auftauchte und bis 1962 regelmäßig den Weg dorthin zurückfand, schenkte der Welt 1956 auch die hübsche Nummer „Mrs. Santa Claus“, in der er aufdeckt, wer eigentlich das ganze Jahr über die Arbeit macht.
• Charles Brown, der umsatzstärkste Blues-Sänger der Nachkriegszeit, der stilistisch eng mit Nat King Cole verwandt war und sich mit seinem Klassiker „Merry Christmas Baby“ von 1947 und diversen anderen Weihnachtssongs bis in die 60er-Jahre hinein den Titel des „Mr. Black Christmas“ sicherte.
• Dean Martin, der das Lichterfest mit seinem „Christmas Blues“ (1953) von der Warte des einsamen Spiegeltrinkers aus besang.
• Elvis Presley, der 1957 mit „Santa Claus Is Back In Town“ seine vielleicht intensivste Blues-Aufnahme vorlegte, begleitet von seiner, wie es damals üblich war, etwas hemdsärmelig aufspielenden Band.
• Bing Crosby, der mit „White Christmas“ (1942) einen 30-Millionen-Rekord aufstellte, den keine andere Weihnachtsplatte je wieder erreicht hat, aber vor allem mit „Mele Kalikimaka“ (1949) eine Koproduktion mit den göttlichen Andrews Sisters veröffentlichte, die hawaiianisches Flair unter den Weihnachtsbaum brachte.
Bing Crosby war der Wegbereiter
Und das sind nur ein paar der wirklich populären Interpreten. All die Hillbilly- und Blues-Sänger, die im Laufe der 40er- und 50er-Jahre den verschneiten Weg beschritten, den Bing Crosby freigeschaufelt hatte, all die Rock’n’Roll-Sänger und Doo-Wop-Gruppen, die sich wiederum am Liederbuch der Crosbys und Coles abarbeiteten: Sie alle sorgten im Laufe der 40er- , 50er- und 60er-Jahre für ein munter funktionierendes Subgenre amerikanischer Unterhaltungsmusik, dem eigentlich erst die Humorlosigkeit der Woodstock-Ära ein Ende bereitete. Versuche von Phil Spector oder Tamla-Motown, mit Weihnachtsalben aus ihren Hitfabriken frischen Wind ins Genre zu pusten, nehmen sich heute eher wie ein Abschied aus als wie ein Neuanfang.
Und bei uns? Da gibt es nicht viel, das den Vergleich mit Crosby und Como, Day und Brown aushielte. Gerhard Wendland und Peter Alexander haben in den 50er- und 60er-Jahren versucht, Weihnachtsschlager zu etablieren. Und danach?
Na ja, ich gebe mir alle Mühe.
(Götz Alsmann, ROLLING STONE 12/2015)