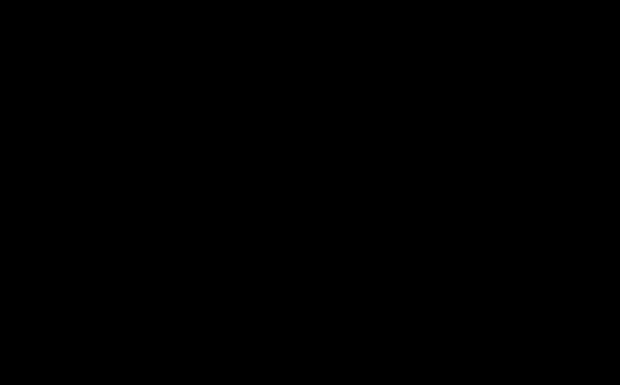Spotlight zur Selbsttherapie
Der britische Regisseur Stephen Frears hat mit dem US-Schauspieler John Cusack die Pop-Huldigung High Fidelity von Nick Hornby verfilmt

Entzückend sei es gewesen, so der jeder Ironie abholde UK-Regisseur Stephen Frears, „High Fidelity“ aus dem seines Erachtens bedrückenden London ins befreiende Chicago zu verlegen – „obwohl sie mich daheim dafür gewiss bespucken“. Auch Hauptdarstellerjohn Cusack, zudem Produzent und Co-Drehbuchautor, sei es „so was von schnuppe“, ob die Engländer den Export ihres geliebten Kulturgutes von Nick Hornby begrüßen werden.
Der Ton macht die Musik. Was sich zwangsläufig niederschlägt in einem Film, der dann auch um einiges muskulöser und koffeeinierter ist als seine mit Sentimentalität entwaffnende Vorlage. Doch wo die mit Lässigkeit verwechselte Kaltschnäuzigkeit der zwei von Disney finanzierten Adepten misstönt wie eine LP auf 45 Umdrehungen, kann man ihnen den standardisierten Vorwurf mangelnder Werktreue wahrlich nicht machen. Hornby hat seinen Segen erteilt. Welch Wunder: „High Fidelity“, the movie, ist „High Fidelity“, dem book of love, so sklavisch verhaftet, dass es auf der Leinwand mitunter wie bei einer Lesung zugeht – ermöglicht durch den immer riskanten, immer mutigen Dreh, eine Hauptfigur direkt in die Kamera sprechen zu lassen und damit die lichtspielerische Distanz zum Publikum aufzuheben. Dies lädt wütender zu Identifikation ein als Hornbys waidwunder Plauderton und will uns partout zu Verbündeten machen, wenn Rob (Cusack) ausholt zu Exkursen über Frauen, Musik und weniger relevante Dinge. All die besten Gedanken des Buches wurden ins Script gepaust. Was war zuerst da traurige Popsongs oder traurige junge Männer? Wie lange ist es statthaft, die Verflossene durchs Fenster mit ihrem neuen Stecher zu beobachten? Und vor allem: Kann man denn Frauen lieben, die Tina Turner hören?
„High Fidelity“ droht so häufig aber auch zu „Being John Cusack“ zu werden. Berichtet die Story mit Stoßseufzern in Richtung Vergangenheit vom verdutzten Erwachsenwerden, nutzt Cusack das Spotlight zu einer Selbstgesprächstherapie. Er kann – und will – nicht anders spielen als mit Intellektualität und mit Kinn voran. Doch so aufrecht das in anderen Filmen nachwirkt, so wenig passt es zu dem Platten-(laden)besitzer Rob, der als Buchfigur noch zu jeder Note seiner Sinnkrise einen Satz Selbstironie und zwei Scheite Charme parat hat. Cusack indes spielt mit Verbissenheit statt Verwirrtheit. Rar und wahr dagegen jener Moment, in dem Rob einem Paar nur beim Zärteln zusieht und er ohne Worte vermittelt, dass er bei aller Selbstverliebtheit doch ins Verliebtsein verschossen ist. Bis das Katalogisieren der Singles das Ordnen von Single-Gefühlen ersetzt Doch kaum kömmt der Film so zur Ruhe, wird wieder zum Amerikanisieren angehoben. Und obwohl Chicago den Stoffwechsel erstaunlich problemlos trägt, befremdet die Overstatement-Attitüde der alpha-males. Während die Frauen aus Robs Trennungs- und Trost-Galerie zu Stichwortgeberinnen reduziert sind, dürfen Jack Black und Todd Louiso als Robs kumpelige Mitarbeiter ungehemmt punkten. Lustig und szenenstehlend, ohne Frage, aber leicht landet ihre Laurel & Hardy-Routine manchmal jenseits der Grenze zur Karikatur. „High Fidelity“? Eher „Pump It Up“, um bei Costello zu bleiben.
Ob Engländer freilich einen besseren Film aus dem in seiner Anekdotenhaftigkeit schwer zu adaptierenden Buch gemacht hätten, bleibt Spekulation. Einen kauzigeren fraglos. Dafür hätten sie Bruce Springsteen als Boss höchstselbst schwerlich zu einem herrlichen Cameo bewegen können, in dem er Rob Rat in Herzensangelegenheiten gibt. Auch lässt die Popkultur-Quote von „High Fidelity“ jene Spezialisten nicht unbefriedigt, die ihre Platten selbstverständlich in Plastikfolien verwahren und von Frears „ungekrönte Könige“ genannt werden, „denen leider nur die Untertanen fehlen“. Mehr als 2000 Songs seien für den Soundtrack in die Auswahl geraten, erzählt Cusack, wobei persönliche Favoriten letztendlich den Ausschlag gegeben hätten. Da bekommen Belle & Sebastian einen wunderbaren name check und wurden von Dylan bis Velvet Underground nicht Gassenhauer verbraten, sondern Nuggets gehoben. „High Fidelity“ ist mit seiner Lust an Top-Five-Listen und Pop als Lebenselixier vor allem ein Fan-Film. Geben wir ihm daher sieben von zehn möglichen Bookmarks.