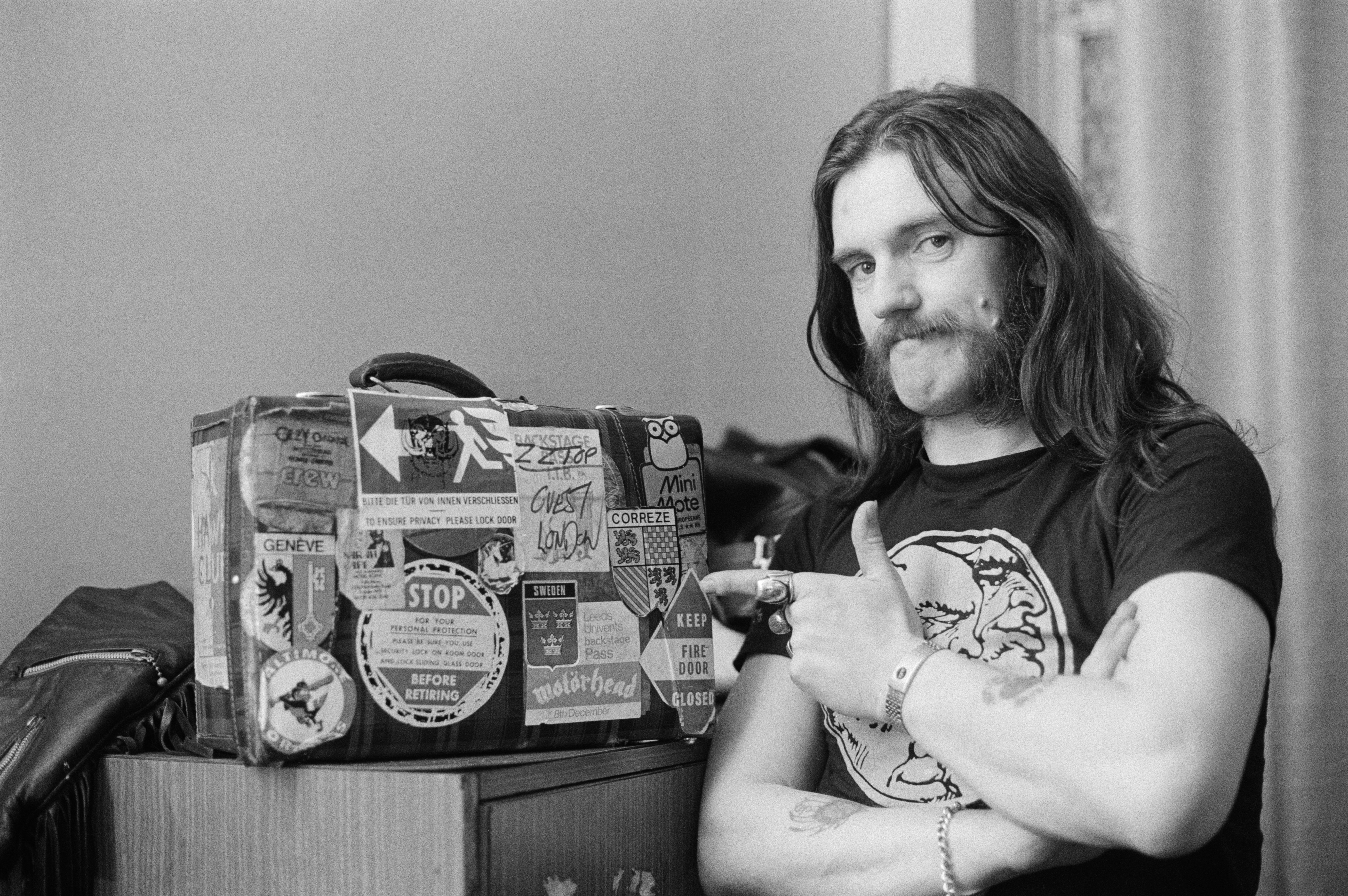SØREN ODER WIGGERL?

Welcher Philosoph gewinnt, wenn man ihn auf Koks und Ramazotti gegen einen irren Italiener verteidigen muss? Dieser wichtigen Frage geht ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer (unter anderem) in seinem Debütroman „Das Da-Da-Da-Sein“ nach. Eine Leseprobe.
An diesem Abend war das Flametti rappelvoll gewesen. Viele Filmleute waren da, die einige Straßen weiter einen dieser neuen bayerischen Heimatfilme zu Ende gedreht hatten. Die beiden hübschen Hauptdarstellerinnen standen rechts neben der Theke, waren aber so umlagert, dass man sie kaum sehen konnte. Ich setzte mich links von der Menschentraube auf den einzigen noch freien Barhocker und bestellte ein Helles. John kam aus der Küche, um mich zu begrüßen, und wendete sich danach an den Typen neben mir. Einen grau melierten, goldkettenbehangenen Mittvierziger im schwarzen Anzug. „Hey, Luigi!“
John stellte mir den Mann als den Italiener vor, der einige Jahre zuvor dem Sänger einer bekannten britischen Rockband in der Bar des Hotels Bayerischer Hof bei einer Schlägerei den Kiefer gebrochen hatte. Seitdem hatte er einen Platz in seinem – und nun irgendwie auch in meinem – Herzen. Nachdem John sich wieder in die Küche zurückgezogen hatte, begann Luigi, anscheinend unsicher, in welcher Sprache er mit einem Freund des ausschließlich Amerikanisch sprechenden John kommunizieren sollte, in einem stark italienisch gefärbten Mischmasch aus Englisch und Deutsch auf mich einzureden. Zunächst erzählte er von organisierten Schlägereien mit Skinheads in Hamburg und Berlin, an denen er in der letzten Woche teilgenommen hatte. Als er merkte, wie er ziemlich bald meine Aufmerksamkeit verlor und ich nur noch apathisch in mein Glas schaute, sah er mich mitleidsvoll an: „Blues, eh?“
„Yep“, sagte ich, „Blues.“
„Weißu, iké magé dik“, lamentierte er und zog ein kleines, durchsichtiges Briefchen mit einer weißen Substanz aus seiner Jacketttasche. „Nimme daaassé. Du bissé eine friend fromé Johnny, dasse gehté aufse ‚aus.“
Ich stutzte und wehrte zunächst ab. Doch als ich sah, wie sich Luigis Gesicht verfinsterte, streckte ich vorsichtig eine Hand nach dem Briefchen aus. Er legte es hinein und drückte meine Finger zu einer Faust. „Danke“, sagte ich, wand mich vom Barhocker und schlängelte mich durch den überfüllten Gastraum zur Toilette. Das Herrenklo war verschlossen, doch die Tür zu den Damen stand offen. Ich zwängte mich in die kleine Kabine, sperrte zu, leerte das Tütchen auf dem Klodeckel und schob den Stoff wie im Fernsehen, in Ermangelung einer Kreditkarte allerdings mit meiner Bahncard 50, zu zwei parallelen Linien. Auf der Suche nach einem Stück Papier oder einem Geldschein durchkramte ich meine Hosentaschen, fand aber nichts. Jemand ruckelte an der Tür: „Ey, Dünnpfiff oder was?“
Ich wurde panisch, kniete mich zitternd vor die Kloschüssel, ein Fabrikat der Firma Villeroy & Boch, und schniefte, so gut ich konnte, mit der Nase über die beiden Linien. Etwa die Hälfte des Pulvers blieb auf dem Deckel liegen. Ich schob es erneut zusammen, schniefte noch einmal. Den nicht unbeträchtlichen Rest wischte ich panisch mit der Handkante vom Deckel. Durch den Angstschweiß blieb einiges davon an mir kleben, ohne zu überlegen, leckte ich es ab. Meine Zunge, meine Lippen, meine Nase wurden mir gleich taub wie nach einer ungenau gesetzten Zahnanästhesie. Ich öffnete die Tür und schob mich an einer zeternden Frau vorbei zurück zur Theke.
„Geht’se bessé? Äverysssing okay?“, begrüßte mich Luigi gutgelaunt mit hochgezogenen Augenbrauen an der Bar und deutete amüsiert auf mein wohl immer noch weiß bestäubtes Riechorgan.
„Mhm“, murmelte ich und leerte ein Glas Ramazotti, das er für mich geordert hatte. Dann spürte ich, wie sich langsam meine Zunge lockerte, immer mehr Wörter drängten darauf, in den Raum entlassen zu werden. Ich begann auf Luigi einzureden, so wie er zuvor auf mich, erzählte ihm von Sarah und dass ich glaubte, sie habe einen anderen. Von meiner Hilflosigkeit und Verzweiflung.
„Veräzweifält? Eh? Bullshit!“, kommentierte Luigi.
„Bullshit? Nein, die Krankheit zum Tode.“
„Eh?“
„Verzweiflung ist die Krankheit zum Tode – Kierkegaard.“
„Kierä…? What the f… Bullshit! ‚ast du geläsen Wiettgänsteine, eh? Ii’s my man.“
Einen Philosophen hatte ich in Luigi nach dem bisherigen Verlauf des Abends nicht vermutet. Ich muss auch zugeben, dass ich ein kompletter Laie bin auf diesem Gebiet. In meiner Jugend hatten die Werke Thomas Bernhards eine gewisse Begeisterung für die Philosophie entfacht, aber das ist ja lange her. Heute reichen meine Kenntnisse in dieser Wissenschaft kaum über einige in Männerrunden hilfreiche Zitate von Schopenhauer und Weininger hinaus. Und ein paar Stichworte zu Kierkegaard waren mir nur eingefallen, weil ich zu der Zeit nachts kein Auge zutat und mich zum Zeitvertreib durch all die ungelesenen Bücher in meinem Regal blätterte. Eines davon war die mächtige Kierkegaard-Biografie von Joakim Garff, die mir ein Kollege – wegen meiner Liebe zu Kopenhagen – mal zum Geburtstag geschenkt hatte.
Ich hatte jedenfalls kein Interesse, mit Luigi in einen philosophischen Disput einzutreten und mich so zwangsläufig vollkommen lächerlich zu machen. Aber der Italiener war plötzlich wie aufgedreht und steigerte sich in eine überschäumende Erregung, die seine Aussprache nicht nur feuchter, sondern auch noch undeutlicher werden ließ. Immer wieder rief er zwischen all den – wie mir schien – frei von Grammatik und Bedeutung sprudelnden Lauten „Wiettgänsteine!“ und „Kierkägaarde!“ und „Bullshit!“, dazu delirierte er irgendwas von „denominazione“ und „metafisica“, während ich einen weiteren Ramazotti in mich hineinkippte, der Wirt das Glas wieder auffüllte, ich wieder trank, er wieder auffüllte und so weiter.
Manche seiner Laute schien Luigi nicht einfach an mich zu richten, sondern regelrecht auf mich abzuschießen. Nachdem ich mich an seine ramenternde Rhetorik gewöhnt hatte, begann ich langsam zu verstehen, was er mir sagen wollte: Ich sei es nicht wert, ein Mann genannt zu werden, wenn ich die christlich geprägte Existenzphilosophie des Dänen der unausweichlichen Logik seines geliebten Wieners vorzöge. Was ich ja nie behauptet hatte. Luigi verwendete in seiner – zumindest nach allem, was ich verstand – nicht ganz sauber geführten Argumentation die Kategorien „fucking sissy“ und „bloody Danish faggot“. Die mit zunehmender Wirkung der meinem Körper zugeführten Substanzen fahriger werdenden Versuche, ihn auf die Widersprüche innerhalb des Wittgenstein’schen Denkgebäudes, das mir ja eigentlich nahezu gänzlich unbekannt war, hinzuweisen und ihm zu erläutern, dass der Verfasser der Philosophischen Untersuchungen – oder wie ich ihn wohl nannte: der Wiggerl – seinen Kierkegaard durchaus studiert hatte, sich in seinen Tagebüchern sogar recht viele Spuren des großen Dänen fänden (das hatte ich mal in einer eher satirischen Abhandlung zu Wittgenstein und der Onanie gelesen, glaube ich), kommentierte er nur mit: „Bloody bullshit!“
Er zog ein rotes Notizheft mit einer bunten Clownszeichnung darauf aus der Innentasche seines Jacketts und schlug es vor mir auf. In der oberen Hälfte der ersten Seite stand in einer kindlichen Klaue mit Kuli gekrakelt: „Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig.“ Jedes Wort mehrfach und wohl mit großem Nachdruck unterstrichen, sodass sich das Papier ein bisschen wellte. In die Folgeseiten musste sich dieser Satz samt Unterstreichungen reliefartig eingegraben haben. Vielleicht sogar bis zum letzten Blatt. Von den Unterstreichungen gingen jeweils Pfeile ab, die zu anderen, offensichtlich italienischen Wörtern führten. Von „Denn“ zu „Infatti“, von „alles“ zu „ogni“, von „Geschehen“ zu „avvenire“, von „und“ zu „ed“, von „So“ zu „così“, von „Sein“ zu „essere“, von „ist“ zu „è“ und von „zufällig“ zu „accidentale“. Darunter, mit einer kleinen, vermutlich grammatikalisch bedingten Umstellung, noch einmal der ganze Satz. Mehrfach eingekreist. „Infatti ogni avvenire ed essere-così è accidentale.“ Darunter schließlich in Versalien der mit drei vor- und drei nachgestellten Ausrufezeichen versehene Vermerk „LUDWIG WITTGENSTEIN, 1889-1951“.
„Aha.“
„Kierkägaarde suckse! Dio suckse! Relijone suckse! Stick to … i fatti … the facts, vecchio amico!“
„Die Religion lehrt, die Seele könne bestehen, wenn der Leib zerfallen ist“, rezitierte ich einen der wenigen mir bekannten Wittgenstein-Sätze mit erhobenem Zeigefinger und – wie ich dachte – immer noch erstaunlich klarem Kopf und kippte einen weiteren Ramazotti in mich hinein. Luigi schaute mich mit durchdringendem Blick an, schüttelte den Kopf, seufzte, fuhr sich mit den Fingern durchs strähnige Haar, erhob sich von seinem Stuhl und wankte – auch er schien seine italienische Seele, an die er vermutlich nicht glaubte, ordentlich geölt zu haben – Richtung Herrenklo. Als er wesentlich standfester zurückkehrte, versuchte ich, das Gespräch auf ein weniger verfängliches Terrain zu lenken. Was er denn beruflich mache, wollte ich wissen.
„Me? I’m a pimpe.“
Ein der analytischen Philosophie zugetaner Zuhälter! Tränen schossen mir in die Augen.
„Mir ist eben auf der Toilette was eingefallen“, erklärte Luigi verschwörerisch und fast akzentfrei. „Wohnt ihr noch zusammen?“
„Wer?“
„Na, du und deine … eh … Signora, wer sonsté?“
„Ja. Klar. Aber sie ist an diesem Wochenende weggefahren zu …“
„Sì, sì. Wann kommpé sie zurucké?“
„Morgen Nacht oder so.“
„Senti! Ich gäbé dire eine offerta speciale … zu eine Freunschafspreise meine beste Pferdechene, und wenne Signora kommpé zurucké, danne lassté ihré es a letto so richtig bange bange. Fragore, eh! Tutto a posto? Ah … eh … gemahde Wiesn!“
Ich zweifelte, ob mich dieser italienische Machismo zum Ziel führen würde, aber da ich ahnte, wie sehr Luigi es hasste, wenn man seine Angebote ausschlug, fragte ich höflicherweise nach: „Freundschaftspreis? Wie viel?“
„Seicento Euro, für la notte, eh? Overnight. Die … eh … totale Nachté.“
„Sei… Sechshundert Euro? Und dasn Freundschaftspreis?“
„Sì.“
„Das ist nicht gerade ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann.“
„Hehehehe.“
„So viel hab ich nicht.“
„Zu vielé … eh … libri gekaufté, eh? Kierkägaarde, eh? Bullshit!“
In diesem Moment hörte ich eine vertraute Melodie, die – wie ich kurz darauf bemerkte – aus Luigis vor ihm auf der Theke liegenden, vibrierenden Mobiltelefon dudelte (vermutlich meldete sich ein Pferdchen zum Dienst). Das war ganz eindeutig Louis Armstrong, dessen Trompete mit der Klarinette von Johnny Dodds tanzte. Der Potato Head Blues! Meine gedrückte Stimmung war mit einem Mal wie – im mindestens zweitwahrsten Sinne des Wortes – weggeblasen. Der vertraute Klang versetzte mich in ein solches Hochgefühl, dass ich mich plötzlich fühlte, als lägen alle Trauer und alles Leid kilometerweit unter mir. Der „Potato Head Blues“! Auf dem Dach der Welt sitzend! Unglaublich! Sagt nicht Woody Allen am Ende von „Manhattan“ irgendwo, dieses Stück gehöre zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen? Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie er, ein kleines Mikrofon in der Hand, quasi zur Selbsttherapie auf einer Couch liegt und nach Gründen sucht, wegen denen es sich lohnt, zu leben. Der „Potato Head Blues“, da hatte er auf jeden Fall recht. Was war da noch? Ich konnte mich nicht erinnern und versuchte, die Schwarz-Weiß-Szene, die vor meinem inneren Auge flimmerte, mit meinen eigenen Gedanken zu synchronisieren.
Sicher, „All My Loving“ von den Beatles war ein weiterer Grund (auch wenn Allen das sicher anders sähe), Bachs Concerto für zwei Violinen und Orchester, Marcel Proust, die Erzählungen von Harold Brodkey, Charles Mingus, Eric Dolphy, wenn er die Bassklarinette spielte, natürlich Katja Riemann – Sarahs Gesicht, wenn ich ganz nah heranging und sie mit ihren großen Augen und ihrer putzigen Nase aussah wie eine kleine Cartoonfigur …
Ich bestellte einen Whisky zum Herunterspülen eines schweren Seufzers und, da ich zudem großen Durst verspürte, zusätzlich ein weiteres Bier. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich kippte den Whisky, ohne zu schlucken, hinein, leerte das Bier in wenigen Zügen und entschwand – keine Ahnung, ob ich vorher noch bezahlte – in die Nacht. Nach wenigen Schritten überkam mich ein Schwindelgefühl, und die Beine wurden mir weich. Ich klammerte mich an eine Straßenlaterne. Ein Weitergehen schien kaum möglich. Doch ich wollte verschwinden, bevor Luigi mich fand und mir ein weiteres seiner Angebote machte. Mein Herz pochte paranoid. Ein Taxi war nicht in Sicht.
Was dann passiert, was in der wichtigen SMS steht, die der Ich-Erzähler noch in derselben Nacht erhält, was das mit Blues und Matthias Rust zu tun hat und warum eine Begegnung auf einem westfälischen Friedhof so wichtig wird – das steht alles in „Das Da-Da-Da-Sein“ (Aufbau, 16,99 Euro) von Maik Brüggemeyer, der seit 2001 beim ROLLING STONE als Redakteur wirkt.