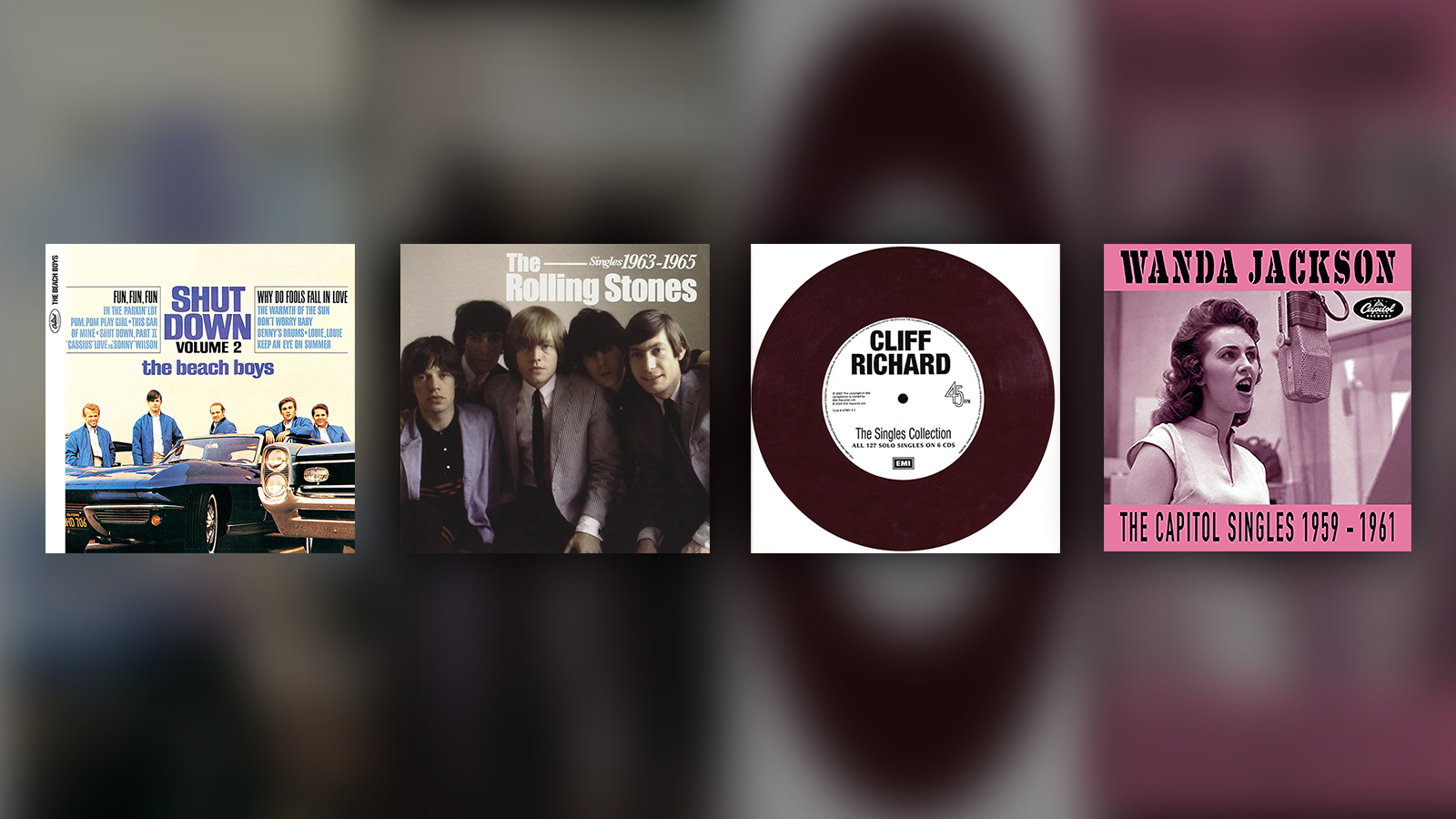Erinnerung an Scott Walker: Meister des Grotesken
Mit den Walker Brothers übte er sich in den 1960er-Jahren in Liedern mit orchestralem Schmiss und dunklem romantischen Geheimnis. Sein glorioses Spätwerk bestand aus zunehmend abstrakten Songs. Gedanken über den großen Scott Walker.

„Das Leben eines Menschen ist ein einziger Versuch, über die Umwege der Kunst wieder die wenigen Minuten wach werden zu lassen, in denen sich sein Herz zum ersten Mal öffnete“, hat der französische Philosoph Albert Camus mal geschrieben – und der amerikanische Sänger Scott Walker hat diese Zeilen 1969 auf eine seiner Plattenhüllen drucken lassen.
Eigentlich hieß der 1943 in Hamilton/Ohio geborene Sänger gar nicht Scott Walker, sondern Noel Scott Engel. Und schon in jungen Jahren, als er Sänger der existenzialistischen Boy-Band The Walker Brothers (Scott gab sich in Reklametexten als Camus-Leser und Fan von Robert Bresson und Ingmar Bergman zu erkennen) war, machte er seinem Geburtsnamen alle Ehre, inszenierte sich im zweiten US-Nummer-1-Hit des Trios 1966 als Engel der Apokalypse und sang „The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“, ein Lied, mit dem Frankie Valli von den Four Seasons zuvor gescheitert war. Die Walker Brothers sangen hauptsächlich die Lieder anderer – Burt Bacharach und Hal David, Bob Dylan, Randy Newman, Doc Pomus und Mort Shuman –, doch sie gaben ihnen nicht nur orchestralen Schmiss, sondern auch ein dunkles romantisches Geheimnis, und der Bariton Scott Walker ging für seine eigenen, fürs 60s-Pop-Ohr unheimliche Stücke wie „Archangel“ und Orpheus“ tief hinab in die Unterwelt.
Er sang zur Mittagszeit „My Death“
Vor allem in England liebte man die Walker Brothers, und ihr Fanclub soll größer gewesen sein als der der Beatles. Es war dann eine junge deutsche Frau, die im Playboy Club als Bunny arbeitete, die ihn mit den dramatischen Chansons von Jacques Brel bekannt machte. Während seine Mitstreiter Gary und John mehr Hits, Ruhm und Aufmerksamkeit wollten, wollte Scott dem großen belgischen Sänger nacheifern, und es kam zu Bruch. Seine ersten beiden Soloalben funktionierten noch nach einem ähnlichen Prinzip wie die Platten des Trios: ein paar eigene Lieder und viele Covers, allerdings wurde die Auswahl ein wenig eigenwilliger – Jacques Brel, Tim Hardin, André Previn. In der für ihr leichtes Entertainment geschätzten britischen Radiosendung „Billy Cotton Band Show“ sang er zur Mittagszeit „My Death“ – die von Mort Shuman übersetze englische Version von Brels „La Mort“.

Anfang 1969 war er auf dem Höhepunkt seines Ruhms, die BBC gab ihm eine eigene Fernsehshow und er veröffentlichte drei Alben. Für „Scott 3“ hatte er zehn der 13 Songs selbst geschrieben, „Scott: Scott Walker Sings Songs from his T.V. Series“ bestand aus Balladen und Standards, beide schafften es in die britischen Top 10. Sein dunkles Opus Magnum, „Scott 4“, das gänzlich aus eigenen Liedern über Tod und Teufel bestand und mit dem von Ingmar Bergman inspirierten „The Seventh Seal“ begann, erschien Ende des Jahres bezeichnenderweise unter seinem Geburtsnamen Noel Scott Engel – und ging vollkommen unter. Walker schien entmutigt, machte das halbherzige „‘Til The Band Comes In“ mit einer brillanten ersten und einer ziemlich mediokren zweiten Seite und gab sich danach künstlerisch auf, sang Filmsongs, Middle-of-the-Road-Pop und Country. Er selbst nannte diese Phase später seine „verlorenen Jahre“.
Oden an den Sadomasochismus
Es war ausgerechnet die eigentlich nur aus Geldnot eingegangene Reunion der Walker Brothers, die die künstlerische Wende brachte. Nach dem Charterfolg mit der Coverplatte „No Regrets“ von 1975 und dem Misserfolg des ähnlich konzipierten Nachfolgers, „Lines“, ein Jahr später, schien niemand mehr an das Trio zu glauben, am wenigsten das Trio selbst, und so teilten die Walker Brothers das letzte vertraglich zugesicherte Album brüderlich auf: John Maus/Walker durfte vier Lieder beisteuern, Gary Leeds/Walker zwei, und Scott Walker/Engel durfte das Album mit seinen vier Kompositionen eröffnen. Die alten Fans dürften ihren Ohren nicht getraut haben, als sie in die verstörenden, wohl von Brian Eno und David Bowie inspirierten, aber über sie hinausgehenden Klangwelten aus Synthesizern, Robert-Fripp-artigen Gitarren und treibenden Rhythmen geworfen wurden. Und Walkers wohliger Bariton war einem unheilvollen Tenor gewichen – der Höhepunkt war die sinfonische Ode an den Sadomasochismus, „The Electrician“.
„Wenn ich diesen Stil beschreiben müsste“, erinnerte Walker sich später, „würde ich sagen, es ist das akustische Äquivalent zu den Zeichnungen, die HR Giger für ,Alien‘ gemacht hat.“ Mit 35 Jahren hatte der ehemalige Popstar den Faden gefunden, der ihn aus dem Irrgarten seiner verlorenen Jahre zu seinem gloriosen Spätwerk führen würde. Es war ein langer Weg, den er zudem sehr langsam ging. Ein Album pro Jahrzehnt: „Climate Of Hunter“ (1984), „Tilt“ (1996), „The Drift” (2006), „Bish Bosch” (2012), daneben fantastische Soundtrack-Arbeiten zu „Pola X” von Léo Carax (1999) sowie Brady Corbets „The Childhood Of A Leader“ (2016) und „Vox Lux“ (2018), die Tanzmusik „And Who Shall Go to the Ball? And What Shall Go to the Ball?“ (2007) und nicht zuletzt “Soused” (2014), das gemeinsame Album mit der Drone-Metal-Band Sunn O))), eine dröhnende Höllenmusik mit Texten über Schuld und Perversion, Totalitarismus und biblische Kindesmorde, Sklaverei und (natürlich) Sado-Masochismus.

Walkers Songs wurden im Laufe seiner Karriere immer abstrakter, drehten sich um das Groteske und das Katastrophische. „Wir kommen meinen Charakter immer näher“, erklärte er mir zur Veröffentlichung von „Bish Bosch“ in London die Arbeit mit seinem treuen Produzenten Peter Walsh. „Man muss die richtigen Leute finden, um das umzusetzen. Auf den letzten drei Alben ist das sehr gut gelungen. Und wir haben uns in diesem Stil eingerichtet. Es ist ein bisschen wie der Spätstil von Beckett – all seine Stücke haben im Grunde die gleiche Atmosphäre, es gibt nur noch minimale Veränderungen.“
Eine Stunde lang sprachen wir über sein Werk, er wirkte gelöst, nahm sich selbst nicht sonderlich ernst, lachte viel und erklärte immer wieder, wie wichtig ihm in seiner Musik der Humor sei. Dass das nicht jedem offensichtlich war, sondern alle sich mit großer Ernsthaftigkeit an der Deutung seiner Werke versuchten, schien ihn ein bisschen zu verstören: „Das erinnert mich an Kafka, der seinen Freunden immer seine Geschichten vorgelesen hat, und wenn sie nicht gelacht haben, war er stinksauer. So fühle ich mich auch.“ Es war wohl der absurde Humor eines Camus-Lesers.