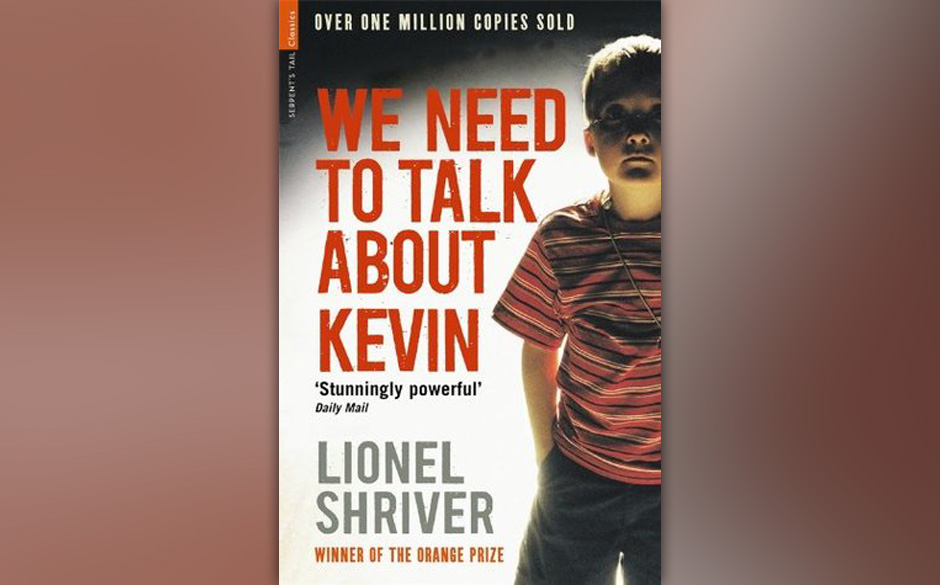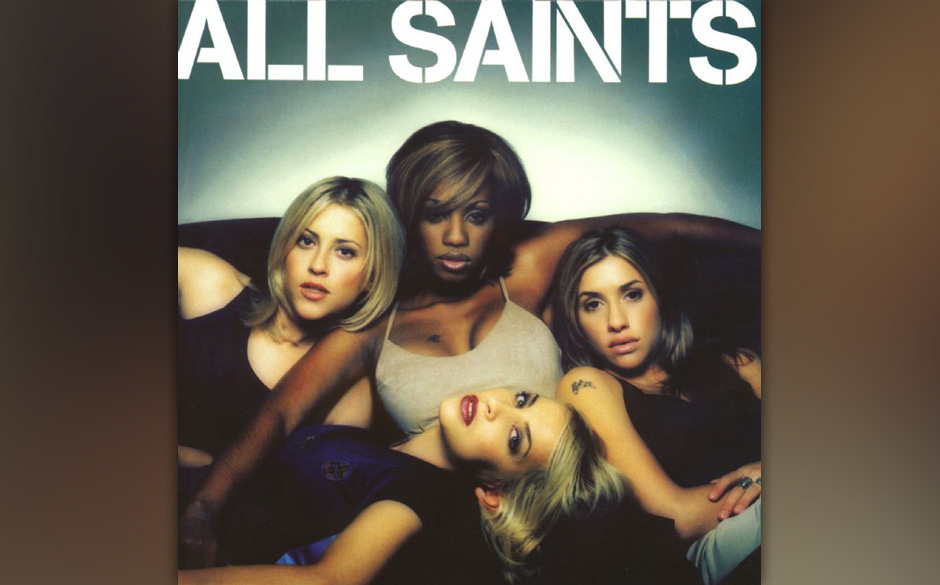ROLLING STONE wird 20. Unsere Helden, Teil 5: Antony Hegarty
Wir werden 20! Und starten mit einer Serie ins Jubiläumsjahr – über 20 Helden, die uns in den vergangenen 20 Jahren wichtig waren. Teil fünf: Antony Hegarty. Ein Porträt von Jens Balzer

Eigentlich hatte ich nicht die geringste Lust, dieses Konzert zu besuchen; ich möchte fast sagen: Widerwillen und Angst vor einem vergeudeten Abend beherrschten meine Gefühle auf dem Weg ins Berliner Schillertheater. Es war Mai 2003 und Lou Reed hatte sich samt Band und Gästen für einen Auftritt angekündigt. Gerade war sein bildungshuberisch-beknacktes Edgar-Allan-Poe-Gedenkalbum „The Raven“ erschienen; im Jahr zuvor hatte er, ebenfalls in Berlin, seine Feedbackorgie „Metal Machine Music“ in affig-unironischer Weise mit einem Neue-Musik-Streichorchester interpretiert. Wirklich schlimm! Aber dann – gab er an diesem Abend in diesem stillgelegten Theater im tiefen, unwirtlichen Westen der Hauptstadt das beste Lou-Reed-Konzert, das ich jemals gesehen habe: Minimalistisch, vital und schroff spielte er sich durch sein Repertoire. Und an der tollsten Stelle des Abends holte er eine schüchterne, blasse, kahlgeschorene Gestalt undefinierbaren Geschlechts in einem Jeansanzug auf die Bühne und ließ sie „Candy Says“ singen – aber wie! Wie herzzerreißend diese Gestalt extemporierte und sich mit dem ganzen Körper schmerzhaft verausgabte; wie glockenhell, fast countertenorhaft ihre Stimme klang: abgründig und erhebend zugleich. Antony hieß dieser Mädchenkerl aus New York, der an diesem Abend zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne zu sehen war. Bis dahin kannten ihn nur ein paar Abonnenten des obskuren, vom Current-93-Sänger David Tibet betriebenen Durtro-Labels: Hier hatte Antony 1998 sein Debüt, „Antony And The Johnsons“, herausgebracht. Laurie Anderson empfahl ihrem Gatten die Platte, Lou Reed holte Antony in seine Band – und verhalf ihm dann auch zu einem Vertrag für das zweite Album. Als „I Am A Bird Now“ 2005 erschien, stieg Antony fast über Nacht aus dem Halbdunkel der New Yorker Queer-Avantgarde ins helle Licht des massenbegeisternden Pop empor. Völlig zu Recht: So ernst und emphatisch, euphorisch und emanzipiert, so ergreifend und zugleich ungreifbar wie er hat im letzten Jahrzehnt sonst niemand geklungen. „So muss es gewesen sein“, hat Laurie Anderson sich später an ihre erste Begegnung mit seinem Gesang erinnert, „als man die Stimme von Elvis zum ersten Mal hörte.“
Cover 0
Rezensionen 3