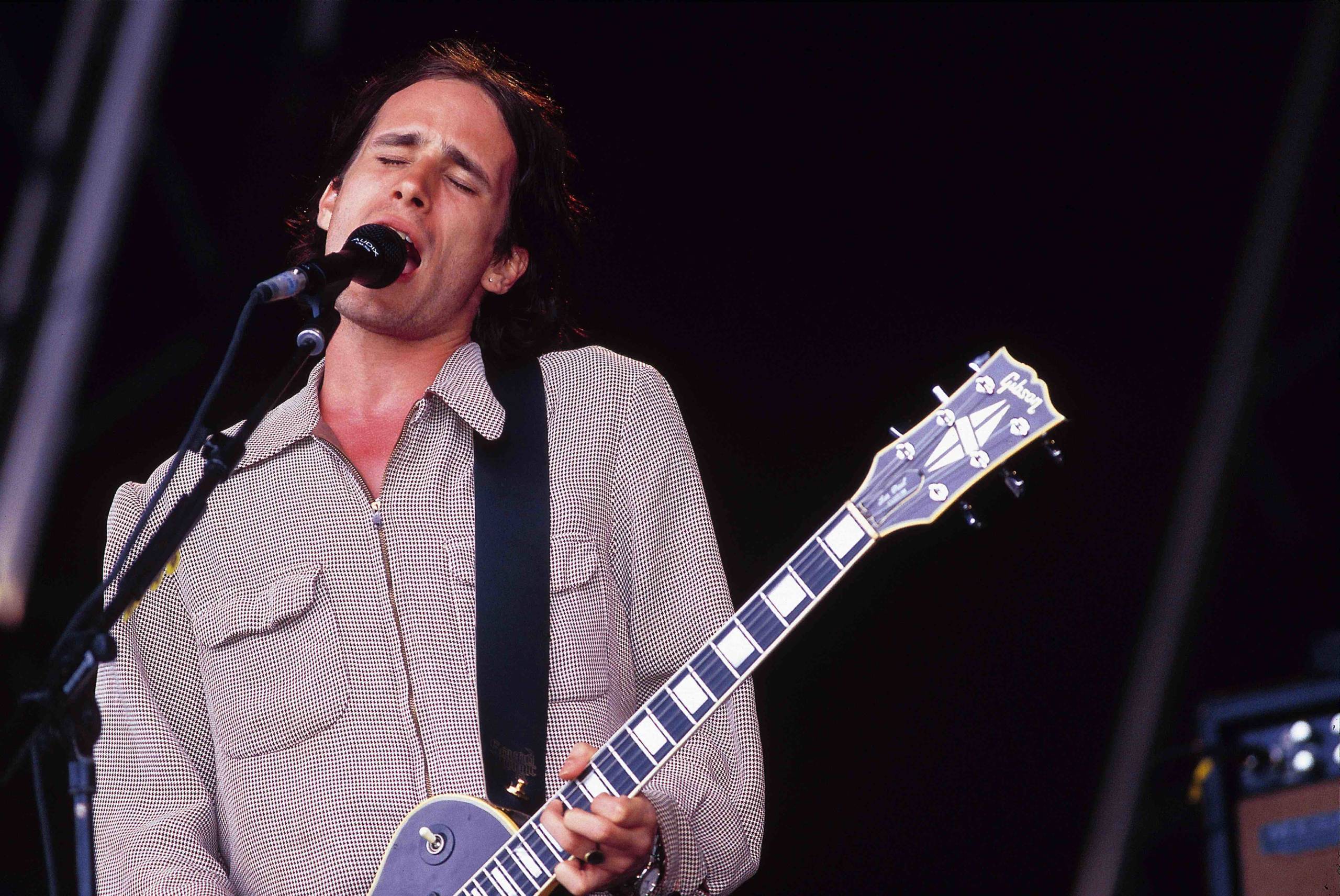Rock-Trottel, Pop-Päpste
Zwei neue Veröffentlichungen widmen sich dem deutschen Pop-Journalismus

Im Januar feiern die deutschen Feuilletons die Arctic Monkeys und Clap Your Hands Say Yeah. Alle schreiben, daß die Bands ihren rasanten Aufstieg dem Internet verdanken, daß sie ohne Plattenfirma groß wurden, daß die Musikindustrie mal wieder den Anschluß ans digitale Jetzt verpaßt hat. Alle verwenden das Wort „Hype“. Die Texte gleichen sich wie ein VW dem anderen, alle vom selben Band gerollt. Ironie der Geschichte: Der unique sales point beider Bands, die Story vom Selfmade-Erfolg via Internet, wurde den Schreiberlingen von genau jener Musikindustrie diktiert, über die sie dann gratis lästern. Nach den Graswurzel-Erfolgen hatten nämlich beide Bands Plattenfirmen und Promo-Agenturen beauftragt, um das Internet-Märchen in Umlauf zu bringen.
Im Februar stehen sie in den deutschen Charts. Was sagt uns das über den Zustand des Popjournalismus?
Seit geraumer Zeit dringt die Reservearmee der Niedriglohnvielschreiber aus der Musikpresse in die Feuilletons vor und deckt den Bedarf an treuherzigen Geschichten über die Band der Stunde. Nicht selten verkauft der Niedriglohnvielschreiber einer renommierten Tages- oder Wochenzeitung für besseres Geld die schlechtere Version eines Textes, dessen bessere Version er für schlechteres Geld an „Intro“, „Musikexpress“ oder „Spex“ verkauft. Kürzer, platter, schlechter ist die Feuilleton-Version, weil sie den Imperativen von easy reading, Formatierung und Serviceterror folgen muß. Danach darfst du beim general interest-Leser kein Vorwissen voraussetzen, darfst ihn nicht mit Namedropping belasten und mit Anglizismen verprellen. Und du darfst den Leser nicht duzen.
Sich über die genannten Verbote hinwegsetzen und über obskure japanische Avantgardisten schreiben – das darf im Feuilleton nur einer: „Das Sie muß ich aufgeben, lieber Leser, diese Musik tritt einem nahe, nicht wie andere Musik über Emotionen, sondern auf der körperlichen Hardware-Ebene duzt sie einen mit ihrem existenzialistischen Ehrgeiz.“ So schrieb Diedrich Diederichsen über Ryoji Ikeda, in seiner Kolumne „Musikzimmer‘ im Berliner „Tagesspiegel“. Das (Wieder-)Lesen dieser Kolumnen von 2000 bis 2004 lohnt sich schon für die Glücksmomente, die sich einstellen, wenn man klugen Leuten beim freien Denken zuschauen darf.
Daß Diederichsen schreiben darf, wie er will, verdankt er seiner Reputation. Als Autor/Redakteur von „Sounds“ und „Spex“ stiftete er zwei Genres: die vom großen Paradigmenwechsel Punk/New Wave angestoßene Schule des politischen Schreibens über Pop. Und das Diederichsen-Bashing. Wer sich mit den Großen anlegt, will selber ein bißchen wachsen. Jüngstes Beispiel für diesen negativen Opportunismus: Ulf „poshin‘ too hard“ Poschardt. Der garnierte eine Reihe notdürftig getarnter öffentlicher Bewerbungsschreiben für das Amt des Kulturministers in einer schwarzgelben Bundesregierung mit wohlfeilen Fouls gegen sein einstiges Idol: „Kunsttheorie-Professor“, „gealterte Linke“, „politische Oberlehrerei“. Er war mal Chefredakteur des „SZ-Magazins“, zuletzt schrieb er „Über Sportwagen“. Zeit, sich mal wieder zu melden. Wer Pop heute beim Wort nehme, trompetete er zur Bundestagswahl, müsse FDP wählen. Nach hals- und tabubrecherischen Thesen mit Irrsinnsfaktor lechzt das Feuilleton, und so räumten ihm rechte wie linke Blätter Seiten frei für seine Neue Deutsche Westerwelle. Am Ende mußten FDP und Poschardt draußen bleiben. Was gealterte Linke und politische Oberlehrer wie wir nicht ohne eine gewisse Schadenfreude zur Kenntnis nahmen.
„Man beginnt wieder Jahrestage im Leben von überschätzten Rocktrotteln zu begehen. Man ersetzt die naturgemäß schwierige uneingeführte Reflexion der Pop-Musik und ihrer Schauplätze durch das gute alte Beobachten von Künstlerlebensläufen. Zeitungskrise und ein kreuzelendes Rock-Revival vervollständigen den Niedergang der Option, in den großen Tageszeitungen eine Öffentlichkeit für Pop-Musik zu etablieren, die an die Stelle der im selbstgenügsamen Kräutergärten der Indie-Kultur langweilig gewordenen Pop-Presse hätte treten können.“ Die Diagnose stammt aus Diederichsens Vorwort zu „Musikzimmer“. Natürlich weiß er selbst, daß man solche Jahrestage braucht, um sich Reflexion von Pop leisten zu können, denn ohne so einen Anlaß druckt kein Feuilleton die schönste Reflexion. Vielleicht spart er sich das Relativieren, um in aller Drastik testzuhalten: Es sieht düster aus im Schreiben und (im Radio) Reden über Pop.
Zu ganz ähnlichen Befunden kommt die Sammlung „Popjournalismus“, was auch daran liegt, daß Diederichsen als most quoted man wie eine graue Eminenz über dem Buch schwebt. Früher nannten sie ihn huldvollspöttisch Pop-Papst, heute preisen die selben Typen auf kostbaren Kulturseiten die popistisch-philosophischen Qualitäten des Popen und finden’s ganz dufte, katholisch zu sein. Pop mit 40,50 noch politisch reflektieren? Das bekommen die allerwenigsten hin. Lieber altern sie in falschverstandener Würde und wenden sich den Rocktrotteln ihrer Jugend zu. Oder Gespensterdebatten über „neue Bürgerlichkeit“. Oder Ratzinger. Auch das gehört zum flächendeckenden neokonservativen Rollback im Spannungsfeld von Pop und Politik, den beide Bücher illustrieren. Gegenstrategien? Defensiv: Textlängen, Redezeiten und Sendeplätze, idiosynkratisches Schreiben und Relativsätze im Radio verteidigen…
Wie gründlich der Backlash durchgreift, das zeigt ein emphatischer Satz aus dem „Musikzimmer“: „Gegen Sting, Phil Collins und U2 sind wichtige Teile heute noch lebender Generationen für immer geimpft worden.“ Nicht alle. Gerade bekam Bono als Nachfolger von Gorbatschow und Clinton den auch aufmerksamkeitsökonomisch hochdotierten „Deutschen Medienpreis“. Die Laudatio hielt Joschka Fischer, der selbsternannte „letzte Rock’n’Roller der deutschen Politik.“ Rocktrottel unter sich. So sind die Verhältnisse, also hört auf den Oberlehrer: „Wenn man Nonkonformismus entwickelt, sollte man wenigstens wissen, was der aktuelle Konformismus geschlagen hat.“