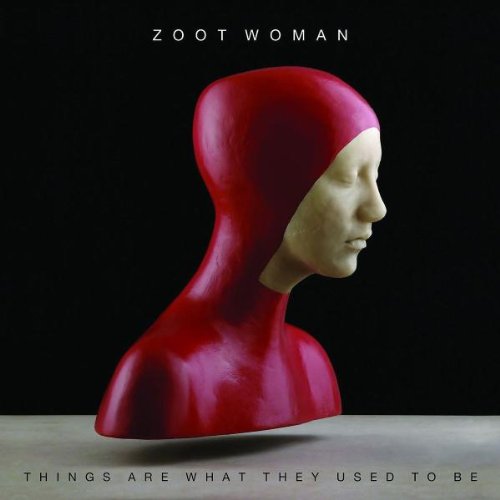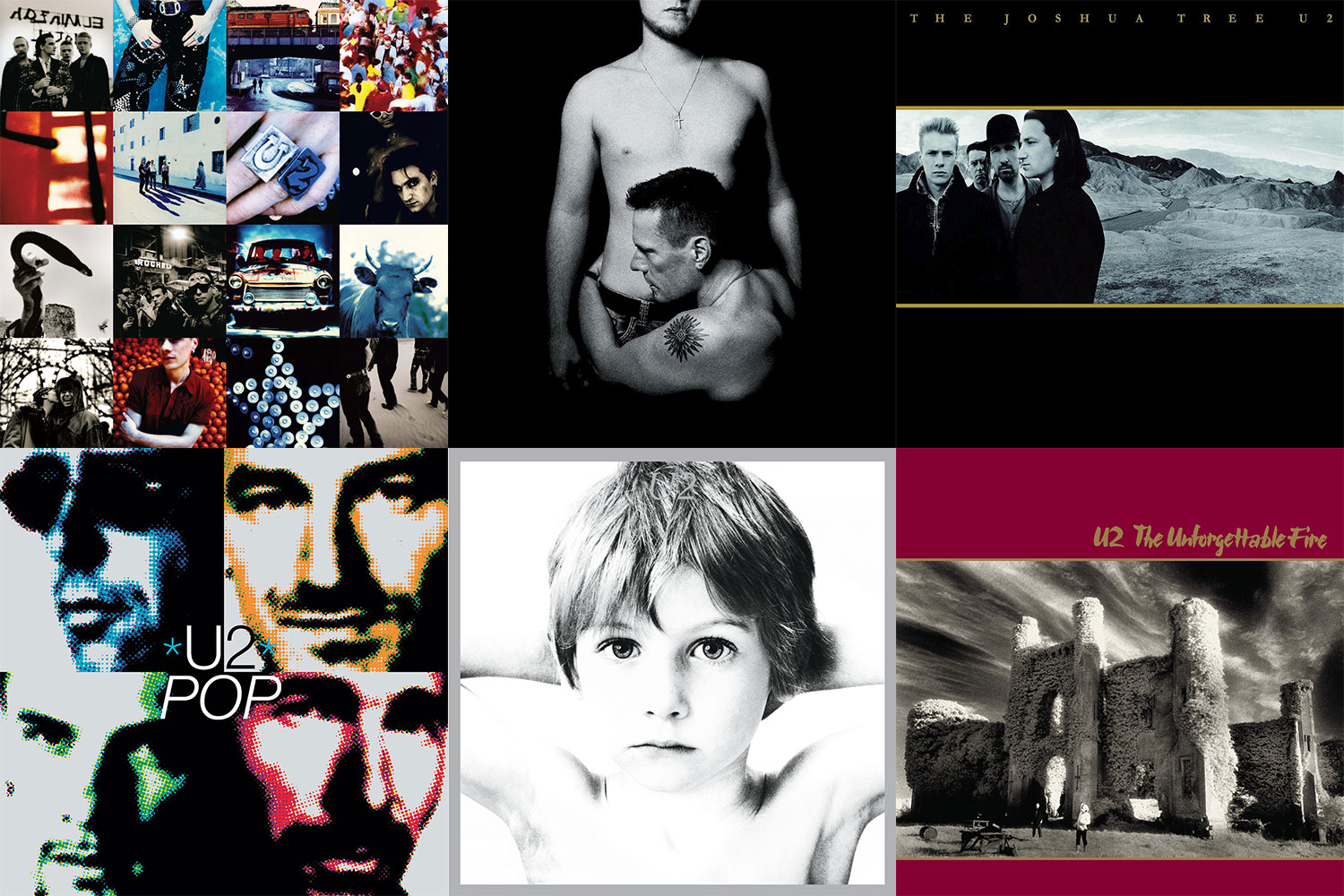Zoot Woman
Things Are What They Used To Be
Weil Stuart Price in den letzten Jahren vor allem damit beschäftig war, die Superstars des Pop aufzumischen, etwa Madonnas „Confessions On A Dancefloor“ oder „Day & Age“ von den Killers zu produzieren, hat er seine eigene Band etwas vernachlässigt. Sechs Jahre hat er gebraucht, um mit Zoot Woman ein neues Album hinzukriegen. Das Timing könnte aber kaum besser sein, platzt doch „Things Are What They Used To Be“ mitten rein in ein erneutes Revival des Eighties-Synthie-Pop.
Schon als 2001 das Zoot Woman-Debüt „Living In A Magazine“ erschien, arbeitete sich der Zeitgeist gerade an den 80er Jahren ab. Die Hochglanzoptik und die unterkühlte Sachlichkeit machten Zoot Woman damals zu einem Gesamtkunstwerk. Doch dem Titel des neuen Albums zum Trotz: Things aren’t what they used to be. Der narzistische Ennui-Ästhetizismus von früher ist der Tanzflächenbegeisterung und einer Affinität zu stampfenden Beats gewichen.
Zwischen den Bekenntnissen zum Gemeinsam-einsam-Sein wie im sanften „Lonely By Your Side“ und zum Alleine-einsam-Sein wie im aufgeregten „Memory“ tummeln sich ein bisschen zu oft die immergleichen Disco-Beats. Mal rumort ein wenig R&B durch die Tanzfläche wie bei „More Than Ever“, mal wird in „Saturation“ der Elektrobeat-Trance entdeckt. Auch Songs, die wie „Things Are What They Used To Be“ oder „Live In My Head“ spröde oder verspielt beginnen, drohen, sich in stupiden Synthie-Beats zu verirren.
Nur manchmal kann sich ein störrischer Groove wirklich durchsetzen: Das Beste an „Witness“ ist ein wunderbar unberechenbares Brummen, das sich durch die Nummer zieht. Auch das verschleppte „Lust Forever“ gerät etwas widerspenstiger. Schön, wie in „We Won’t Break“ ein fieszackiger Synthie-Loop mit einer hymnischen Gesangsmelodie konkurriert. Und in „Blue Sea“ tut sich ein Soundmeer mit sanft auf- und abtauchenden Harmonien vor einem auf. (Snowhite/Universal)