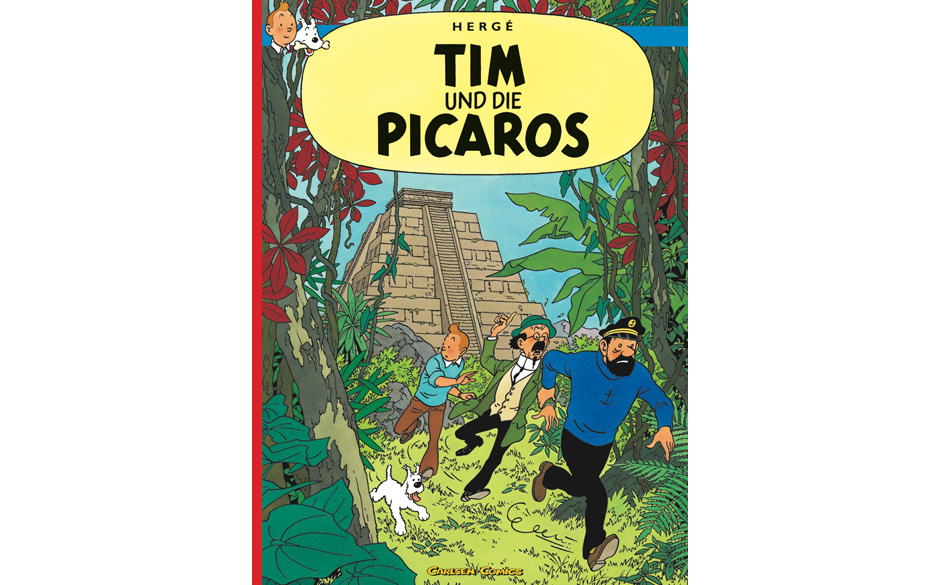Yeasayer
Amen & Goodbye
Das experimentelle Psychrock-Quartett bleibt vielschichtig
Was man dieser Band seit je zugutehalten muss: Sie klingt wie keine andere. Klar machen sich Einflüsse in ihrer Musik bemerkbar, von futuristischem R&B bis zu Afrobeat und Weltmusik, von den Harmoniegesängen der Beach Boys bis zu Ambientklängen, Psychedelic Rock und Funk. Und doch hört sich das alles an, als käme es aus ferner Zukunft. Das ist auch auf dem vierten Album so, das im Gegensatz zum digital nervenaufreibenden Vorgänger, „Fragrant World“, in den Catskill Mountains auf Tape aufgenommen wurde, um anschließend von Atoms-For-Peace-Drummer Joey Waronker dekonstruiert und neu zusammengebastelt zu werden.
Man muss aber nicht Jacques Derrida gelesen (oder gar verstanden) haben, um an „Amen & Goodbye“ Gefallen zu finden. Es handelt sich dabei eher um ein Kunstwerk, das an die Prämisse des legendären chilenischen Regisseurs Alejandro Jodorowsky erinnert, dass ein Film nicht den Effekt psychedelischer Drogen abbilden, sondern die Pille selbst sein muss. Werfen wir uns also „Amen & Goodbye“ unter ärztlicher Aufsicht ein – und siehe da: Popmusik kann tatsächlich noch irritierend, ergreifend und bewusstseinserweiternd sein, ohne
in übereifriges Prog-Gegniedel, prätentiöses Gefrickel oder Gefühlsduselei abzudriften. Das liegt zum einen an den beseelten Stimmen von Chris Keating und Anand Wilder, zum anderen aber auch daran, wie Yeasayer den schmalen Grat zwischen Kunstanspruch und Pop-
Appeal meistern.
Trotz des soundtechnisch verspielten Detailreichtums treten Melodie und Rhythmus nie in den Hintergrund, was unmittelbar eingängige Songs wie „Silly Me“, „Prophecy Gun“ und das ausnahmsweise von einer Gitarre dominierte „Cold Night“ beweisen. Die Atmosphäre wirkt zudem lichter und versöhnlicher als zuletzt, obwohl es inhaltlich um Fragen nach den letzten Dingen geht. Dafür hat sich der Abstand zum Dancefloor merklich vergrößert. Aber wer will schon tanzen, wenn er surrealen Klangvisionen nachhängen kann?