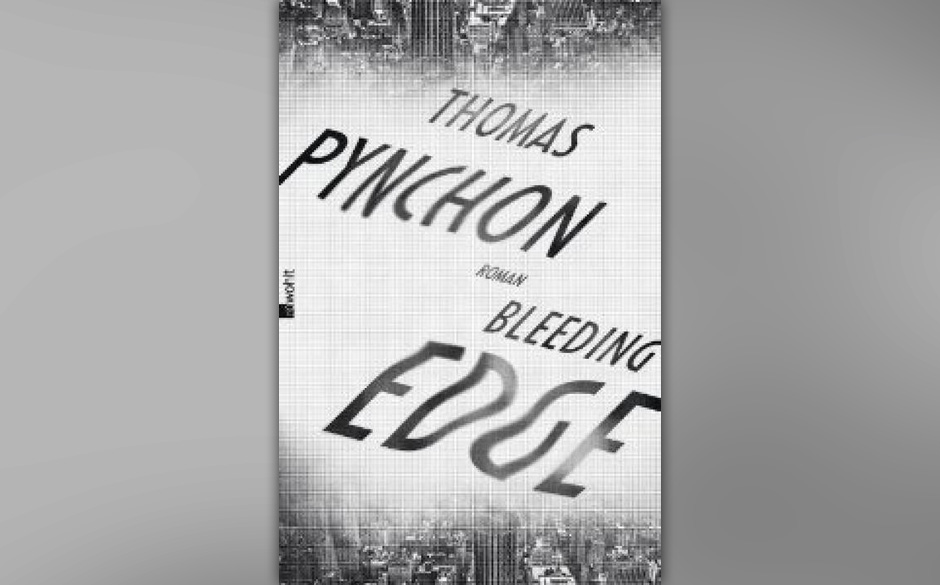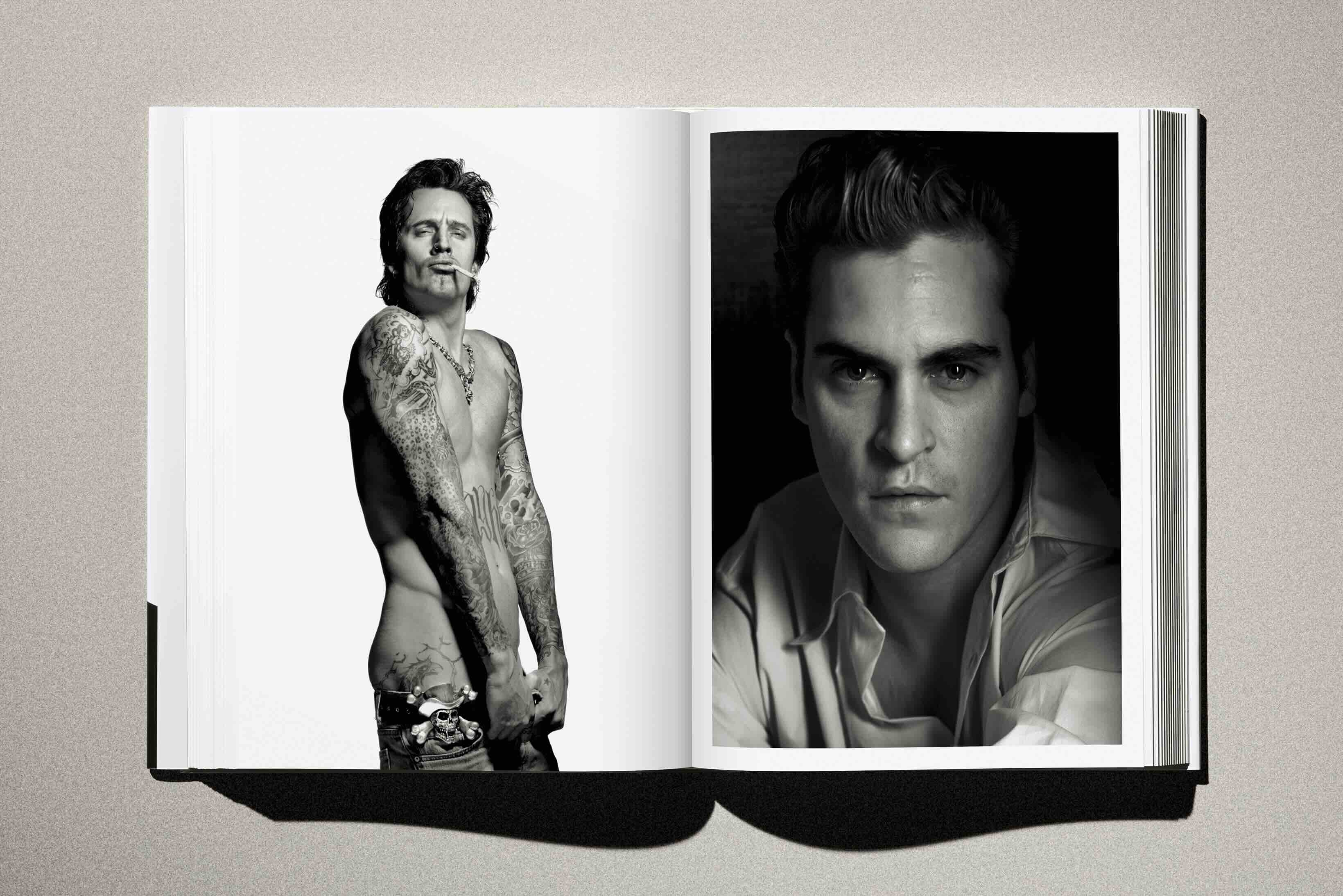Tipp: Thomas Pynchon :: Bleeding Edge

Thomas Pynchon ist 77 Jahre alt. Wenn man das nicht wüsste und seine früheren Romane nicht kennen würde, dann müsste man bei der Lektüre von „Bleeding Edge“ denken, dass ein junger Autor der Generation Dotcom den großen, irrwitzigen, funkelnden, sprachgewaltigen, vor Informationen und Abschweifungen berstenden, ironischen, slapstickhaften Roman über seine Zeit geschrieben hat, einen Internet-Schwank, eine Persiflage auf eine Detektivgeschichte, einen New-Economy-Thriller, eine New-York-Schnitzeljagd – eine wunderbare Satire, die in die Manierismen der Trivialliteratur gekleidet ist.
Vor einigen Jahren noch hätte man diesen Roman „postmodern“ genannt, doch der Begriff ist mittlerweile obsolet, obwohl die biedermeierlichsten Scharteken und spießigsten Erbauungsschmöker die Bestseller-Listen der Online-Shops füllen und kein Schriftsteller es versäumt, vom Ende der Welt, wie wir sie kannten, zu künden, von den Gefahren des Internets, der sozialen Netzwerke, von Google und Facebook als totalitären Systemen. Thomas Pynchon ist kein Bedenkenträger, er war es nie – denn er wusste es. Schon sein Roman „V“ von 1963 war eine gewaltige Verschwörungstheorie, ein Netz aus Absurditäten, abstrusen Ereignissen, skurrilem Personal, Nebenschauplätzen und Abschweifungen, dazu Wissenschaftssprache und Jargons, Parodien literarischer Schreibweisen und historische Exkurse. Die Hippies hätten ihn lieben müssen, aber sie verstanden nicht, was dieser Roman bedeuten sollten. Pynchon liebte jedoch die Hippies und die Popkultur: Zwar verschwand er aus der Öffentlichkeit – doch beobachtete er im Refugium die gegenkulturelle Revolution. „Die Versteigerung von No. 49“ (1966) ist ein Schelmenstück, in dem fiktive Popsongs die Handlung unterbrechen, weil plötzlich jemand zu singen anfängt, und später war „Vineland“ (1990) eine Hommage an jene verpeilten Gestalten und das Laissez-faire, die auch in „The Big Lebowski“ gefeiert werden. Bei den „Simpsons“ wird Thomas Pynchon als Säulenheiliger verehrt – ein unsichtbarer Popstar, von dem vermutet wird, dass er in New York lebt. Sein letzter Roman, „Natürliche Mängel“, ein Detektiv-Pastiche, wird gerade von Paul Thomas Anderson verfilmt.
Thomas Pynchon ist also ein Heutiger, neben dem die jüngeren Autoren alt aussehen. „Bleeding Edge“ handelt vom 11. September 2001, indem es nicht davon handelt: Die Detektivin Maxine Tarnow, Leiterin der Agentur „Tail ’Em And Nail ’Em“, erhält von dem Dokumentarfilmer Reg Despard den Auftrag, die Computer-Sicherheitsfirma hashlingerz.com zu überprüfen, von der mysteriöse Geldströme auf eine tote Website und zu arabischen Verbindungen abgezweigt werden. Von dieser Stelle an ist es unmöglich, den Plot nachzuerzählen, in dem unter anderem auftreten: Maxines Ex-Ehemann Horst Loeffler, ihre Kinder Ziggy und Otis, ihre Freundinnen Vyrva McElmo und Heidi Czornak, der Dotcom-Milliardär Gabriel Ice, der Lobbyist Nicholas Windust, ein Investor namens Rocky Slagiatt, die Webloggerin March Kelleher, ein russischer Krimineller, der butterfettreiche, ungesunde Eiscreme verkauft, eine „freelance professional nose“ mit hoch entwickeltem Geruchssinn, hwgaahwgh.com (Hey, We’ve Got Some Awesome and Hip Graphics, Here), Promis (Prosecutor’s Management Information System), AMBOPEDIA (American Borderline Personality Disorder System), der Mossad, die Russen, die Tschetschenen etc. pp.
Mit jugendlicher Begeisterung umkreist Pynchon all die Bizarrerien der schönen neuen Welt, erzählt nebenbei kleine Kulturgeschichten, erklärt die Otto-Kugelblitz-Schule, streift das Dakota Building, vor dem dem John Lennon erschossen wurde, nimmt die U-Bahn von der 1. bis zur 59. Straße, fährt in einem Schnellboot nach New Jersey und lässt die Figuren seitenlang plaudern, Stevie Nicks’ „Landslide“, Jamiroquai und Madonna hören und kommentiert als launiger, nonchalanter Erzähler: „Already, wie es bei den Eagles heißt, gone.“ Eine Website heißt „Klatsch der Verdammten“. In die steinerweichenden Dialoge schmuggelt der Erzähler erbärmliche Spruchweisheiten: „Paranoia ist der Knoblauch in der Küche des Lebens – man kann nie genug davon haben.“ Falls jemand von den Wirren des Plots davongetragen wurde, erinnert der Autor daran, dass es sich hier um Fiktion handelt: „Ja, sie weiß, dass es in DeepArcher keine Auferstehungen gibt, danke für den Hinweis.“
Der 11. September passiert, der Erzähler hält kaum inne, das Leben geht weiter. „Seit Neuestem gibt es eine Extrakontrolle, ein Artefakt des 11. September, und dort entdeckt man in einer von Conklings Innentaschen den möglicherweise historischen Flakon 4711. Man hört erregtes Deutsch, bewaffnetes Sicherheitspersonal zweier Länder nimmt sich der Verdächtigen an. Hoppla, fällt es Maxine ein, wie war das noch mit den Flüssigkeiten, die man nicht an Bord eines Flugzeugs bringen darf …“
„Bleeding Edge“ erschien im vergangenen Herbst in den USA. Wikileaks, Edward Snowden, NSA, Bundesnachrichtendienst – das alles schwingt in Pynchons Groteske mit, die Weltgeschichte nicht als Tragödie, sondern als Farce. Je mehr Zeit vergeht, desto rätselhafter werden die Ereignisse, und desto unerbittlicher schrumpfen die individuellen Erfahrungen zu Schicksalen und Anekdoten: Die Attacken der V2-Rakete auf London, die Exkursionen der Landvermesser Mason und Dixon, die Kolonialherrschaft in Südafrika – Pynchon betrachtet Geschichte als das volatile Spielmaterial eines Gottes mit grimmigem Humor. Er ist kein moralischer Schriftsteller.
Thomas Pynchon will die Welt nicht verändern – er beschreibt sie, staunend und lustvoll, als unbegreifliches Mysterium. (Rowohlt, 29,95 Euro)