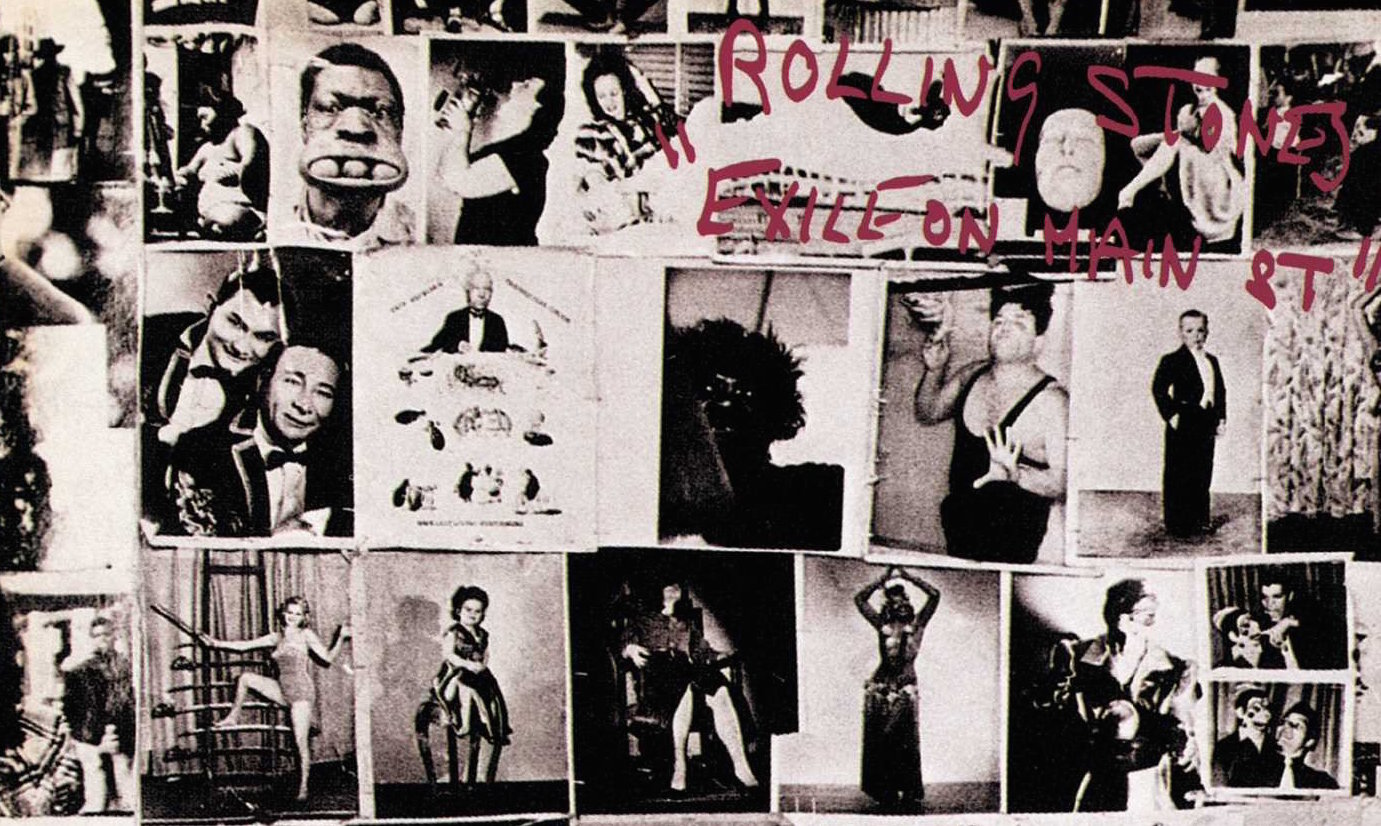The Cure
Faith
Auf „Faith“ ließen die zum Trio geschrumpften The Cure eine monochromatische Grau-in-Grau-Welt erklingen, in der die Zeit zu gefrieren scheint. Vor allem durch die kompakte Besetzung Smith, Gallup, Tolhurst ist „Faith“ eine der überzeugendsten Platten der Band. Zum 35. Jubiläum.

Robert Smith war in den frühen Achtzigern ein rastloser Geist, dessen kreative Entwicklung rasant voranschritt. Allein zwischen 1979 und 1982 veröffentlichten The Cure vier Alben, dazu hochkarätige Singles wie „Boy‘s Don‘t Cry“ oder „Charlotte Sometimes“. „Faith“, im April 1981 erschienen, war die bis dahin ambitionierteste Platte der Band, schuf sie doch im Vergleich zu den Vorgängern „Three Imaginary Boys“ und dem bereits atmosphärisch verdichteten „Seventeen Seconds“ eine gänzliche neue Songarchitektur.
„Faith“ ist ein geradezu symphonischer Entwurf aus melancholischen Synthieflächen und nebligen Melodien. Die Atmosphäre, so viel suggeriert schon das farbentleerte Cover, ist trist. Smith hatte während der Aufnahmen mit Rückschlägen und Todesfällen in seinem persönlichen Umfeld zu kämpfen und war, wie er in einem Interview einst erzählte, auf existenzieller Sinnsuche. Er habe mehrfach auf Tour Kirchen aufgesucht, sei aber immer mit dem Gefühl der inneren Leere wieder hinausgegangen. „I went away alone, with nothing left but faith“ wiederholt er in „Faith“ mit bleicher Stimme. Es liegt eine Decke der Freudlosigkeit über diesen sakralen Songs, die auch von Desillusionierung und dem Ende der Unschuld handeln: „Sleeping children in their blue soft rooms still dream“. Diese Welt schien jetzt unerreichbar fern.
Frostige Dramaturgien
Mehr und mehr entfernten sich The Cure auch von klassischen Songstrukturen. Die Intros überschreiten, wie bei „All Cats Are Grey“, die Zwei-Minuten-Grenze, zum Ende hin mäandert der Song ins Nirgendwo. Im Titelsong „Faith“ wird eine frostige Dramaturgie bis zur Monotonie gedehnt und verlangsamt. Mit dem Drei-Minuten-Gitarrenpop der Anfangstage von „Three Imaginary Boys“, gerade eben zwei Jahre her, hatte all das schon nichts mehr zu tun. Auf „Faith“ geht es nicht um Katharsis oder Elektrisierung, sondern um langsame Steigerung, um die sukzessive Intensivierung von Stimmungen, bis diese sich im Hall auflösen und alles wieder stillsteht.
Von Smiths Interesse am Krautrock zeugt auch der knapp 30-minütige Soundtrack zu „Carnage Visors“, den die Band damals als Opener vor ihren Konzerten zu einem animierten Kurzfilm von Simon Gallup spielte. Das Instrumental ist ein bewusst unverdauliches Traktat, das immer wieder kurz eine Eruption andeutet, die doch niemals kommt, und dadurch eine bedrohliche Spannung aufrechterhält. Es war der Versuch, eine repetitive Struktur, wie sie etwa die Musik von NEU! gekennzeichnet hat – von Musikjournalisten mit dem schönen Begriff „Motorik“ bedacht – für die Vertonung freudloser Stimmungsbilder zu benutzen.
Dass „Faith“ nicht in einem ermüdenden Ambient-See versinkt, vielmehr stellenweise energisch daherkommt, liegt in erster Linie daran, dass die Platte vom kompaktesten und vitalsten Lineup eingespielt wurde, das in der von wechselnden Besetzungen durchzogenen Karriere dieser Band zu finden ist. Nach dem Ausstieg des Keyboarders Matthieu Hartley, der die Aufnahmen und Tour zu „Seventeen Seconds“ begleitet hatte, schrumpfte die Band zum Trio Robert Smith, Simon Gallup und Laurence Tolhurst.
Von klassischen Rock-Hierarchien befreit
Eine glückliche Fügung: Auf wenigen Platten hört man eine derart ausgewogene, von klassischen Rock-Hierarchien im Klangbild befreite Instrumentierung, wie auf „Faith“. Smiths Gitarre weicht hier von Ihrer dominanten Rolle ab, und ist eher impressionistisches Stimmungselement, während das Schlagzeugspiel von Laurence Tolhurst das Rückrad der Musik bildet, mal minimalistisch, mal virtuos. Dass Simon Gallup als einer der wenigen Bassisten mit einer markanten Signatur im Gedächtnis bleibt, liegt zum einem großen Teil an seinem Beitrag zu den „Faith“-Songs. Allen internen Problemen der zum Trotz entwickelte die Band auf „Faith“ eine souveräne Musikalität.
Hört man sich die Demos der Songs an, von denen einige auf der Wiederveröffentlichung von 2005 zu finden sind, zeigt sich auch der weite Weg, den die Band dabei gegangen ist. Dass zwischen diesen Versionen und den fertigen Songs auf der Platte Welten liegen, macht deutlich, was für ein unnachgiebiger Perfektionist Robert Smith bei aller demonstrativ zur Schau gestellten Tristesse war. Mit dem Endergebnis war er dennoch nicht so recht zufrieden: „At the time I wasn‘t really sure we‘d made it quite right. It probably wasn‘t as extreme as I‘d hoped it would be and I felt we‘d maybe pulled back from the edge too soon“, sagte er dazu mal.
„At the time I wasn‘t really sure we‘d made it quite right“
Und trotzdem: Der Vorwurf des Selbstmitleids und der lähmenden Trostlosigkeit, der The Cure für die Dauer ihrer gesamten Karriere begleiten sollte, war auch nach der Veröffentlichung von „Faith“ laut zu hören, obwohl die Platte gemessen an den Verkaufszahlen die bis dato erfolgreichste der Band war. Der NME schrieb, das Album biete „absolutely nothing meaningful in a fairly depressing way“, andere Musikpublikationen attestierten Variationsarmut sowie schwaches Songwriting.
Endzeitstimmung trifft auf Hollywood-Melodram
Und ja, wer wie The Cure auf „Faith“ die große Geste und das Pathos sucht, der nimmt in Kauf, sich angreifbar zu machen. Wenn sich bei „The Funeral Party“, dem besten Song der Platte, die Synthesizer mit majestätischer Eleganz erheben, Robert Smith einen traurigen Walzer vorführt, in die Menge starrt, und mit flehentlicher Stimme „I watched and acted wordlessly as piece by piece you performed your story“ vorträgt, dann entfalten sich vor dem inneren Auge Cinemascope-Bilder. Hier trifft gespenstische Endzeitstimmung auf den Schmacht eines Hollywood-Melodrams der 1950er.
Wenn viele damals darin Kitsch oder Bedeutungslosigkeit gesehen haben, dann bestimmt auch deshalb, weil bei The Cure oft mit dem Maß der Wahrhaftigkeit gemessen wurde – was eine höchst manieristische Inszenierung war. Jene fand auf der 1982 erschienenen LP „Pornography“ in der Kombination aus Lebensverneinungsversen und infernalischem Hall ihren Höhepunkt. Aus dieser vielleicht besten Platte von The Cure sprechen mit kühler Präzision orchestrierte Schockeffekte, die an die Aussage von Smiths Kollegin Siouxsie Sioux denken lassen, die einmal sagte, Ihre Band Siouxsie and the Banshees solle klingen wie eine musikalische Entsprechung zur berühmten Dusch-Szene in Alfred Hitchcocks „Psycho“.
Später war es dann auch die immer üppigere Kostümierung, die signalisierte, dass The Cure Ihre eigene Welt kreierten, statt die alltägliche abzubilden. Bei den Kritikern gingen Smith und Co. damit – und mit den immer eklektischeren Platten – regelmäßig baden, ihr Kultstatus aber wuchs weiter. The Cure waren immer schon eine Publikums- und keine Kritikerband. Subjektiv empfundene Tristesse zu transzendieren war dabei immer das Projekt der Gruppe – das ist ihnen selten besser gelungen als auf „Faith“.