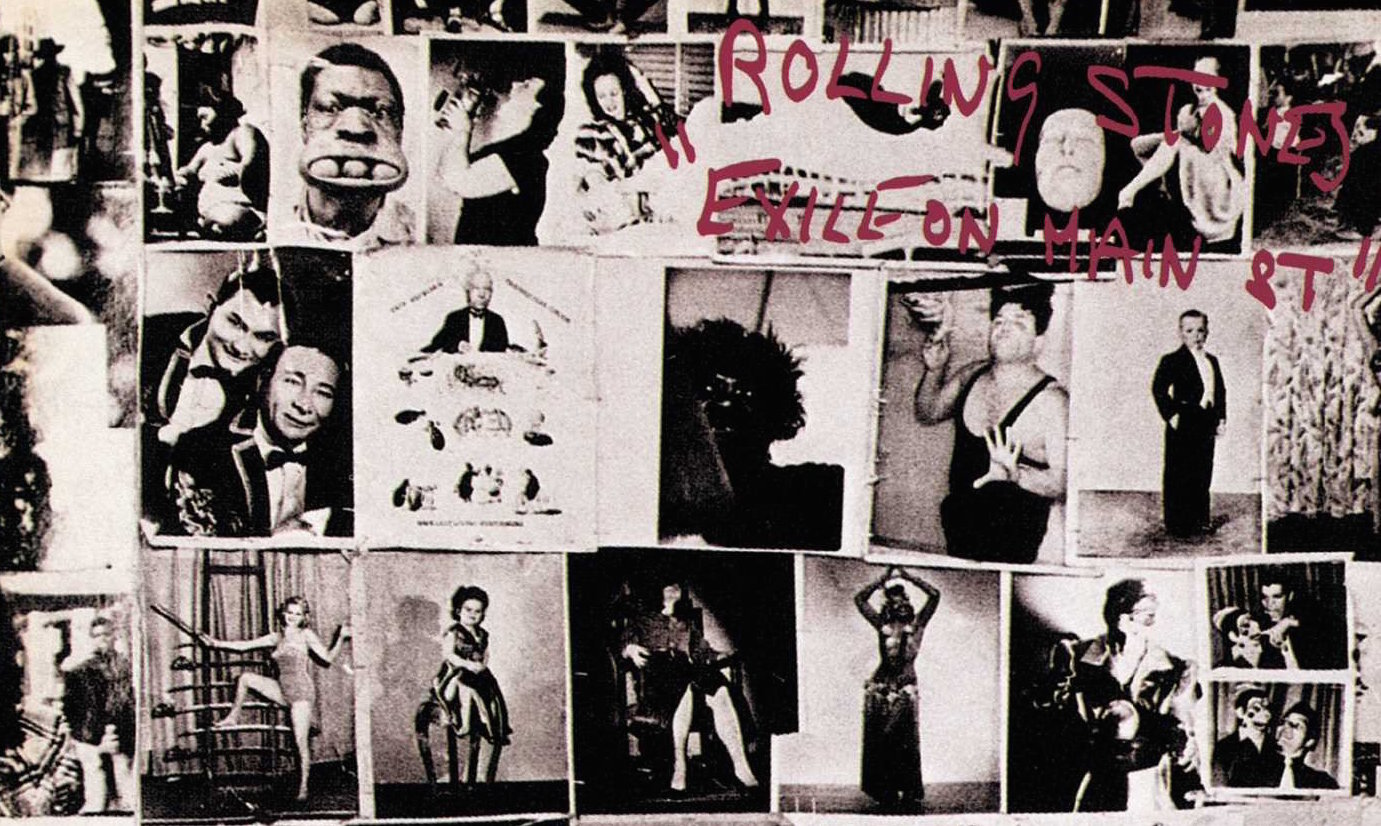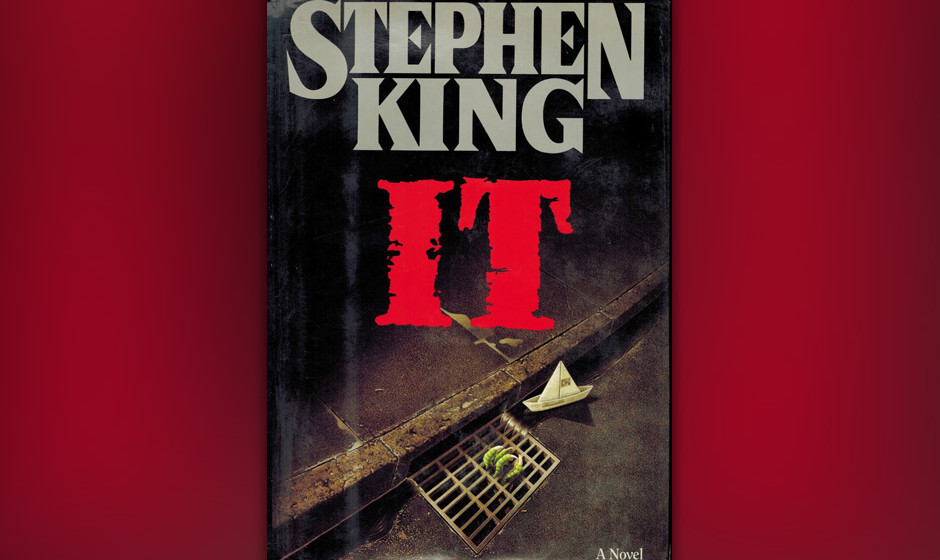Gareth Edwards :: Star Wars: Rogue One
„Viele Rebellen sind gestorben um uns diese Pläne zu bringen“, hieß es in früheren "Star Wars"-Filmen – wohl war. Regisseur Gareth Edwards inszeniert den „Krieg der Sterne“ erstmals als das, was es ist: ein Kriegsfilm, mit hoher Opferzahl.

Welche und wie viele Szenen Gareth Edwards neu drehen oder nachdrehen musste, wird wohl niemals bekannt werden, aber die Sorgen innerhalb der „Star Wars“-Gemeinde waren groß, dass der 41-Jährige der Aufgabe, einen „Krieg der Sterne“ zu drehen, nicht gewachsen war. Das Ergebnis ist umso größer – „Rogue One“ vermischt Fantasy mit den Kriegsfilm-Genre, ist brutal, ohne dabei blutig zu sein.
Eine gelungene Erweiterung des Star-Wars-Kosmos. 8 Gründe, weshalb der neue „Krieg der Sterne“ so schnell nicht vergessen werden wird.
Dieser Text enthält Spoiler.
1. Ben Mendelsohn und Mads Mikkelsen

In der TV-Serie „Bloodline“ stahl Ben Mendelsohn als vernachlässigter Sohn bereits allen die Schau, im Gefängnisdrama „Starred Up“ war er als vernachlässigender Vater der Beste. Hier spielt Mendelsohn einen Waffenentwickler, und die Entscheidung ihn zu engagieren bestätigt das gute Händchen der Produzenten von Disney; die hatten bereits mit Adam Drivers Figur des Kylo Ren („Das Erwachen der Macht“) einen stimmungsschwankenden, überzeugenden Charakter auf die Leinwand gebracht. Mendelsohns Direktor Krennic dominiert seine Co-Darsteller, man darf sich über jeden seiner Auftritte freuen. Als er längst am Boden liegt, erhält der Böse seinen letzten tragischen Moment. Er muss mitansehen, wie seine Erfindung dem eigenen Leben ein Ende bereiten wird.
Mendelsohn und auch Mads Mikkelsen (in der Rolle des Todesstern-Ingenieurs Galen Erso) sind Star-Wars-Zugewinne aus dem „Charakter-Fach“. Darsteller mit sonst vom Fantasy-Film abweichendem Portfolio, die hier dennoch spielerisch agieren, nicht versuchen ihren tragischen Rollen eine Shakespeare-Schwermütigkeit zu verleihen. Daran war ja das Zöpfchen-Duo Liam Neeson/Ewan McGregor in „Die Dunkle Bedrohung“ (1999) gescheitert, die beiden traten damals wie im Theater auf.
Mikkelsen steht auch im Zentrum einer Sequenz, die verstört, weil sie Familienwärme in imperialem Umfeld zeigt. Ersos mittlerweile erwachsene Tochter Jyn (Felicity Jones) erinnert sich an einen Moment in der Kindheit, als ihr Vater sie zurück ins Bett trägt – sie war aufgewacht, weil die Todesstern-Generäle zu laut feierten.

2. School of 1977: Darth Vader und Grand Moff Tarkin

Zunächst wirkt der digital erzeugte Peter Cushing – der britische Schauspieler starb 1994 – lediglich wie ein gelungenes Nice-To-Have moderner Effekteküche. Es ist auch das erste Mal, dass Filmschaffende ihre seit 20 Jahren im Raum schwebende Drohung, Tote auf der Leinwand abendfüllend zum Leben zu erwecken, wahr gemacht haben. Der berüchtigte Uncanny-Valley-Effekt, unter dem CGI-Charaktere mit wie tot wirkenden Augen leiden, ist hier selten zu spüren.
Später wird klar, dass Cushings Figur des Grand Moff Tarkin hier dazu dient, die Hierarchie zum Untergebenen Krennic (Mendelsohn) zu verdeutlichen, denn beide erhoffen sich vom Erfolg des „Projekt Todesstern“ die eigene Existenzsicherung. Tatsächlich enthielt der erste „Krieg der Sterne“-Film, „Eine neue Hoffnung“ von 1977, noch keine Verweise auf Tarkins Motivation. Hier wird er zum größten Hai im Haifischbecken.
Der kleine Lord

Auch Darth Vader erhält zwei Szenen, die pointierte Verhaltensweisen präsentieren: Rangniedrigere fertigmachen, kämpfen. Bei unserer ersten Begegnung mit ihm trifft Krennic (Mendelsohn) auf den Sith Lord in einer irgendwie prächtig und irgendwie gleichzeitig karg wirkenden Höhle (vielleicht basierend auf der „Erwachen der Macht“-Idee, Vaders Schloss, also den „Wohnsitz“ zu zeigen, der monumental, aber leblos wirkt). Dort lässt der „Vadder“ es sich gut gehen, schöpft Power aus seinem Milichbad, und die Lava-Flüsse im Schloss relektieren rot in seinem Helm. Einem Sonnenbrand gleich ist das Rot auf dem Helm auch noch in der zweiten Sequenz mit ihm zu sehen, als er sich längst wieder im All befindet.
Wie „ME.Movies“-Kollege Daniel Krüger treffend anmerkte, hat Vader zunächst einen etwas holprigen Auftritt. Die im vollen Licht gezeigte Rüstung wirkt in ihrer Kantigkeit etwas aus der Zeit gefallen, geradezu Shrek-cartoonesk ist der riesige Schatten, den Vader zunächst wirft – und aus dem er in realiter deutlich kleiner heraustritt. Es ist Ben Mendelsohn, der die Dominanz des Lords verdeutlicht. Wir lesen es in seinem verschwitzten Gesicht ab, dessen Muskeln wie Wellen schwingen.
Natürlich kann Vader, es gibt etliche Parodien davon im Netz, auch nicht von seinem Tick lassen: Zwei Finger in der Luft zusammendrücken, die Macht demonstrieren, Krennic die Luft damit abschnüren. Die Fans wollen so eine Vader-Szene, klar! Als der Sith seinen Waffen-Offizier stehen lässt, weicht er ihm übrigens um Millimeter aus, die Schultern treffen sich nicht; eine schöne Regie-Entscheidung, denn ein Rempler wäre eines Vaders nicht angemessen gewesen.
3. Der erste „Star Wars“ ohne Lauftext

Eine mutige, aber richtige Entscheidung den berühmten Lauftext, der in sieben Filmen von oben nach unten wandert und eine Vorgeschichte erzählt, wegzulassen. Das Intro verlieh den Werken stets eine gewisse Gravitas, eine zeremonielle, mit märchenhaften Zuschreibungen versehene Spannung („böses Imperium“, die „guten Rebellen“ usw.), die die darauf folgenden Anfänge mancher Episoden (I, II) nie aufrechterhalten konnten.
Gleichzeitig wird dem Zuschauer in „Rogue One“ eben nicht das Vorwissen geschenkt, welche Konflikte die Figuren werden austragen müssen. Der Beginn ist ein kalter Schock: „Rogue One“ startet unvermittelt mit der Landung imperialer Truppen, wir sehen Soldaten in schwarzer Rüstung, im Regen – bäm!
4. Authentisch wirkende Kriegsschauplätze, die an reale Schlachtfelder erinnern

Spätestens mit Clint Eastwoods „American Sniper“ hat sich die Figur des zweifelnden Scharfschützen etabliert, in „Rogue One“ übernimmt diese Rolle jener Rebell Cassian Andor (Diego Luna), der sein durchs grüne Nachtvisier angepeiltes Opfer nicht erschießen will. Während sich die Geek-Welt seit 40 Jahren über die Frage, „Wer schoss zuerst – Han oder Greedo?“ den Kopf zerbricht, ist Cassian der echte Antiheld. Zu Beginn von „Rogue One“ trifft er die Entscheidung, einen nicht feindlich gesinnten Informanten nach Überbringung der Nachricht hinterrücks zu erschießen.
Schlechtwetterlagen
„Rogue One“ sowie der im vergangenen Jahr angelaufene „The Force Awakens“ sind die ersten Filme der Reihe seit „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ von 1983, deren Actionszenen mit Stuntmännern in überschaubaren Flächen deutlich besser funktionieren als die Raumschiffkämpfe im All. Die wirken im CGI-Alter stets etwas unplastisch und sind zu schnell inszeniert, außerdem kennt der Weltraum halt weniger Dreck und Grautöne.
So viele Schlechtwetterlagen wie in „Rogue One“ gab es im „Star Wars“-Universum noch nie. Regisseur Gareth Edwards versteht sich – unter den jüngeren Sci-Fi-Filmemachern sonst nur wie Neill Blomkamp („District 9“) – auf ein gegerbt dargestelltes Produktionsdesign, mit verschrammten Puppen, Mechanik, Körperarbeit, wenig sichtbaren computergenerierten Effekte.

Als der Todesstern im „Krieg der Sterne“ 1977 den ersten Planeten mit seinem Laserstrahl zerstörte, sahen wir eine zerberstende Kugel, aus der viel Glitzerschnee fliegt (die Spezialeffekte waren damals noch nicht so weit). Der Todesstern von 2016 sendet Energie aus, die in ihrer Inszenierung einer Atombombe gleicht: Kettenraktion, Feuerball und Druckwelle. Es ist eine Waffe, über die alle „SW“-Geeks seit je her fantasierten, deren Zerstörungspotential aber hier erstmals zu erkennen ist. Hier sehen Sterbende am Strand den Tsunami auf sich zukommen.
Wo sind die Laserschwerter
„Apocalypse Now“ mit seiner Darstellung des Vietnam-Kriegs wird zitiert, aber es gibt auch eine Szene, die reale Bilder aus dem zerbombten Nahen Osten ins Gedächtnis rufen. Sturmtruppen eskortieren einen Panzer in den Ruinen einer Wüstenstadt, in ihrer Vermummung arabisch anmutende Rebellen greifen die Regierungstruppen an. Es sind nur Interpretationen, gleichzeitig aber hat sich bislang kein „Krieg der Sterne“-Film an derartigen aktuelle Allegorien versucht. In „The Force Awakens“ war es der Flammenwerfer, der für die besonders brutale, „Star Wars“-untypische Waffe stand, hier sind es Granaten.
Es ist auch der erste „Krieg der Sterne“-Film, in dem keine zwei Laserschwerter – die Duelle sind Schlüsselszenen der Saga – aufeinanderprallen. Das erste und einzige Laserschwert zündet sich in den letzten drei Filmminuten an.
5. Bitte kein Gemecker wegen „Multikulturalität“

Natürlich waren es weiße „Star Wars“-Nerds, die in „The Force Awakens“ wegen des „schwarzen Sturmtruppen“ Finn (John Boyega) ihr Weltbild zerstört sahen. In den sozialen Netzwerken kursierte der Hashtag #blackstormtrooper. Für „Rogue One“ wurden Casting-Entscheidungen mit Blick auf Zielgruppen-Erweiterung getroffen: Zum zweiten Mal in Folge eine Frau als Hauptfigur, dazu der britisch-pakistanische Rapper und Schauspieler Riz Ahmed (der hier leicht unterfordert wirkt, eher traurig als tragikomisch).
Die markantesten Engagements sind die chinesischen Superstars Donnie Yen und Jiang Wen. „Star Wars“ läuft in China, dem drittgrößten Kinomarkt, gut, aber längst noch nicht mega. Die beiden Darsteller sollen das ändern. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob in „Rogue One“ ein Klischee bedient wird, wenn ein Asiate, dazu noch ein blinder Asiate, den perfekten Aikido-Kämpfer gibt – verschiedene Medien bezeichnen ihn bereits als „Kampfmönch“. Man stelle sich mal vor, in „The Force Awakens“ hätte Finn in Maz Kanatas Bar den DJ gebeten, einen Rap-Song aufzulegen.
Allerdings ist die Figur des „Kampfmönchs“ Chirrut Imwe (Donnie Yen) auch diejenige, die den Rebellen „die Macht“ nahebringt. Und die erste Figur der Saga, die die Macht tatsächlich als Religion mit Gebet zelebriert, und in der Glaube als Mantra ausgesprochen wird. Der betende Soldat ist zudem eine der wohl angemessensten Figuren des Genre Kriegs-Film, hier taucht sie erstmals im „Star Wars“-Universum auf.
6. Retro-Look

Da „Rogue One“ zeitlich knapp vor „Eine neue Hoffnung“ angesiedelt ist, blieb den Machern gar nichts anderes übrig als auf eine Ästhetik zurückzugreifen, die in Konzepten aus den Siebzigerjahren für die Zukunft stand. Das bedeutet: klobige Helme, auf der Uniform Rangabzeichen-Reihen wie Tuschkästen, und in der Rebellen-Basis Glasbildschirme mit grünen Streifen und Kreisen, die sichtbar keinerlei Veränderung anzeigen. Es sieht aber alles toll aus.
Mendelsohns Krennic trägt einen weißen Anzug, der mal an einen Duschvorhang erinnert, mal an den Bademantel eines Yacht-Besitzers von 1977. Zu seiner Uniform gehört auch noch ein Cape – das bei diesem derart windigen Film unvorteilhaft in der Gegend herumflattert. Einer der Sturmtruppen trägt übrigens, auch dann noch, nachdem man sich kräftig die Augen gewischt hat, eine braune Shorts über seiner weißen Rüstung.
7. Richtiges Erzähltempo, richtige Länge

Der Beginn ist noch etwas zu hastig montiert. Es gibt drei Ortswechsel innerhalb von vier Minuten, dazu verwirrende Titel-Einblendungen von Planeten oder Kampfbasen, wie in einem dieser Michael-Bay-Filme, die weltweite Militärmobilisierung zeigen und dabei doch nur nervöses Bohei auffahren. Hier vielleicht das Resultat schlechten, unter Zeitdruck entstandenen Schnitts.
Spoiler!
Danach bleiben Regisseur Edwards und seinen Autoren noch 120 Minuten, bis ihre Helden die Todesstern-Baupläne erlangen. Da viele von ihnen sterben, ist es umso wichtiger, dass ihre Motivationen klar werden, damit ihr Opfer – das eigene Leben – nicht dazu führt, dass der Zuschauer frustriert den Kinosaal verlässt. Die Helden verabschieden sich aus dieser Welt in Frieden, Binsenweisheiten a lá „Rebellion is about Hope“ gehören dazu, denn es ist die Tragik dieser Figuren, keine Beweise dafür zu erhalten, dass sich ihr Einsatz tatsächlich gelohnt hat. Für den Sieg über das Imperium braucht es ja noch drei weitere „Krieg der Sterne“-Filme.

So begründen die Charaktere ihre Motivationen nicht mit Hoffnungen für die Zukunft. Sie hoffen ihrem Leben einen Sinn gegeben zu haben, indem sie Frieden mit der Vergangenheit schließen. Cassian, weil er früher Auftragsmorde begangen hatte. Jyn hofft am Ende, dass ihr Vater stolz auf sie gewesen wäre.
Mehr Humor?
Auch hier stellt sich die Frage, wo die Nachdrehs angesetzt haben könnten. Durchgedrungen ist, dass Produzentin Kathleen Kennedy sich einen leichteren Ton, mehr Humor für „Rogue One“ gewünscht hatte, deshalb „Force Awakens“-Regisseur J.J. Abrams „konsultiert“ wurde (angeblich stand er den zusätzlichen Dreharbeiten bei). Für die One-Liner sorgt in alter „Krieg der Sterne“-Tradition der Humor-Roboter, in diesem Fall jener umgedrehte Imperial-Droide K-2SO, der dem Idol C3-PO nacheifert. Auch der ist ein Experte für pessimistisch kalkulierte Überlebenswahrscheinlichkeiten in Gefahrensituationen („30 Prozent“, oder weniger).
8. Mutiges Ende

Mega-Spoiler!
„Star Wars“ wird eine Kinder-Reihe, spotteten Fans, nachdem Disney sich die Rechte an der Saga sicherte. „Rogue One“ dürfte Skeptiker verstummen lassen. „Viele Rebellen sind gestorben um uns diese Pläne zu bringen“, hieß es in früheren „Star Wars“-Filmen, und die Macher aus der Mickey-Maus-Abteilung nahmen die Legende ernst.
Dieser „Krieg der Sterne“ wird als erster Blockbuster in die Geschichte eingehen, in dem sämtliche Hauptfiguren, auf jeden Fall die ersten neun in den Credits genannten Schauspieler, sterben. Alle Helden lassen ihr Leben. Diese Entscheidung könnte „Rogue One“ einen Platz in den Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten kosten.
Sicher ist aber auch, dass niemand mehr den ersten „Krieg der Sterne“ von 1977 wird ansehen können, ohne bei bestimmten Szenen an Jyn, Cassian, den „Kampfmönch“ oder Mads Mikkelsen zu denken. Sie waren es, die den Staffelstab weiter reichten, um das Imperium zu schlagen. Jene Diskette, die in den atemberaubenden letzten Minuten von „Rogue One“ doch noch Prinzessin Leia erreicht. Das ist der Verdienst des achten „Krieg der Sterne“-Films – dass er mit dem ersten verschmilzt.