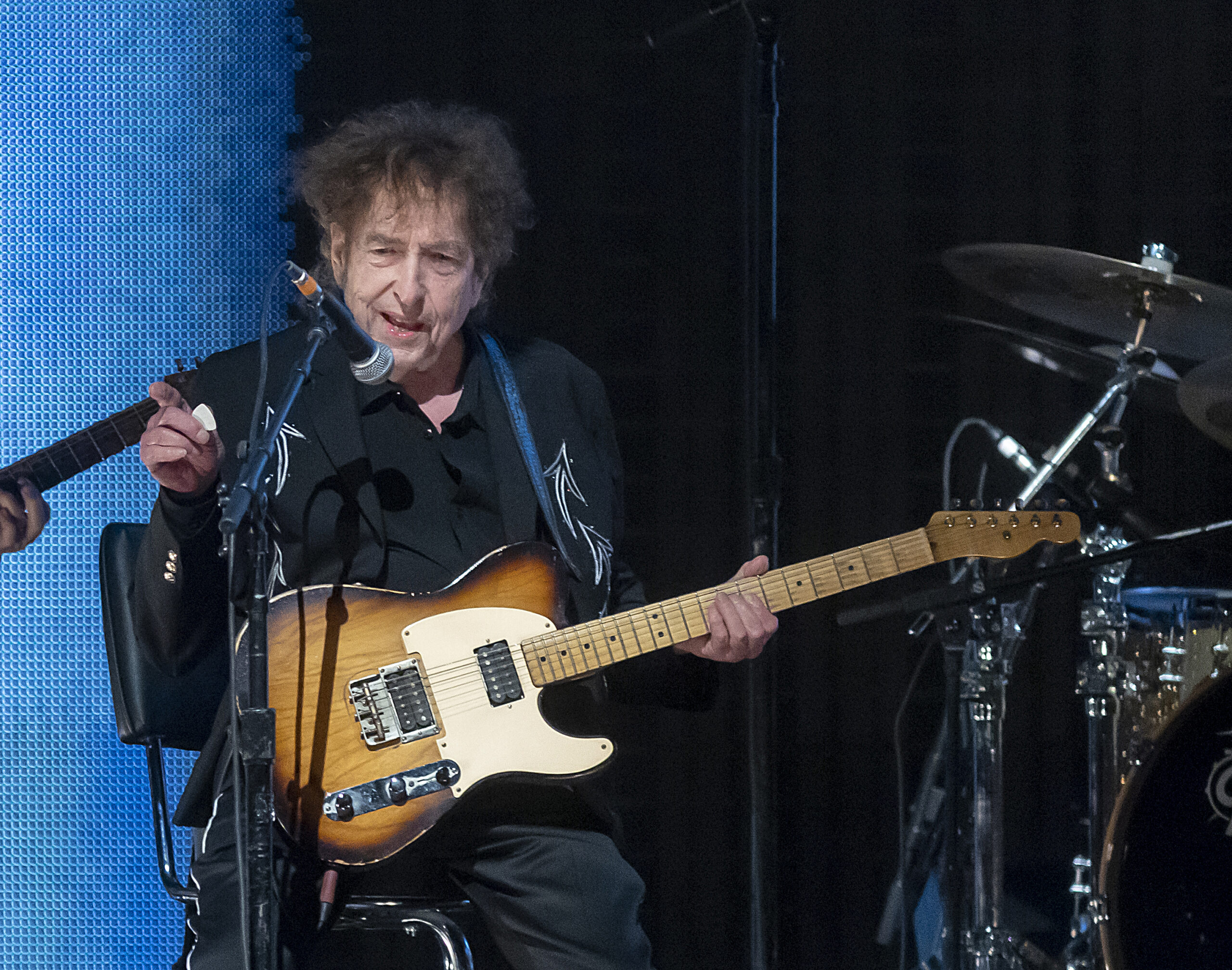Sophia Blenda
„Die neue Heiterkeit“ – Hochempfindlich
PIAS (VÖ: 19.8.)
Betörend-verstörende Kammerpop-Poesie aus Wien
Manchmal verfalle ich der Dunkelheit/Manchmal bedeutet Zukunft die neue Rückgewandtheit“, seufzt Sophie Löw, die sich Sophia Blenda nennt, in „Die neue Heiterkeit“, einem Song, der zu einem dumpfen Bass mit stoischer Gelassenheit ins Herz der Finsternis voranschreitet. Die 26-Jährige mit der eindringlichen Stimme, die Menschen mit gutem Geschmack schon als die Sängerin und Songwriterin der Wiener Band Culk kennen, tunkt auf ihrem Solodebüt, „Die neue Heiterkeit“, ihre poetischen Erkundungen gesellschaftlicher Widersprüche in meditativ-melancholische Soundschichten, entwickelt in hochempfindlich inszenierten Songs eine Intimität und Intensität, die an James Blake erinnert und in der das Ich und die Gesellschaft ständig um die Umkehrung der Machtverhältnisse streiten.
Betörend-verstörende Literarizität trifft auf elektronisch aufgeladenen Kammerpop
Betörend-verstörende Literarizität trifft auf elektronisch aufgeladenen Kammerpop. „Wo bleib ich“ ist ein Zeitlupensong, der sich Orientierung suchend im Kreis dreht, während Synthesizer-Harmonien an- und abschwellen. „Schwester“ ist mit grandios synkopierendem Gesang, der sich gegen ein Klavier stemmt, nah am Kunstlied. „BH“ erzählt bestürzend eindringlich von der Ermächtigung und Entmächtigung der Blicke. „Ties“ dekonstruiert mit einem düster klopfenden Beat Popstrukturen und verwandelt sich schließlich zu einem dumpf stampfenden Bass in einen entkernten Dance-Track.
„Wie laut es war“ inszeniert zu einem nervös hämmernden Ein-Ton- Klavier ein Beziehungsdrama: „Als dein Steinbruch abgetragen war/ Ich Zement in deinen gefrorenen Haaren sah/ Dachte ich, alles zerrinnt/ Und du kommst als Fels zu mir.“ Löws Lyrik verweigert sich zwar konsequent eineindeutigen Entschlüsselungen und erschafft einen im deutschsprachigen Pop einzigartigen poetischen Kosmos. Stets schimmern aber eine Ahnung von Angst und Gewalt, Depression und Verlust und eine kaum zu ertragende Nähe durch die Songs. Und heiter ist auf diesem Album natürlich gar nichts. Auch nicht im verhuscht-bitteren „Fun“, das zu einem Abgesang auf die Trostlosigkeit der Spaßgesellschaft wird.