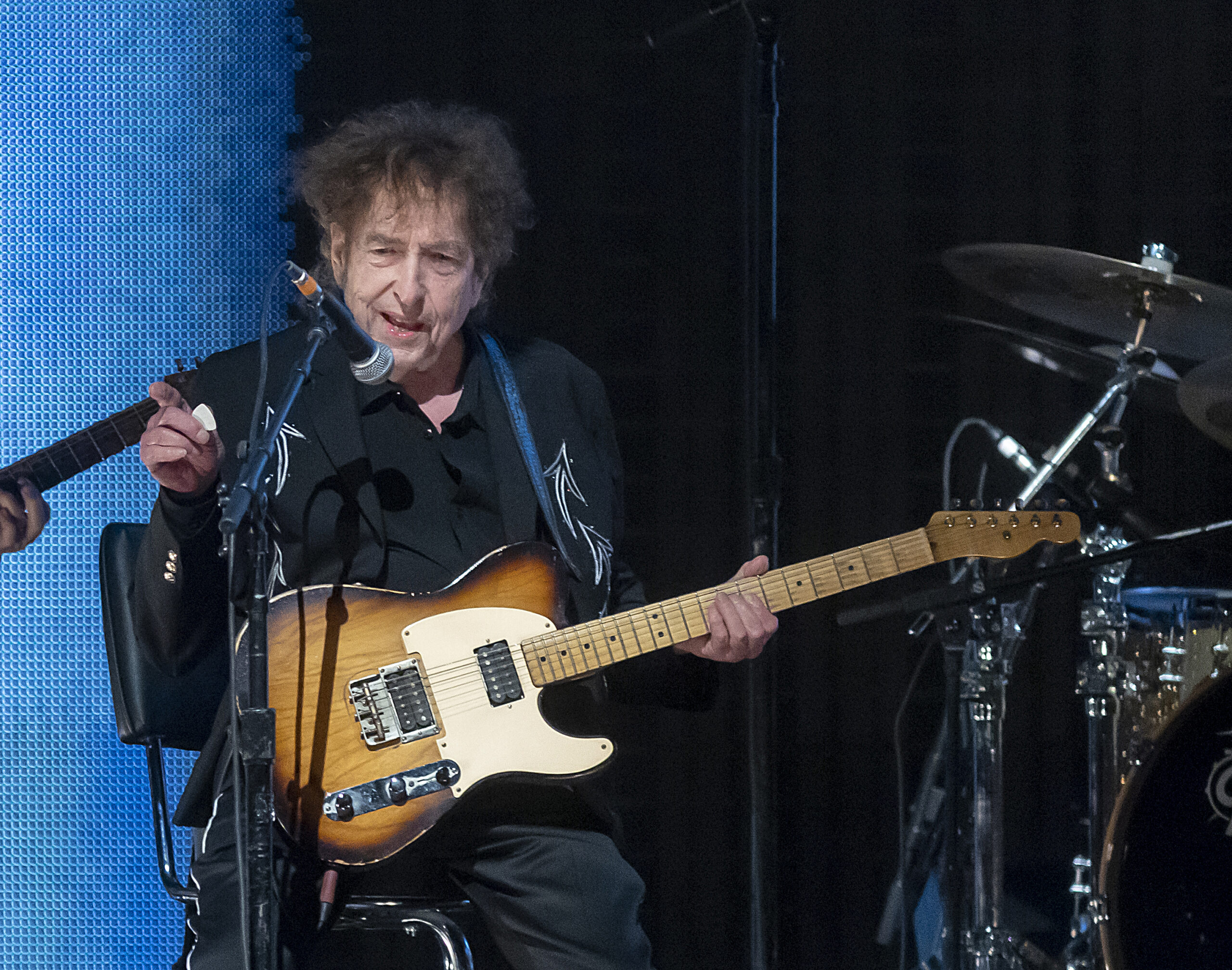Saša Stanišic :: Fallensteller
Ein gelungener Erzählungsband verkürzt die Wartezeit bis zum nächsten Roman des Empathikers.
„Es ist so viel einfacher, jemanden zu mögen, als jemanden nicht zu mögen. Man muss es nur wollen.“ Alles an dieser simplen Aussage ist so offensichtlich richtig, dass man Gefahr läuft, viel zu schnell über sie hinwegzulesen. Dabei erschließt sich ihre tiefe Weisheit erst, wenn man sie sacken lässt. Und bald schon erinnert man sich, wie schwer es ist, sich jemanden willentlich aus dem Herzen zu reißen.
Lebenserklärende Klugscheißerei dieser Art kann einem gerade in der Literatur schnell auf den Wecker gehen. Nicht jedoch wenn sie von Saša Stanišic stammt, dem wohl größten Dompteur im Zirkus der deutschsprachigen Literatur. Mit seiner zugeneigten, empathischen und liebevollen Prosa versteht er es wie kein anderer, in seinen Lesern ein melancholisches Gefühl wohlwollender Selbsterkenntnis zu erzeugen. Der 1978 im bosnisch-herzegowinischen Višegrad geborene Stanišic, der mit 14 Jahren nach Deutschland kam, ist ein Magier der Sprache, der sein Handwerk erschlagend perfekt beherrscht. Das zeigen auch die zwölf Prosatexte, die nun unter dem Titel „Fallensteller“ erschienen sind und wie Amuse-Gueules das Warten auf seinen nächsten Roman verkürzen. Zwischen seinem Debüt, „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, der 2006 im Finale um den Deutschen Buchpreis Katharina Hackers „Die Habenichtse“ unterlag und von der begeisterten Kritik kurzerhand zum Buchpreisgewinner der Herzen erklärt wurde, und dem mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichneten zweiten Roman, „Vor dem Fest“, vergingen immerhin sieben lange Jahre.
Ob es sich bei seinen hier versammelten Prosatexten um Erzählungen im klassischen Sinne handelt, darüber könnte man prächtig diskutieren. Beispielsweise können die Geschichten, in denen es den anonymen Erzähler und seinen Freund Mo von den „immens schönen tragischen blöden glückseligen deutschen Flüssen“ bis nach Stockholm führt, zwar für sich stehen, ihre chronologische Zusammengehörigkeit aber ist nicht zu leugnen. Die drei meisterhaft komponierten Texte über den Manager Georg Horvath, der sich auf einer Geschäftsreise in Brasilien von einem falschen Fahrer und seinen wirren Gedanken durch Zeit und Raum treiben lässt, ergäben eine wunderbare Novelle. Diese Gattung gilt heute aber leider als nahezu ausgestorben, weshalb Verlage zum übergeordneten Begriff der Erzählung greifen, wenngleich das Genre (trotz Franz Kafka und Heinrich Böll) hierzulande vollkommen unterschätzt und mitunter geradezu ignoriert wird. Feiern in den USA Nachwuchsautoren mit der Publikation einer Short Story oft ihren Durchbruch, gilt in Deutschland einzig der Roman als ernst zu nehmendes Zeugnis literarischen Schaffens.
Dabei sind die neuen Texte des 38-jährigen Stanišic Wunderwerke, in denen nicht selten das Unmögliche möglich wird. Da heben Schweine plötzlich zu sprechen an, Eschen plaudern die Geheimnisse fremder Postkarten aus, und ein verstummter alter Mann redet seinem erfolgreichen Enkelsohn noch einmal schweigend ins Gewissen. Man kennt die ungewöhnlichen Perspektiven des Hamburgers spätestens seit seinem vielstimmigen Uckermark-Epos „Vor dem Fest“, das von dem kollektiven Wir der in Fürstenfelde Ansässigen erzählt wird. Die titelgebende (und mit Abstand längste) Erzählung in diesem Prosaband spielt in jenem halb echten Fantasieort im Norden Berlins und knüpft im Ton des erzählenden Dorfes auch stilistisch an den Roman an. Die Einwohnerzahl in Fürstenfelde ist seit 2013 von ungerade auf gerade gekippt, was nicht am Ableben des Fährmanns, sondern am Zuzug von fünf syrischen Familien liegt, die im Block gegenüber von Ullis Garage eingezogen sind. „Babylonisches Sprachengewirr, wenn die Säufer, die Einheimischen, die Berliner und die Syrer zusammenkommen. Und alles läuft wie am Schnürchen. Können sich die Herrschaften in Berlin mehrere Scheiben abschneiden.“
In der Tiefe der Erzählung lauert eine Fabel über die Furcht vor dem Fremden. Ausgelöst wird die Angst der Fürstenfelder von einem in Reimen flüsternden „Rattenfänger“, hungrigen Wölfen und einem wild gewordenen Keiler. Gegen die ins Dorf eindringende Natur macht eine Gruppe „besorgter Bürger“ Stimmung, gegen den mysteriösen Kammerjäger, der in die Einliegerwohnung der Bäckersfamilie Zieschke einzieht, irgendwie alle und keiner. Einerseits nährt er die Hoffnung, dem wilden Treiben der Tierwelt ein Ende zu machen, andererseits sorgt seine unheimliche Kunst des Fallenstellens für Unbehagen im ganzen Dorf. Zu Recht, wie sich herausstellen wird. Kehren die Leser in dieser Erzählung noch einmal in die brandenburgische Provinz zurück, werden sie in anderen Fällen in die Welt entführt: sprachspielerisch in „Billard Kasatschok“, mythisch bei „In diesem Gewässer versinkt alles“ und verträumt mit „Georg Horvath ist verstimmt“. Es handelt sich bei diesen Texten um literarisch präzise Miniaturen der ambivalenten Lebenswirklichkeit zwischen hier und anderswo, in denen der Begriff „Heimat“ unter dem Brennglas von Globalisierung und Migration verhandelt wird. Saša Stanišic, der seit Jahren in Hamburg lebt, ist ein Poet und Revolutionär, der seine eigentliche Heimat in der Sprache gefunden hat. „In der eigenen, nicht in der Sprache allgemein. Präziser: im Artikulieren von Gedanken, im Formulieren, im Meinen. Präziser: in dem, was zum Ausdruck gebracht werden sollte.“ Man kann dem Sprachartisten Stanišic nicht näher kommen als in seiner Prosa, in der er unbekümmert (selbst)ironisch die Gegenwart „verwortet“. (Luchterhand, 19,99 Euro)