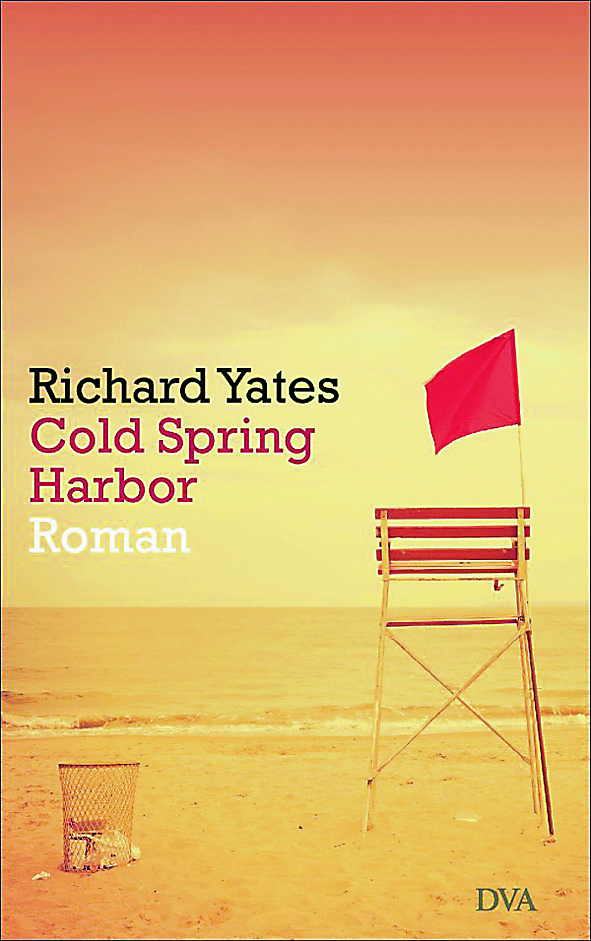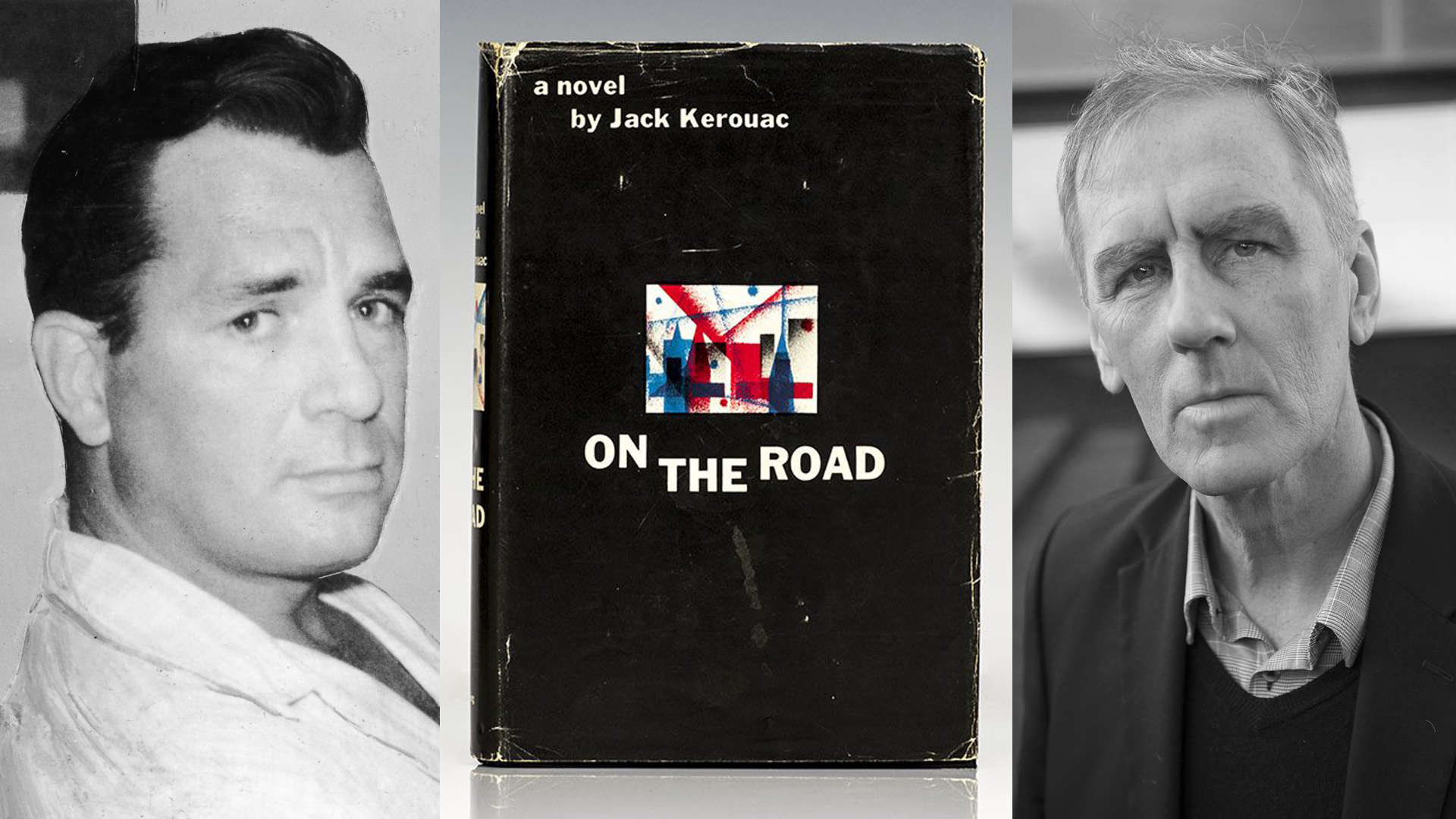Richard Yates :: Cold Spring Habor
Der letzte Roman des unerbittlichen Richard Yates beschließt die neunbändige deutsche Werkausgabe
Das Leben endet immer in einer Sackgasse. Mit ihren hochfliegenden Träumen rasen die Figuren in allen Geschichten von Richard
Yates (1926–1992) in Richtung Desillusion. Keine Ironie winkt vom Straßenrand und heitert sie auf – höchstens noch das Klirren von Eiswürfeln in Whiskeygläsern und die „funkelnde Fülle eines weiteren Drinks“ bei einem kurzen Stopp oder ein ehebrecherischer Quickie in einem schäbigen Motelzimmer, der ihr Selbstwertgefühl für einen lüsternen Augenblick hebt. Aus dem Autoradio ertönt auf nächtlicher Strecke oft ein sentimentaler Jazzsong, der bei genauem Hinhören aber nur noch zynisch klingt. Nirgends ein Schild mit der Aufschrift „Letzte Ausfahrt“; keine Wendung des Schicksals, nirgends.
Die Menschen haben bei Yates nicht einmal die Möglichkeit, geschweige die Kraft, das Lenkrad rumzureißen und einen U-Turn zu wagen. Das verstieße ohnehin gegen die Verkehrsregeln ihres verpfuschten Lebens. Denn diese Sackgasse ist zugleich eine Einbahnstraße.
Stilistisch sind es vor allem die brillanten, entlarvenden und glasklaren Dialoge, die den Niedergang der Figuren systematisch vorbereiten. Joyce Carol Oates, die, ebenso wie viele ihrer Kollegen, Yates verehrte – von Richard Ford, Tennessee Williams bis hin zu dem ihm freundschaftlich verbundenen Kurt Vonnegut –, beschrieb seine Protagonisten einmal als „unsichtbare Menschen, nicht ganz da, unfähig, sich durchzusetzen oder ihre eigenen Schicksale zu lenken“.
Das gilt für jedes Buch dieses Autors. Am bekanntesten ist sicher das posthum kanonisierte Meisterwerk „Revolutionary Road“ von 1961, das hierzulande mehr als 40 Jahre später als „Zeiten des Aufruhrs“ erschien – nicht zuletzt dank der passablen Verfilmung mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Sie spielen das Ehepaar Wheeler in einer vorstädtischen Siedlung namens Revolutionary Hill in der Nähe von New York. „Mir erschien der Titel als Anklage gegen das amerikanische Leben in den 50er-Jahren“, sagte Yates einmal. „Der Titel sollte nahelegen, dass die Straße der Revolution von 1776 in den Fünfzigern eine Art Sackgasse geworden war.“
Der Roman war im Leben von Yates der einzige halbwegs erwähnenswerte Erfolg und wurde in den USA gar für einen National Book Award nominiert. Selbst der 1976 von der Kritik gefeierte Roman „The Easter Parade“ über das Scheitern zweier Schwestern (ja, auch über die weibliche Seele konnte der von Flauberts „Madame Bovary“ zutiefst beeinflusste Yates grandios schreiben) war, was die verkaufte Auflage anbelangte, ein Fiasko. So musste der Trinker Yates sich jahrzehntelang mit Drehbucharbeiten, dem Schreiben von Reden für Robert Kennedy und Lehrtätigkeiten an diversen Universitäten über Wasser halten.
Das Scheitern seiner beiden Ehen zog ihn dabei nur noch tiefer in den Sog seiner schweren Alkoholabhängigkeit und psychischen Labilität. Physisch setzte dem im Zweiten Weltkrieg an Tuberkulose erkrankten Romancier das Kettenrauchen zu. So griff er kurz vor seinem Tod beim Fahren seines rostigen Mazdas abwechselnd zur Kippe und zur Sauerstoffmaske. Eine „Bombe auf Rädern“ nannte man das Gefährt des „writer in residence“ an der University of Alabama.
Und ausgerechnet eine Wagenpanne ist eine Art Schlüsselmoment in seinem letzten vollendeten Buch, dem Episodenroman „Cold Spring Harbor“ von 1986. Dieser beklemmende Trip ins Amerika der 40er-Jahre hat keine zentrale Figur, dafür aber ein zentrales Motiv: das kollektive Scheitern (was auch sonst?). Und besagte Panne erlaubt es dem präzisen Mechaniker des Fatalismus, die Schrauben des Schicksals noch etwas anzuziehen.
Der blendend aussehende junge Mann Evan Shepard – er hat bereits ein Kind aus einer gescheiterten, sehr frühen Ehe – begleitet seinen Vater, einen ehemaligen Soldaten mit äußerst bescheidener Karriere, vom Städtchen Cold Spring Harbor in Long Island zu einer Augenklinik in downtown New York. In Greenwich Village streikt der Wagen, die beiden klingeln an einem „x-beliebigen Apartmenthaus“, um Hilfe zu holen.
Gloria Drake öffnet die Tür zu ihrer dunklen, nach Katzenkot stinkenden Wohnung. „Charles begriff sofort, dass er einen netten, vom Pech verfolgten Menschen vor sich hatte.“ Evan verguckt sich gleich in die „süße“, wenngleich naive Tochter Rachel. Und der zum Hausmann degradierte Exoffizier Charles, der für seine stets unpässliche Ehefrau morgendliche Drinks mixen muss, ist unversehens mit der dem Alkohol ebenfalls nicht abgeneigten, hysterischen Gloria konfrontiert.
Die folgende Familienzusammenführung – Evan zieht mit Rachel und ihrem Bruder Phil in ein kleines, feuchtes Haus nahe dem der Shepards – scheint zunächst geglückt. Zumindest für Evan. Immerhin könnten sie, denkt er, „bei Feuerschein auf dem Kaminvorleger bumsen“. Dass sich sehr bald ihrer aller Träume – außer vielleicht die des sensiblen Phil, der einfach nur seiner Mutter entkommen will – in ätzenden Rauch auflösen, versteht sich von selbst.
Als Richard Yates sich schließlich keuchend mit dem Manuskript von „Cold Spring Harbor“ zur Post aufmachte, so berichtet sein Biograf Blake Bailey, habe man ihn röcheln hören: „Das ist ein kleiner Roman.“ Ein zufällig vorbeilaufender Bewunderer seiner Kunst soll das mit einem „Das ist ‚Der große Gatsby‘ auch“ kommentiert haben. Und Yates, so Bailey weiter, soll euphorisiert entgegnet haben: „Das stimmt! Das stimmt!“ Vielleicht hörte der große Menschenkenner Yates auch nur seine Romanfigur Charles flüstern: „Man darf den Mut nicht verlieren, auch wenn man vielleicht bloß abwarten kann, was als Nächstes passiert.“