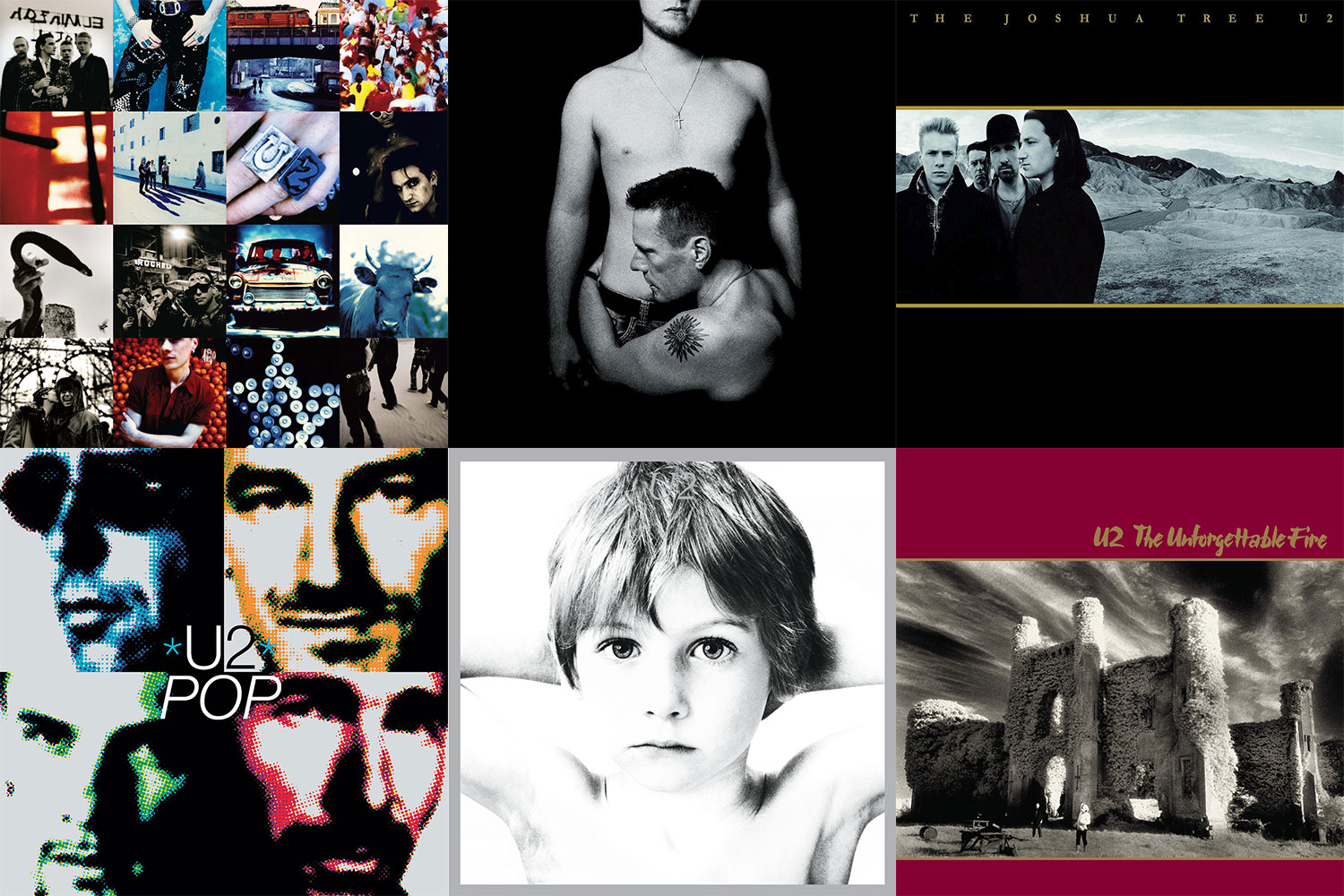Revolver
„Music For A While“
Es gibt immer noch Menschen, die in ihrem ganz eigenen Kosmos aufwachsen. Die sich, abgeschottet von der Außenwelt, Barock-Komponisten wie Henry Purcell und Lautenlieder-Pionieren wie John Dowland widmen, Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Menschen, denen man erst einmal „Sgt. Pepper“, Velvet Underground und Elliott Smith in die Hand drücken muss, wenn man beschließt, mit ihnen gemeinsam zu musizieren. Und vielleicht eine Coke.
So geschehen mit Cellist Jérémie Arcache, der seinen jetzigen Bandkumpel Ambroise Willaume bereits mit sechs Jahren in einer Pariser Musikschule kennenlernte. Als sie sich vor drei Jahren wiedertrafen und besagte Plattenübergabe stattfand, hatte Willaume wiederum das Gefühl, zu sehr im Rock’n’Roll gefangen zu sein. Mit dem zweiten Gitarristen Christophe Musset fanden beide einen Weg aus der Sackgasse.
Das Erfolgsrezept ihrer Liveshows: drei Stimmen, zwei Gitarren, ein Cello- no speakers, no bass, no drums, no mics. Und das vorzugsweise im ungewöhnlichen 5/4-Takt. Schon Henry Purcell schrieb über die Liebe. Schon John Dowland wusste, dass gute Songs nicht länger als drei Minuten sein dürfen. So wird man zur Kammerpop-Version der Beatles. Oder zu Simon & Garfunkel mit mehr Gigabite. Der Preis der Deutschen Schallplattenkritik scharrt mit den Hufen.
Doch klingeln einem da nicht nach drei, vier Stücken die Ohren von allzuviel dreistimmigem Harmoniegesang? Obwohl für das Album ein Schlagzeuger angeheuert wurde, verspürt man plötzlich Heißhunger auf eine Drummachine und ein bisschen Feedback. Oder ein „Velvet“ im Bandnamen. Wer will schon zu viel Harmonie? Ab und zu müssen Teller fliegen. Und, ja, sie haben sich nicht nach einer Handfeuerwaffe benannt. (Delabel/ EMI)
Frank Lähnemann