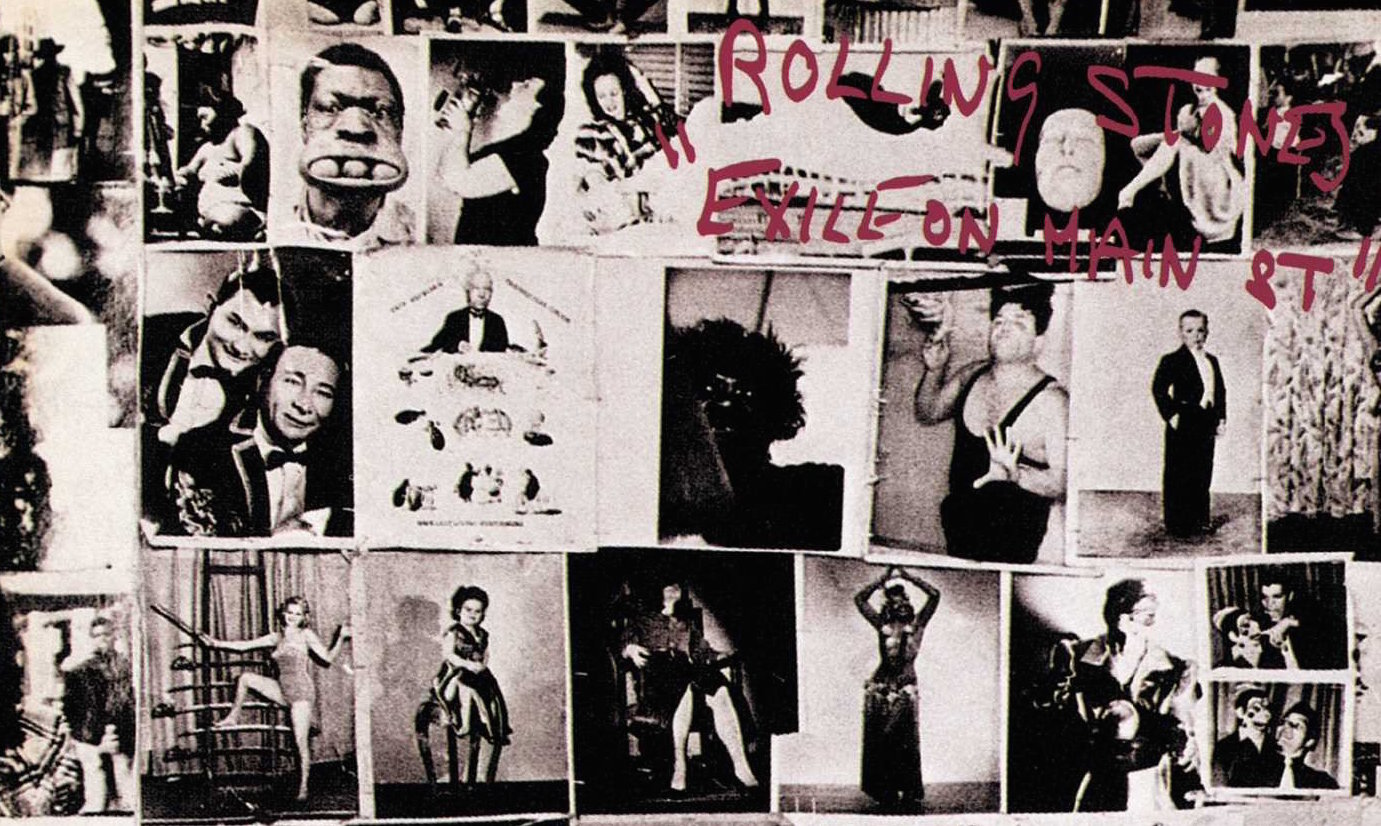Christopher Nolan :: Dunkirk
Keine Geschichtsstunde, kein Schautafel-Kino, aber warum auch nicht: In seinem Drama um das eingekesselte Dünkirchen inszeniert Regisseur Nolan die Rettung der Alliierten aus der Sicht einzelner Soldaten, was sich als lohnenswerte Herausforderung erweist

Wo liegt Dünkirchen, wie weit liegt Dünkirchen entfernt von Deutschland, wie weit von England, wer wurde evakuiert und wie viele, was war überhaupt die Schlacht von Dünkirchen, wann war die Schlacht von Dünkirchen, wie ging sie aus. Keine dieser Fragen wird in „Dunkirk“, wie die französische Nordseeküstenstadt auf Englisch und im Filmtitel heißt, beantwortet; lediglich ein Flugblatt mit Landkarte flattert am Anfang durch Bild. Normalerweise werden historische Rahmenbedingungen in Realverfilmungen erklärt, per Schautafeln oder Dialoge. Regisseur Christopher Nolan aber hält sich mit Einbindungen nicht lange auf – es interessiert ihn nicht, Kriegsverläufe nachzuzeichnen, geschweige denn Geschichtsunterricht zu bieten. „Dunkirk“ ist eine erzählerische Herausforderung, genau das hat der Filmemacher im Sinn.
Wer kein Experte für den Zweiten Weltkrieg ist, könnte im Drama über die Evakuierung alliierter Streitkräfte den Überblick verlieren. Sea, Land, Air: Es gibt drei sich überschneidende Zeitlinien, drei Blickwinkel, einmal der eines Spitfire-Piloten (Tom Hardy), eines ältlichen Zivilisten auf seiner Segeljacht (Mark Rylance), sowie die der Soldaten am Strand, im Mittelpunkt der junge Tommy (Fionn Whitehead) und Alex (One-Direction-Popstar Harry Styles, glaubwürdig als Egoist).

Nolan hat seit 20 Jahren kein kürzeres Werk gedreht als diesen 107-Minüter, und ein längeres wäre bei diesem Inferno aus Maschinengewehr-Geknatter, Verletztengeschrei und Explosionen wohl auch nicht zu vermitteln gewesen. Die Erlebnisse in den drei Schauplätzen erzählt er parallel, sie umfassen aber unterschiedlich lange Zeiträume, von einer Stunde bis hin zu einer Woche. Nicht immer gelingt es ihm, diese Unterschiede als „Rennen gegen die Zeit“ entsprechend herauszuarbeiten – ob die Flieger nur noch eine Stunde von Dünkirchen entfernt sind, oder die Soldaten dort schon sieben Tage gegen die Deutschen bestehen, geht in der Kriegsdarstellung unter. Die Schlacht von Dünkirchen bestand auch darin, dass die Wehrmacht einen Verteidigungsring durchbrechen sollte. Nolan versäumt es, den sich nähernden Feind einzubinden – was dem Tempo dienlich gewesen wäre.
Wie viele Oscars bekommt „Dunkirk“?
Nolan war immer schon mehr Techniker- als Schauspieler-Regisseur, und allein die Inszenierung der Kriegsmaschinerie könnte ihm bei der Oscar-Verleihung 2018 vier Auszeichnungen einbringen: für den Ton, die Kamera, den Schnitt sowie Soundschnitt. Er lässt Nachbauten von Kampffliegern über das Meer streifen, krachend landen sie in den Fluten, sie gehen in Flammen auf. Eine derart beeindruckende Luft-Choreografie samt Materialverschleiß gab es zuletzt in Coppolas „Apocalypse Now“ von 1979 zu sehen. All das wäre heutzutage mit Computereffekten darstellbar – Nolan wollte die Aktionen haptischer gestalten. Es sieht zum Teil atemberaubend aus.
Pilot Farriers (Hardy) Mission bietet fast schon meditative Momente, das Meer erscheint endlos, blau leuchtend unter ihm. Gelegentlich kommt eine feindliche deutsche Junkers ins Bild. Im Zweiten Weltkrieg flog man nicht per Computerbildschirm-Steuerung, sondern auf Sicht. Die Details sind großartig, das Ächzen des Rumpfes bei der mechanischen Steuerung, die Schwierigkeit, den Gegner ins Fadenkreuz zu ziehen, die mangelnde Präzision im Abschuss, Kugeln, die wie verspielte Fliegen durch die Luft irren. So wie der wohl einflussreichste Kriegsfilm der letzten 20 Jahre, „Der Soldat James Ryan“, entfaltet „Dunkirk“ seine Wucht über sich zu Lärm steigernde Angriffsklänge. Im Gegensatz zu Steven Spielberg aber zeigt Nolan kein einziges abgesprengtes Körperteil. Das Grauen wird auch so glaubhaft.

Die deutschen Gegner stürzen ins Meer, dennoch gibt es in „Dunkirk“ kein einziges deutsches Gesicht zu sehen. Am Ende ein paar schemenhafte Gestalten mit Stahlhelmen. Die heute als standardisiert geltende Spielberg-Methode, auch die Gegenseite als menschlich darzustellen, ist für Nolan nicht von Belang. Ebenso wenig aber stellt er britische Soldaten als Helden dar. Das Ende ihrer Allianz mit den Franzosen zeigt sich, als es darum geht, wer Einlass in die begehrten Rettungsschiffe erhält. Ein andermal soll ein „Frog“, wie die Briten Franzosen nennen, von Bord geworfen werden, damit weniger Gewicht auf dem untergehenden Schiff lastet. „Dunkirk“ ist ein Film über Solidarität – so lange es um die unter Landsmännern geht.
Es mangelt allerdings an Identifikationsfiguren, weil Hintergrundgeschichten fehlen. Es ist – wie in so vielen Kriegsfilmen – ein Opfer aus der Zivilgesellschaft, das erstmals Mitleid erweckt. Ein schiffbrüchiger Soldat (Cilian Murphy) beginnt auf dem Segelschiff von Dawson (Rylance) ein Gerangel, verursacht damit den Unfalltod eines Teenagers (Barry Keoghan). Während seiner letzten Atemzüge berichtet der Junge von seinen Träumen, die nicht mehr in Erfüllung gehen könnten. Diese Tiefe, diese Perspektiven lässt Nolan bei keinem seiner anderen Charaktere zu.
Rettungsmission „Operation Dynamo“
Es sind im Kino sonst immer Zivilisten, ob Frauen, Männer oder Kinder, die gerettet werden müssen, daran bewerten wir die Heldenhaftigkeit der für sie sterbenden Soldaten. „Dunkirk“ ist historisch korrekt, also gibt es in der Geisterstadt Dünkirchen nur noch Uniformierte, alle anderen wurden bereits evakuiert. Allerdings fehlen die Größenmaßstäbe der Militäraktion: Wie viele der Truppen eigentlich noch rausgeschifft werden müssen, bis die Deutschen den Strand einnehmen. Da hilft auch Hans Zimmers wie eine Stoppuhr surrender Soundtrack nichts: Die Dringlichkeit der so genannten Rettungsmission „Operation Dynamo“ wird nicht deutlich.
Tatsächlich hat Nolan nur einen Bruchteil der Soldaten filmisch erfasst – insgesamt wurden fast 340.000 Menschen von Frankreich nach England transportiert, was eine unglaublich komplizierte Logistik voraussetzte. Das Meer aber wirkt in „Dunkirk“ leer, die Luft auch. Lediglich drei Spitfire fliegen in Richtung Frankreich. Immerhin vereinfachte das die Flugdarstellungen im Film.

„Bring The Boys Back Home“ ist ein Topos im Kriegskino, und in einer für Nolan untypischen, pathetischen Szene lässt er seinen Commander Bolton (Kenneth Branagh) „Home“-rufend jubilieren, als er durchs Fernglas Rettungseinheiten durch die Brandung stoßen sieht. Es sind allesamt Zivilisten, alte Männer und Frauen, die in ihren kleinen Booten und Jollen heraneilen. Hans Zimmer spielt dazu eine Familiensinfonie. Der Mythos Dünkirchen entstand auch hier. Großbritannien wurde vom Gedanken beflügelt, trotz Niederlage in dieser Schlacht Hitler im Krieg schlagen zu können. Aus dem Off wird später Churchills berühmte „We Shall Fight On The Beaches“-Rede zitiert. Die Briten lieferten einen großen Überlebenskampf.
Kriege werden auch durch die Leute gewonnen, die eigentlich Zuhause bleiben sollten. Nun bilden die vielen Rettungsschiffe, plötzlich am Horizont aufgetaucht, gar eine stolze Linie. Wie weit ist es von Dünkirchen bis in den nächsten britischen Hafen? Nachgeschlagen: 26 Seemeilen, rund 41 Kilometer.