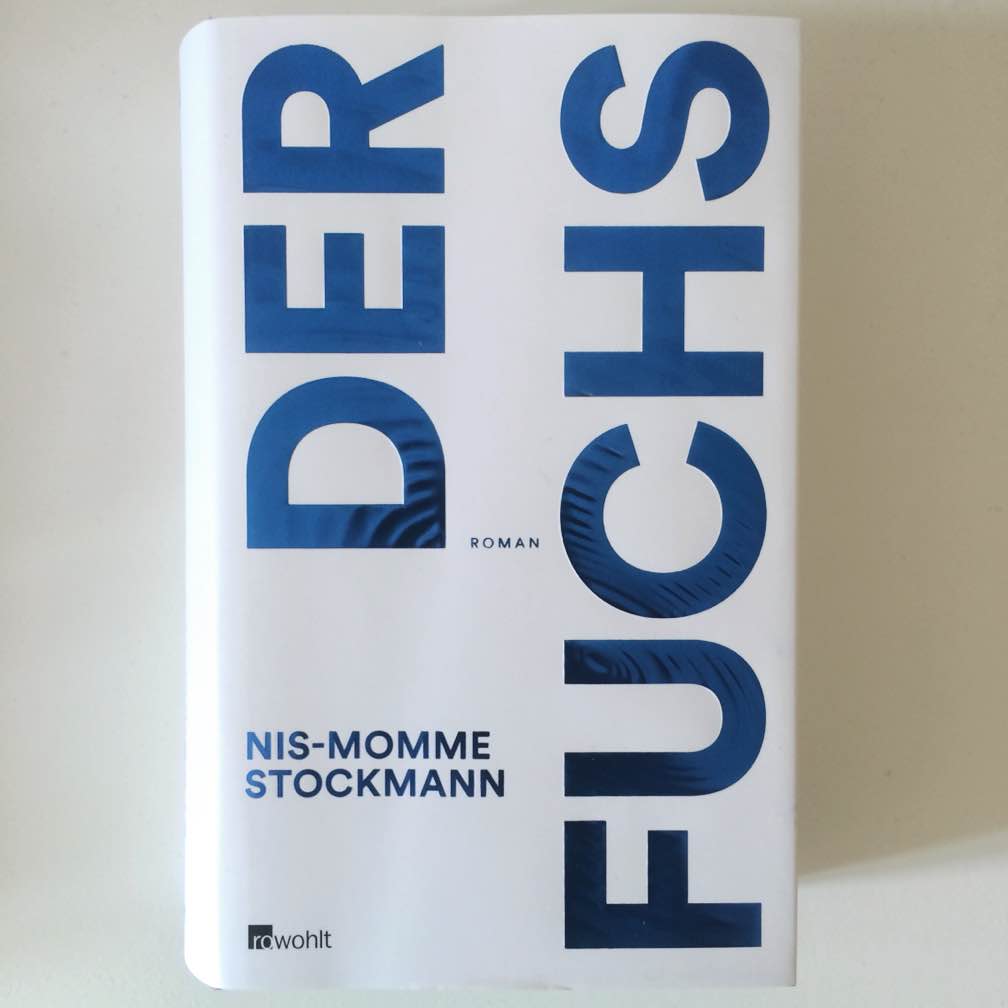Nis-Momme Stockmann :: Der Fuchs
Das hochkomplexe, apokalyptische und genialische Romandebüt eines Theaterwunderkinds.
In der deutschen Gegenwartsliteratur ist der Fuchs ein sagenumwobenes Wesen: Bei Saša Stanišic streunt er durch die Niederungen der Uckermark, Wolfgang Herrndorfs jugendliche Helden begegnen ihm in einer brandenburgischen Kleinstadt, und Frank Witzel setzt John Lennon und Yoko Ono nackt vor sein Konterfei, damit er verborgen bleiben kann. Im Debütroman des Wunderkinds der deutschen Theaterszene, Nis-Momme Stockmann, taucht er in einem Kinderbuch auf und verschlingt, von unstillbarem Hunger geplagt, die Welt, die ihn umgibt. Dass er diesem apokalyptischen Meisterwerk voller Andeutungen und Zeichen seinen Titel gibt, ist durchaus programmatisch zu verstehen. Aufgebaut ist dieser beziehungsreiche und vielschichtige Roman wie das Symbol, dem man hier immer wieder begegnet: „ein doppelter Kreis, den ein zackiger Strich von der Mitte her durchtrennte“.
Dieses auf dem Kopf stehende Reset-Zeichen gibt Stockmanns Weltuntergangsgeschichte die Gestalt vor. Im äußeren Kreis wird eine Art Survival-Geschichte erzählt, von einem unter Wasser gesetzten Dschungel camp, das nur überlebt, wer festen Willens ist. Finn Schliemann berichtet hier im Live-Modus von einer Sturmflut, die eines Tages die Kleinstadt Thule wegspült. (Sowohl das antike Thule, die am äußersten Rand gelegene Insel, als auch das „letzte Land“ der keltischen Mythologie dienen hier als Vorlage.) Als die Wassermassen binnen weniger Minuten die provinzielle Ordnung in das Chaos ihrer braunen Fluten reißt, flieht der Erzähler aufs Dach. Von dort beobachtet er, wie all das, was Leben bedeutet, als blickdichter Müllteppich an ihm vorbeizieht. „Als wolle uns ein Künstler unsere spätkapitalistische Entedelung vorführen.“ Dieser apokalyptische Romantizismus hat bald ein Ende, und Schliemann wird mit den letzten Menschen von Thule in einem Ruderboot um sein Leben kämpfen müssen. Ein mysteriöses Tagebuch bildet in der Romanstruktur den zackigen Strich, der aus der äußeren in die innere Handlung führt. Anhand von Fotos und kruden Notizen wird darin eine seltsame Verschwörung dokumentiert, in der babylonische Gottheiten und unermüdliche Agenten einen vorherbestimmten Weltenlauf sichern. Dieses Buch hält Schliemann zu seiner eigenen Überraschung in den Händen, als er auf dem Dach steht und den Blick in die Vergangenheit wendet. Seine Erinnerung macht den inneren Kreis des Romans aus.

Die Geschichte liest sich wie ein klassisches Coming-of-Age- Abenteuer auf dem Land, in dessen Verlauf sich Finn Schliemann vom Außenseiter zum Auserwählten entwickelt. Der Vater tot, die Mutter deprimiert und der Bruder behindert – eigentlich keine gute Ausgangsposition, um am Arsch der Welt zu punkten. Er zieht sich in ein Exil aus Büchern, Fotografie und Zeichenlehre zurück, bis ihn die durchgeknallte Katja als Geistesverwandten erwählt. „Alles, was denkbar ist, ist auch möglich. Und wir bestimmen, was denkbar ist. Niemand sonst“, flüstert diese geheimnisvolle Königin von Thule Stockmanns adoleszentem Erzähler ins Gewissen. Und denkbar ist eben die Verschwörung, die die Welt aus dem Raum-Zeit-Kontinuum kippen wird. Statt des Würfelspiels der Götter, das man Schicksal oder Weltenlauf nennt, gebe es nur „die minutiöse, kleinteilige, Jahrmillionen dauernde Arbeit des Büros an der Organisationsstruktur der Räume. Oder wie andere es nennen würden: der Zeit.“ Die Agenten dieses Büros hätten einen anderen Masterplan, den es zu durchkreuzen gelte, wollten sie am Leben bleiben. Und nun ist sie da, die Flut, die Zeit und Raum, wie die Menschen von Thule sie bisher kannten, ein Ende macht?
„Der Fuchs“ ist eine mitreißende, kühne und genial konstruierte Erzählung. Mit jeder Seite schlittert man tiefer in das komplexe Ideen- und Gedankengebäude des Erzählers, bis man nicht mehr weiß, wo die Wirklichkeit endet und der Wahnsinn beginnt. „Unnützes Denken mischt sich hochfrequent mit zwingend nötigem.“ Mitunter fühlt man sich wie in einer Geisterbahn. Fuhr man gerade noch durch die geschichtsträchtigen Niederungen der norddeutschen Seelenlandschaft, kreuzen hinter der Ecke schon die babylonischen Götter ihre Klingen, während von unten bereits das Keckern der sadistischen Dorfrowdys zu vernehmen ist. Nach der Hälfte des Romans setzt Stockmann die verschiedenen Motive seiner Erzählung gewissermaßen auf Schienen (übrigens grafisch genial gelöst). Die einzelnen Handlungsstränge kreisen in- und umeinander, bis sie am Ende in eine gewaltige Erzählung über unsere Zeit münden. Diesen „Fuchs“ muss man sich wie die Werke von David Foster Wallace, Thomas Pynchon oder Mark Z. Danielewski über die hochkomplexe Struktur und die Musikalität der Sprache erarbeiten. (Man müsste ihn am besten laut lesen.) Das ist großartig, verlangt aber auch viel Aufmerksamkeit.
Der Untergang von Thule ist in der beklemmenden Atmosphäre unserer Zeit aufgelöste Kulturkritik, in der sich „die ganze verwirrungstiftende, chaotische, widersprüchliche Welt“ wiederfindet. In der deutschen Gegenwartsliteratur gibt es nichts Vergleichbares. Stockmann zeigt mit dem Untergang dieser Welt, dass unsere Art zu denken nicht mehr weiterführt. Die Ordnung der Postmoderne ist längst die eigentliche Unordnung. Wir fürchten die Leere, die die Sturmflut nach Thule bringt, weil wir vergessen haben, dass Ordnung und Unordnung zwei Variablen ein und derselben Gleichung sind. Stockmanns Fuchs kümmert all das jedoch nicht. Er wird erst dann Ruhe geben, wenn er das Weltall und sich selbst verschlungen und so jede Ordnung ins Chaos gestürzt hat. Dann ist alles wieder denkbar. (Rowohlt, 24,95 Euro) – Rezension von Thomas Hummitzsch