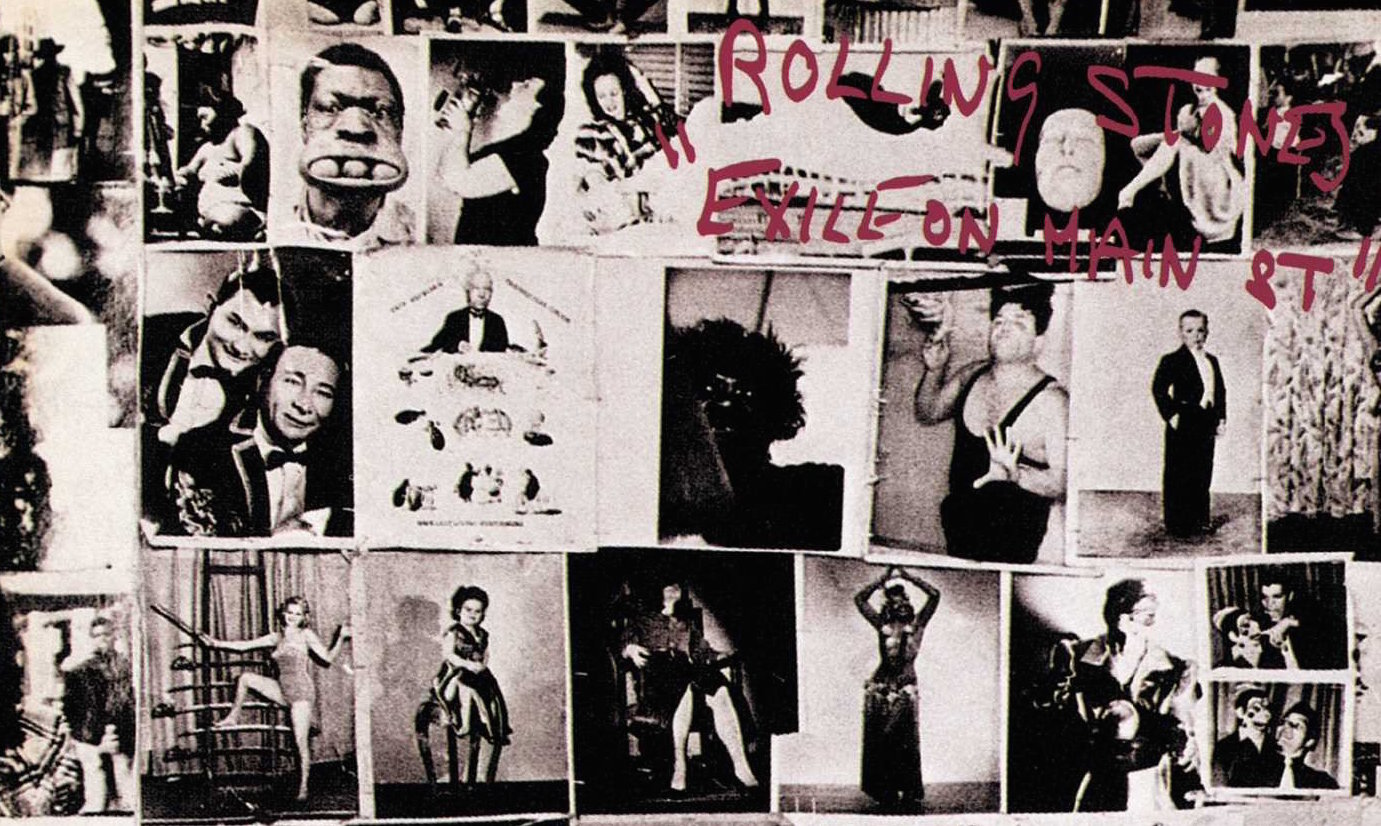„Mr. Inbetween“ – Staffel 3: Von einem Monster, das andere Monster tötet
Ein Killer mit einem Herz aus Gold mordet sich durch Sydney. Wie sehr dürfen wir ihn mögen?

Serien haben ein Problem mit Held*innen. Oder besser mit Anti-Held*innen. Oder besser mit Fans, die sich auf die falsche Seite schlagen. Zu Beginn der 2000er erfreuten sich Serienkritiker*innen daran, dass Serien in ihren ausladenden Lauflängen klassisch binäre Konflikte sehr selten mit simplen Gut-Böse-Schablonen auflösten.
Die Möglichkeit verschiedene Perspektiven und Seiten aufzuzeigen, um dabei zentrale Fragen facettenreich schimmern zu lassen, ließen Serien wie „The Wire“ glänzen. Dort spiegelte sich die Gewissheit, dass die Welt zu komplex sei, als dass sich Fragen nach Moralität in jene reduktiven anderthalbstündigen Plots pressen lies, die im breitenwirksamen Storytelling Hollywoods dominierten. Stattdessen standen die Nuancen im Vordergrund, die sich im ausladend weiten erzählerischen Raum der Serie über Stunden, Monate und Jahre entfalten konnten.
Die Folgen der Bad-Boy-Coolness
Das leicht toxisch anmutende Fantum, dass sich im ersten Höhepunkt des Serienbooms rund um „Breaking Bad“ auftat, lies aber vermuten, dass die Sehnsucht nach dem Outlaw-Antihelden seltsame Auswirkungen mit sich trug. Das Psychogramm eines Mannes, der sich vom Durchschnitts-Otto zum mörderischen Drogenzar wandelte, verstanden manche nicht als Moritat über die Korrumpierbarkeit des einfachen Mannes im Angesicht von Macht und Geld. Sie wurde eher als Selbstermächtigungsfantasie gesehen, in der sich ein gegängelter weißer Mann frei der Fesseln von Moral und Anstand endlich selbst verwirklichte.
Die entsprechenden Merchandise-Artikel und das Klientel, das diese kaufte und zur Schau stellte, waren klare Indizien für die vermeintliche Bad-Boy-Coolness die Walter White in seiner finalen Inkarnation versprühte. Statt Erschrecken über den allmählichen Abstieg eines Familienvaters in dunkle Abgründe, gab es Teile des Publikums, die diesen anerkennende bewunderten.
Was hat all dies mit der australischen Serie „Mr. Inbetween“ zu tun? Ein kleines moralisches Dilemma, das sich auftut. Über insgesamt drei Staffeln – die letzte davon ist nun auf Disney+ verfügbar – folgen wir dem Alltag von Ray Shoesmith (faszinierend: Scott Ryan), der seinen Lebensunterhalt als Killer verdient. „Keine Frauen, keine Kinder“ ist eine der Leitlinien für seinen durchwegs blutigen Job, der auch sonst von einem zwar brachialen, aber in sich konsistenten Ehrenkodex durchzogen ist.
Nebenher versucht Ray seiner heranwachsenden Tochter ein guter Vater zu sein, kümmert sich um seinen schwerkranken Bruder und versucht in Therapiesitzungen seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bringen. Ein Hauch von „Fargo“ weht durch die eintönigen Vororte Sydneys, wenn mit trockenem bis bösem Humor und gewalttätigem Pragmatismus gemordet, gefoltert und geraubt wird.
Über drei Staffeln hinweg, in denen die kleinen halbstündigen Vignetten zwischen beiläufigen Brutalitäten und emotionalen Momenten wechseln, sympathisieren wir immer stärker mit Ray. Einem Mann, der von der ersten Minute an als Monster gezeichnet wird. Ein Monster, das andere Monster tötet und sich dabei rührend um seine Liebsten kümmert, während er mit den Dämonen aus der Vergangenheit ringt.
Die moralische Wandlung eines Killers
Ein Monster mit Chance auf Rettung also. Doch während sich Ray vor unseren Augen allmählich wandelt, schwingt sanft die Frage mit, in wessen Augen die hintersinnig-grimmige Charakterstudie samt Schwanengesang auf Harte-Kerle-Klischees eben nicht als solche verstanden wird. Sondern als ähnlich problematische Machokiller-Fantasie wie die eines Walter White empfunden wird.
Mit knackiger Laufzeit, präziser Dramaturgie und größtmöglichem Binge-Faktor ist „Mr. Inbetween“ eine jener Indie-Entdeckungen, die im etwas frenetischen Blockbusterfeuerwerk des Streaming-Giganten leicht untergeht. In Hinblick darauf, dass dadurch möglicherweise manche der bedenklicheren Fans sich nie mit dem Anti-Helden Ray Shoesmith identifizieren können, vielleicht nicht so schlecht.