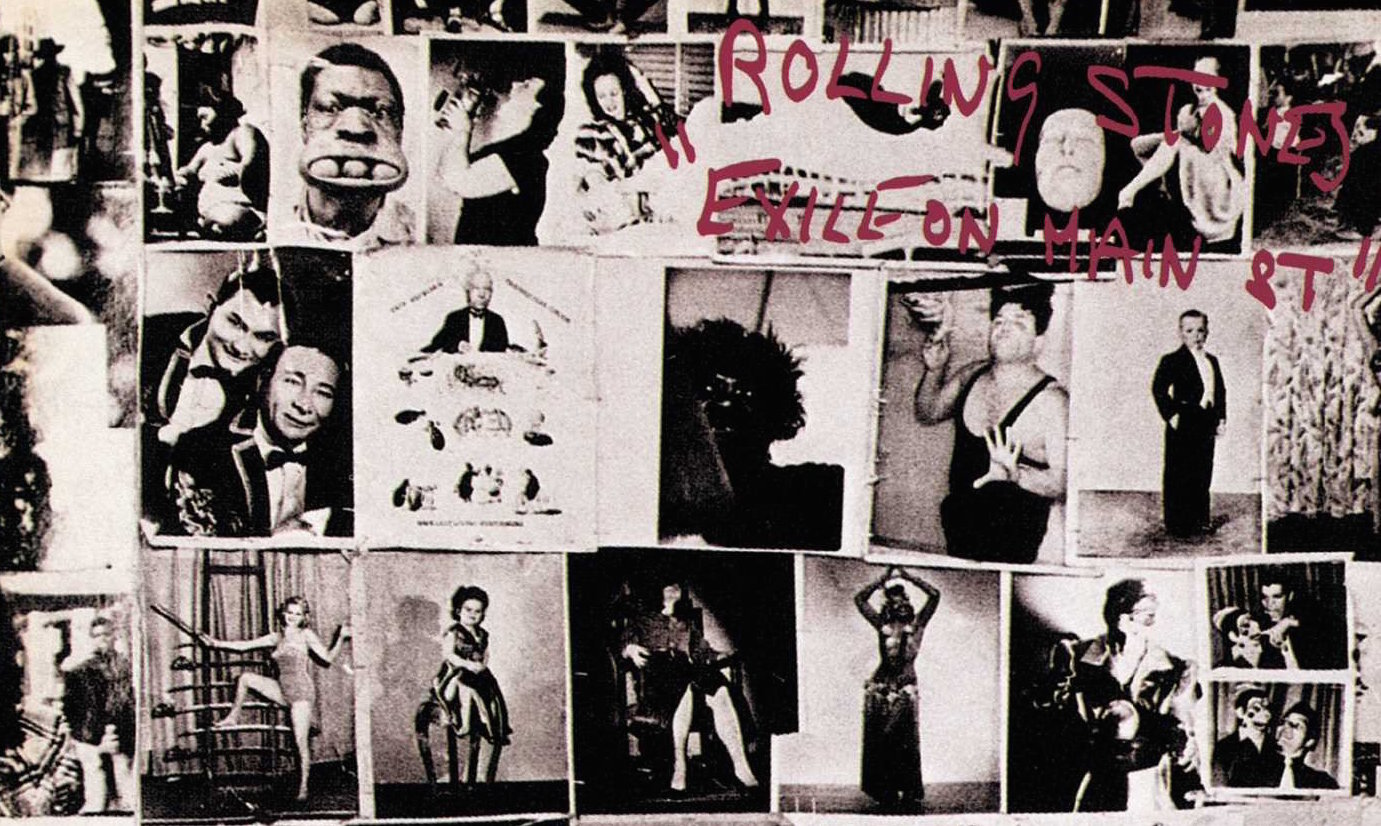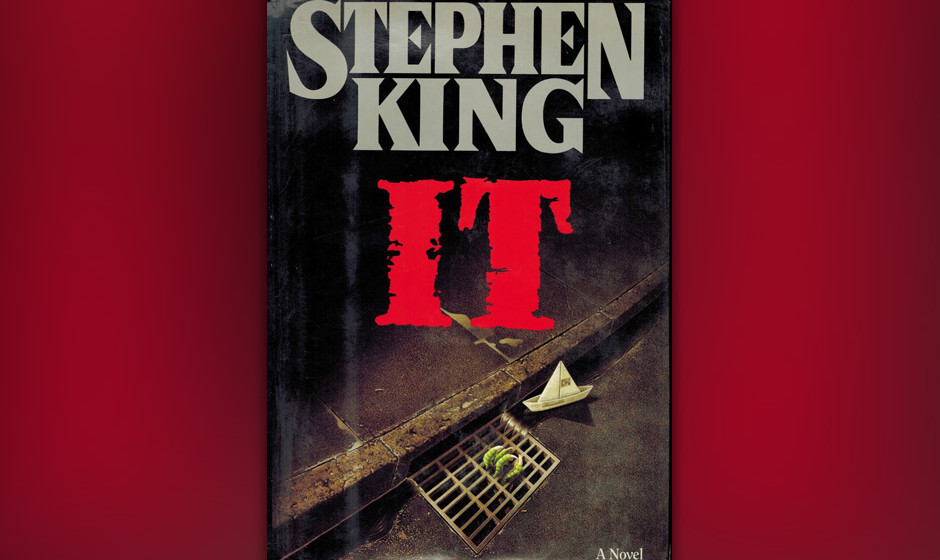„The Beast“ – quo vadis, KI?
Bertrand Bonellos Sci-Fi-Film stellt das Verhältnis des Menschen zur KI auf den Prüfstand

Künstliche Intelligenz war in der Kinogeschichte stets ein unerschöpfliches Thema. Vor allem eingesetzt als Antagonist strebte sie schon 1968 in Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ oder 1999 in „Matrix“ danach, den Menschen zu unterwerfen. Filme wie „Blade Runner“ (1980), „Her“ (2014) oder „Ex Machina“ (2014) verfolgten dagegen eine differenzierte Darstellung und probierten in ihren Geschichten, das Wesentliche unserer Existenz im Gegensatz zum maschinellen Denken herauszuarbeiten. Bertrand Bonello („Saint Laurent“, „Coma“) bedient diesen Diskurs mit „The Beast“ ein weiteres Mal.
Emotionen – die Wurzel allen Übels
Der auf der Kurzgeschichte „The Beast in the Jungle“ (Henry James) basierende Sci-Fi-Film präsentiert dabei ein Szenario, das dem von Kurt Wimmers „Equilibrium“ (2002) ähnlich ist. In einer semi-dystopischen Zukunft im Jahr 2044 gelten menschliche Emotionen als Hindernis, dem man sich entledigen muss. Nur dann könne man – wie KI-gestützte Programme – als produktive Arbeitskraft eingesetzt werden. Semi-dystopisch ist die Welt deshalb, weil man sich freiwillig in eine Pariser Klinik begeben kann (und nicht wie in „Equilibrium“ zur Unterdrückung seiner Gefühle gezwungen wird), um eine sogenannte „Reinigung“ zu vollziehen. In gedanklichen Zeitreisen sollen die „Patienten“ Traumata vergangener Leben, die tief in ihrer DNA verankert sind, erneut erfahren. Unterstützt werden sie bei der Reflexion der Ereignisse durch Menschen, die diesen Prozess bereits durchlaufen haben und ein völlig gefühlsneutrales Dasein führen.
Von irrationalen Menschen und ausdruckslosen Puppen
Die Handlungsstränge auf drei unterschiedlichen Zeitebenen, in denen sich Gabrielle Monnier (Léa Seydoux) und Louis Lewanski (George MacKay) immer wieder als verzweifelte Verliebte oder pathologisch Besessene begegnen, zeigen hauptsächlich die menschliche Irrationalität auf, die in der Zukunft ausgelöscht gehört. Allegorisch schwingt aber zusätzlich mit, wie das Künstliche und damit Emotionslose Schritt für Schritt Besitz vom Leben der Figuren ergreift. Im besitzbürgerlichen Paris um 1910 sind die Puppen aus der Fabrik von Gabrielles Ehemann Georges ein reines Spielzeug, das, wie sie Louis auch mimisch demonstriert, zu nicht mehr fähig ist als einem neutralen Blick. Doch 2014, in ihrem Haus in Los Angeles, ist eine Puppe mit eingebauter Sprachfunktion bereits mehr als nur ein Spielzeug und leistet ihr Gesellschaft. Und in der Klinik werden die zu Behandelnden schließlich von Leuten betreut, die eher Puppen in einem humanoiden Gewand sind als lebendige Personen.

Eher bedeutungsschwanger als bedeutungsstiftend
Insgesamt täuscht die erzählerische Mischung aus Liebesdrama, metaphysischen Konzepten und spirituellen Vorstellungen von Wiedergeburt aber leicht über die etwas standardmäßige Botschaft Bonellos und seiner Ko-Autoren Guillaume Bréaud und Benjamin Charbit hinweg: nämlich dass menschliche Empfindungen und aus ihnen resultierende, oft schmerzliche, aber dafür wahrhaftige Fehler uns vom artifiziellem Denken abheben. In den zweieinhalb Stunden Laufzeit wird diese Aussage in unzähligen, häufig bilingual geführten Dialogen (die so vielleicht ein größeres Publikum erreichen) eine Spur zu oft und eine Spur zu bedeutungsschwanger wiederholt.
Auch wenn „The Beast“ mit seinem ambivalenten Ende doch wieder ein wenig offen lässt, ob wir diese Position auch noch in den nächsten Jahrzehnten behaupten können, liefert er hauptsächlich visuell innovative Betrachtungspunkte, wie sich unser Bewusstsein von den Algorithmen künstlicher Intelligenzen überhaupt noch unterscheidet. Lautet unsere filmische Antwort auf diese philosophische Frage künftig weiter so wie hier, könnte man sich wirklich fragen, ob irgendeine KI bald einen besseren Ansatz findet.