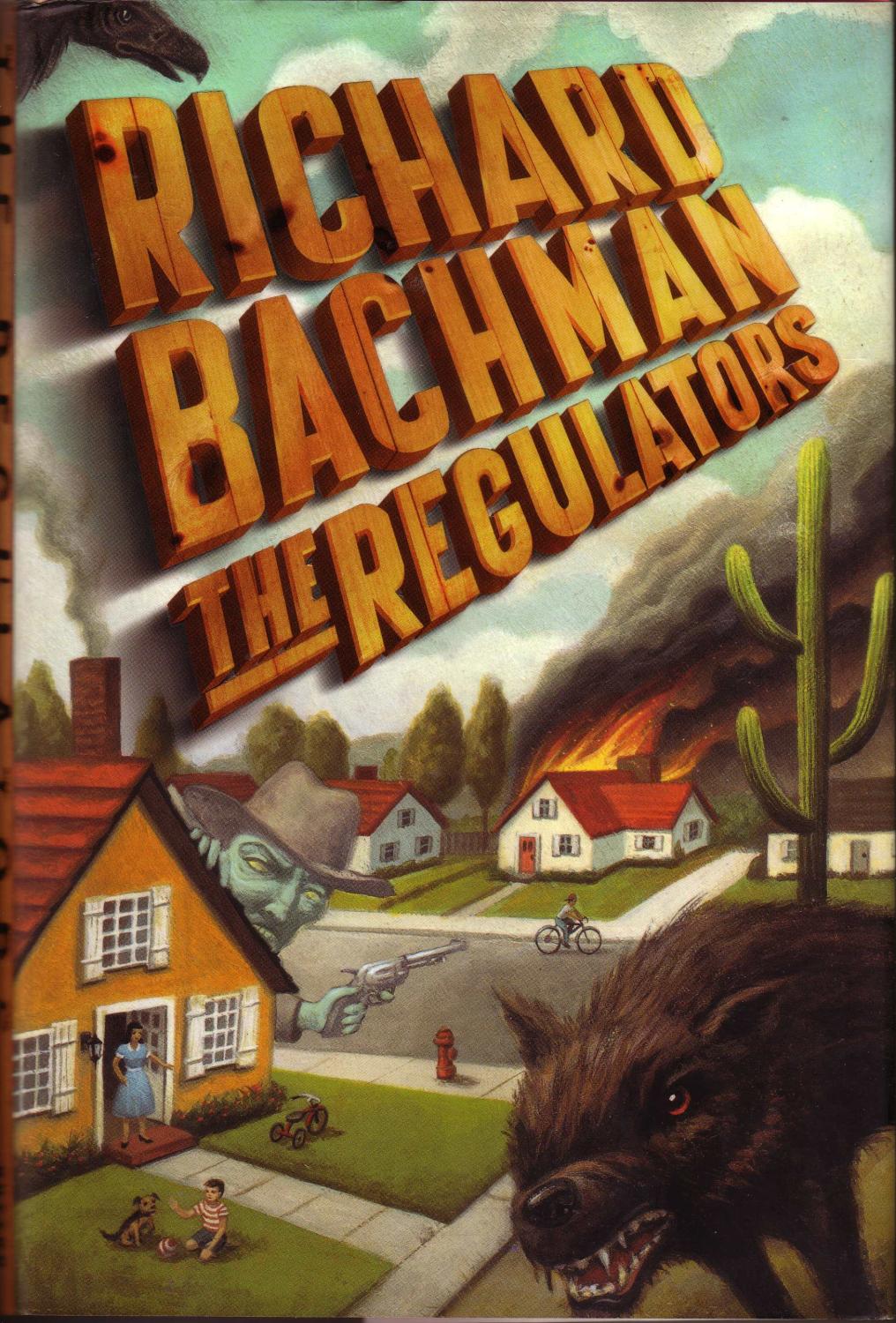Kritik: Stephen King triumphiert mit „Billy Summers“
Ein Auftragskiller soll selbst zur Strecke gebracht werden. Der atemlos erzählte Thriller „Billy Summers“ kommt nahezu ohne übernatürliche Elemente aus – das leistet sich Stephen King selten. Der 73-Jährige sollte sich das öfter zutrauen.

Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 82-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
Billy Summers
Die Rezension enthält kleine Spoiler
Stephen King ist befreundet mit Lee Child, dem (Ex-)Buchautor der phänomenal erfolgreichen und phänomenal guten „Jack Reacher“-Reihe. In seinem Roman „Under The Dome“ von 2009 schenkt er dem ehemaligen Militärpolizisten Reacher sogar eine staatstragende Erwähnung. Nach quittiertem Dienst bestraft Reacher als Amerika-Wanderer die bösen Typen, auf die er zufällig trifft, obwohl er eigentlich das Land bereisen will. Nun huldigt King mit Lee-Child-Sätzen erneut dem einsamen Wolf Jack Reacher, einem Mann, der überall ein Fremder bleibt, und der am Ende seiner vielen Abenteuer stets an eine Weggabelung kommt, wo er den Daumen rausstreckt, um mitgenommen zu werden. Kings Protagonist Billy Summers sagt: „Ich will nach Westen oder Norden, beides ist okay. Nur Süden und Osten kommen nicht infrage. Da war ich schon, das kenne ich.“
Vielleicht also kein Zufall, dass King mit „Billy Summers“ einen Roman geschrieben hat, dessen Titel nicht-deskriptiv ist, sondern sich auf die Erschaffung einer Figur zu konzentrieren scheint, dessen Name allein schon von etlichen Leidensgeschichten und Dramen erzählen soll, wie der von Reacher. Und ja, das ist ihm gelungen: Billy Summers ist eine solche Figur, wie es sie im Schaffen des 73-jährigen Schriftstellers schon sehr lange nicht mehr gegeben hat. Komplex, von Selbstzweifeln zerfressen, und doch einem schlichten moralischen Kompass folgend, der sich nicht mehr korrigieren lässt.
Billy Summers ist ein Ex-Soldat in seinen Vierzigern, der für seinen Einsatz im Irak-Krieg als begnadeter Scharfschütze hoch dekoriert wurde. Mittlerweile arbeitet er als Auftragskiller, aber nur, diese moralischen Einschätzungen nimmt er selbst vor, um die „bösen Menschen“ zu töten, nicht die „guten Menschen“. Er erledigt per Kopfschuss einen verurteilten Mörder, kurz bevor der im Gericht einen Deal aushandeln kann, der ihm den elektrischen Stuhl erspart. Summers ist ein sehr intelligenter, schnell kombinierender Mann – auch das hat er mit Jack Reacher gemein – und ahnt, dass er selbst nach dem Mordauftrag erledigt werden soll. Summers taucht nach getaner Arbeit ab und will nun herausfinden, wer ihn ausschalten wollte, und warum.
Kings Problem mit weiblichen Figuren
King macht nicht viel falsch in „Billy Summers“. Wer sich erfolgreich ferngehalten hat von der Beschreibung des Roman-Kurzinhalts durch den Verlag, müsste zunächst befürchten, die Story endet mit dem Gewehrschuss aus einem Hochhausfenster und dessen akribischer Vorbereitung, also einer Art „63/11/22“ light, in dem King minutiös die Vereitelung des Anschlags auf John F. Kennedy schildert. Aber Summers erledigt seinen Job so schnell und unzweifelhaft, wie auch der Autor ihn abhakt.
Die kleinen Schwächen des Romans sind andere. Schwächen, die in den King-Büchern ab den Nullerjahren häufiger zu finden sind. King wird sie vielleicht auch nicht mehr ablegen können. Erstens, er ist bemüht weibliche Figuren zu konstruieren, die aus einer existenziellen Krise stärker hervorgehen – das Wort „Selbstermächtigung“ ist auch im Feuilleton seit Jahren hip –, aber jede seiner Protagonistinnen (Lisey und Holly Gibney zählen zu den bekanntesten) ist stark nur durch die Gnade eines Mannes, der sie aufbaut. Hier die 21-jährige, vergewaltigte Alice, der Summers außerplanmäßig Unterschlupf in seinem Versteck gewährt, und die erst durch den älteren Mentor – in den sie sich verliebt – zur selbstbestimmten Frau wird. In einer selten so deutlich bei ihm vorkommenden Formulierung bringt King zum Ausdruck, dass er selbst mit der Vorstellung hadert, den ihn so quälenden, angeblichen Widerspruch aufzulösen, dass eine Frau potent sein, aber auch ohne den Mann ihren Sinn im Leben finden könnte. Denn: „Die Möglichkeit dazu hat Billy ihr eröffnet. Alice ist angekommen. Sie hat sich gefunden.“ Ohne Billy kein Ziel.
Die zweite Erzählschwäche besteht darin, dass King sich seit Jahren an den republikanischen US-Präsidenten abarbeitet, aber manchmal das Maß zu verlieren droht. Zu Beginn des Jahrtausends war das George W. Bush, ab 2016 Donald Trump. Grundsätzlich ein ehrenvoller Job: Mit dem Bewusstsein, als Schriftsteller Millionen Leser erreichen zu können, schäbige Staatsoberhäupter kritisieren. Aber wie schon im „Institut“ oder im „Dome“ betreibt King ein Namedropping, das bisweilen zum bloßen Symbolismus verkommt. Bevor Summers einen Vergewaltiger niederschlägt, setzt er sich eine Melania-Trump-Maske auf; ein krimineller Immobilienbesitzer trägt eine MAGA-Mütze; Summers verkleidet sich als Mexikaner, um in die Villa eines neureichen Verräters zu gelangen (nicht ohne Grund wollte Trump eine Mauer bauen, um genau sowas zu verhindern!); außerdem gibt es einen Medien-Mogul, dem anscheinend der rechte Sender „Fox News“ gehört, und dessen Alter und Physis an Rupert Murdoch erinnern (der inzwischen immerhin ein Trump-Gegner ist), wobei dessen Lebenswandel jedoch unzweifelhaft an Jeffrey Epstein angelehnt ist. Der Milliardär betreibt einen Prostitutionsring mit minderjährigen Opfern. So charakterfest Kings Anliegen ist – die Vehemenz, mit der er seit Jahren diese fiktiven Stellvertreter echter Scheusale angeht, lenkt von der Geschichte ab.
Eine in Kings Schaffen beispiellose Aktion eines Anti-Helden
Einen pädosexuellen Verbrecher töten zu wollen, fällt Billy Summers nicht schwer, der Täter ist „ein böser Mensch“. Der Pädosexuelle ist das größte Monster unter den Menschen. Mit Summers hat Stephen King jedoch eine seiner wenigen Figuren kreiert, deren eigenes Tun nicht nur ambivalent erscheint. Es bleibt auch bis zum Ende der Geschichte unklar, wie er selbst zu seinem Anti-Helden steht. Gute Menschen dürfen leben, schlechte Menschen sollen sterben, und sei es durch Selbstjustiz. Ein Vergewaltiger wird von Summers selbst vergewaltigt – eine in Kings Schaffen beispiellose Aktion eines Anti-Helden.
Das ist für Summers keine rationale Entscheidung. Der Ex-Marine ist seit seiner Kindheit schwer traumatisiert. Während die USA seit Jahrzehnten über strengere Waffengesetze diskutieren, ist es hier eine Waffe im Privatbesitz, die dem jungen Billy in Notwehr das Leben rettete. Danach kommen die Kinderheime. King verteidigt Summers nicht, und Summers fühlt es selbst: „Er ist nicht besser als diese Typen, sieht den Balken im eigenen Auge nicht, aber es bringt nichts, so etwas zu denken.“ Viele seiner bald 100 Bücher hat King durch inhaltliche Querbezüge verbunden, und auch bei „Billy Summers“ gibt es einen Bezug (wir spoilern ihn nicht), der aufzeigen soll, warum Billy so wurde, wie er ist. King führt damit auch ein übernatürliches Element ein, das zunächst abstrus erscheint. Aber so, wie Billy ein missbrauchtes Kind in einer dysfunktionalen Familie war, so ist auch der Junge aus dem anderen Roman, auf den King anspielt, ein missbrauchtes, das der Familie entkommen muss.
Billy Summers ist ein psychisch kranker Mann, Stephen King schreibt das so nicht, aber gerade durch seine so untypische Distanz zu ihm als Hauptfigur erweckt der Auftragskiller große Sympathien. Es ist Summers‘ Wegbegleiterin Alice, die sich, so wie er, der Schönheit von Literatur hingibt; dem quasi-magischen Gedankenvorgang, dass wir durch das Lesen neue Welten erschaffen. Beide, Summers und Alice, schreiben ihre (gemeinsame) Geschichte auf und konstruieren so für sich ein schöneres Leben, ohne Tod und Flucht.
Der Beginn einer neuen Phase?
Wann hat Stephen King das letzte sehr gute Buch geschrieben? Zuletzt musste man Angst haben, aber nicht wegen dem, was in den Büchern steht, sondern Angst um King – ob er seine Story rund und ohne Logiklöcher nach Hause bringt. Das war ihm in den letzten Jahren so gut wie nie gelungen. „The Outsider“ (2018) entwickelte sich von einem verschachtelt konstruierten Whodunnit zu einem Creature Feature, und „Das Institut“ (2019) scheiterte mit seinem Versuch, den Missbrauch PSI-begabter Kinder als Allegorie auf die Ermordung von Kindern in Konzentrationslagern darzulegen. Bei jedem jüngeren Roman die bange Frage also, ob King die Fäden am Ende zusammenhalten kann.
In „Billy Summers“ kann das nicht passieren, nicht nur, weil es einen halfway plot switch gibt, essenzielle Charaktere erst ab der Mitte des Romans vorgestellt werden. Mit den „Reacher“-Romanen hat „Summers“ weiterhin gemein, dass hinter einem verbrecherischen Plan eine Verschwörung, und hinter dieser Verschwörung eine noch größere Verschwörung steckt. Lee Child kreiert dabei unzählige Twists, also Überraschungen, deren Grundlagen – bestimmte Charaktere, Orte, Pläne – schon früh in der Geschichte ausgebreitet, aber nur angedeutet werden. Am Ende der Knall, die Offenbarung. King macht das nicht – vielleicht kann er es auch nicht: Es gibt in „Billy Summers“ einige Überraschungen, aber sie kommen aus dem Nichts.
Das letzte große Stephen-King-Jahr war 2014, als er mit „Mr. Mercedes“ und „Revival“ zwei bedeutende Romane veröffentlichte. Das eine die unheilvoll prophetische Geschichte über moderne Formen des Terrorismus (Bombenanschläge bei Teenage-Pop-Konzerten, das Auto als Mordwaffe in großen Menschenmengen), das andere eine höchst gruselige Oldschool-Erzählung, angelehnt an Poe und Lovecraft, über die buchstäbliche Hölle, die uns im Jenseits erwarte. Mit dem „Mr. Mercedes“-Ermittler Bill Hodges stellte King erstmals einen Ex-Detective in den Mittelpunkt gleich einer Roman-Trilogie. Er scheint im höheren Alter zunehmend Gefallen an Kriminal- statt Horrorgeschichten zu finden. Er sollte sich darin, das zeigt „Billy Summers“, weiter probieren.