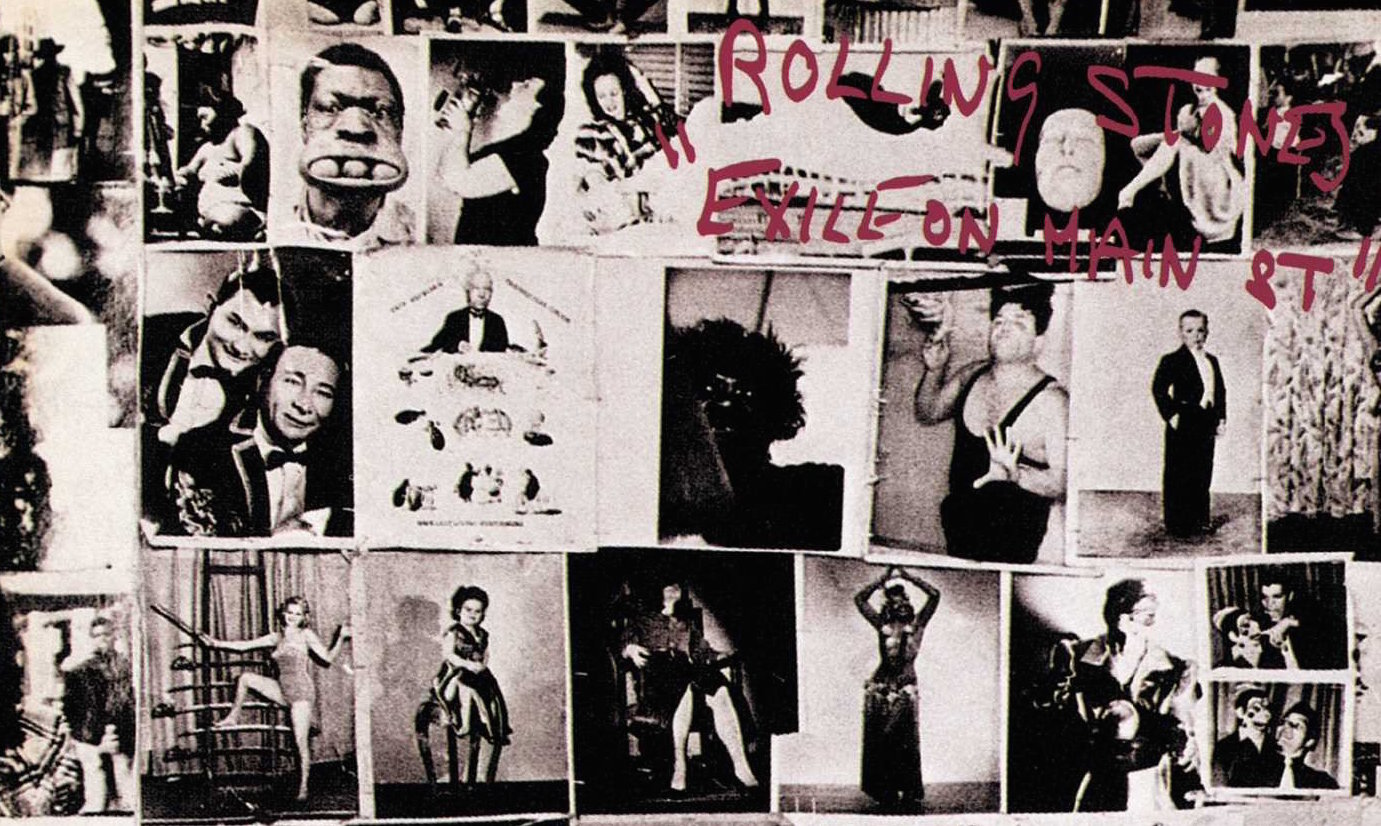„Skunk“ – Zerstörte Kindheit
In einem der ernsteren Filme des Fantasy Filmfests 2024 geht es um unverarbeitete Traumata und das Leben im Jugendheim.

Zum 38. Mal findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 25. September das Fantasy Filmfest in Berlin statt. Im Zentrum stehen Fantasy-, Horror- und Thriller-Filme, die gerne einmal auf das unterhaltsame Morbide setzen.
Auch dieses Jahr schmücken sich einige der eingereichten Filme mit expliziter Gewalt und nicht ganz ernstzunehmenden Geschichten über Toilettenmonster. Auch Konflikte zwischen Wrestlern und Satanisten werden gezeigt. Einen ganz anderen Anspruch verfolgt der belgische Autorenfilmer Koen Mortier. Er wagt sich mit „Skunk“ an die Adaption des gleichnamigen Romans von Geert Taghon.
„Jedes Kind hat eine Geschichte zu erzählen“
Darum geht es: Liam (Thibaud Dooms) wächst am Rande einer belgischen Kleinstadt in einem verwahrlosten Haushalt auf. Von seinen Eltern wird er regelmäßig verprügelt und im Keller eingesperrt, häufig wird er Zeuge ihrer ausschweifenden Sexorgien. Sein Leidensweg endet auch dann nicht, als er in einem Jugendheim mit anderen Teenagern landet, von denen einige noch verhaltensauffälliger sind als er. Am gefährlichsten ist Momo (Soufian Farih), der seine Mitmenschen bedroht und sie gefügig machen will. Die drei Sozialarbeiter der Einrichtung, Pauline (Natali Broods), David (Boris Van Severen) und Jos (Dirk Roofthooft), probieren zwar, die Gruppe schrittweise in ein neues, friedliches Leben zu integrieren, sind allerdings mit den sich ereignenden Wutausbrüchen, Konflikten und Schlägereien überfordert.

Seit seinem Langfilmdebüt „Ex Drummer“ (2007) stellt Mortier immer wieder gesellschaftliche Randgruppen ins Zentrum seiner Geschichten, deren Leben allesamt von Gewalt, Ausgrenzung und psychischer Belastung geprägt sind. Nach Menschen mit Behinderung, Prostituierten und Anschlagsopfern ist die nächste sozial isolierte Figur, die der Belgier in den Blick nimmt, nun also ein misshandelter Jugendlicher. Vor Beginn des Films wendete sich der Regisseur mit einer Videobotschaft an das Kinopublikum und stellte klar, welche Ambition sein Werk verfolgt: „Es soll Unbehagen auslösen und zum Nachdenken über Kinder in Not anregen. Das ist keine Fantasie. Das ist eine verdammt harte Realität.“
Diesen Realitätsanspruch merkt man „Skunk“ an. Durch das körnige 16 mm-Filmmaterial und die sich dynamisch durch Räume bewegende Handkamera entsteht eine Dokumentarfilm-Ästhetik, die dem Zuschauer immer das Gefühl gibt, Menschen in Bewegung zu sehen. Sie flüchten vor anderen, oder vor sich selbst. Kameramann Nicolas Karakatsanis fokussiert hierbei insbesondere die Körper, Gesichter und Bewegungen aller Protagonisten und geht dafür mit Panoramen der Umgebung eher sparsam um. Die Handlungsorte sind auffällig unauffällig in Szene gesetzt, von Gebäuden (mit Ausnahme von Liams Zuhause) sieht man oft nur einzelne Mauern oder Eingänge, der Horizont der Kleinstadt verschwindet im unscharfen Hintergrund eines Krankenhausfensters. In deutlich mehr Momenten steht Liam im Mittelpunkt der Einstellungen, wodurch er eingeengt und ängstlich anmutet. Grob komponierte Bilder und entsättigte Farben spiegeln seine Tristesse und Hoffnungslosigkeit.
„Skunk“ zeigt ein Martyrium ohne Erlösung
Doch schafft es Mortier auch, die schwierigen Themen Kindesmisshandlung, Zerstörung individueller Existenz und Resozialisierung angemessen zu fassen? Der Film nimmt sich Zeit, mit vielen kurzen Sequenzen ein umfassendes Kaleidoskop im Leben seiner Figuren zu zeigen. Die Jugendlichen treiben Sport oder schauen gemeinsam Fußball. Sie betätigen sich handwerklich oder sollen durch den Kontakt mit Pferden sensibilisiert werden.
In den sehr kurzen Abschnitten wird stets eine bestimmte Idee transportiert: Liam ist innerlich abgestumpft, Momo ist ein Sadist, die Sozialarbeiter sind teilweise machtlos. „Skunk“ erforscht, wie die unsozialen Jugendlichen nach Ventilen für ihren Frust suchen. Rückblenden in die Kindheit verstärken diese bedrückende Sicht auf ein Leben ohne Chance auf Teilhabe noch. Das vergangene Martyrium unter Liams Eltern, der sexuelle Missbrauch durch Momo im Heimzimmer aber auch die abweisende Reaktion Paulines, als er ihr seine Liebe gesteht, sind die Rechtfertigung seines Amoklaufs in den letzten 15 Minuten des Films.
Weil die Dramaturgie wegen der ansonsten nur lose zusammenhängenden Momentaufnahmen allerdings so unstetig ist, kommt die finale Eskalation plötzlich und wirkt durch ihre übertriebene Splatterhaftigkeit fast etwas absurd. „Skunk“ funktioniert als Film gut, wenn er sich die Zeit nimmt, seine Figuren atmen zu lassen. In vielen Fällen heißt das, dass sie einfach verzweifelt sind. Es ist schwer, kein Mitleid zu haben, wenn Liam zum ersten Mal in einem Therapiegespräch seine unterdrückten Emotionen herauslässt und vor Pauline in Tränen ausbricht.
In diesen Fällen hält „Skunk“ schonungslos drauf, zeigt ohne große Schnitte ungefiltert, was passiert. Mortiers Film wirft einen rauen Blick in menschliche Abgründe, vergibt aber ein wenig die Chance, mit mehr und etwas längeren, emotionaleren Sequenzen das Leid seiner geschundenen und schindenden Protagonisten noch greifbarer zu machen.