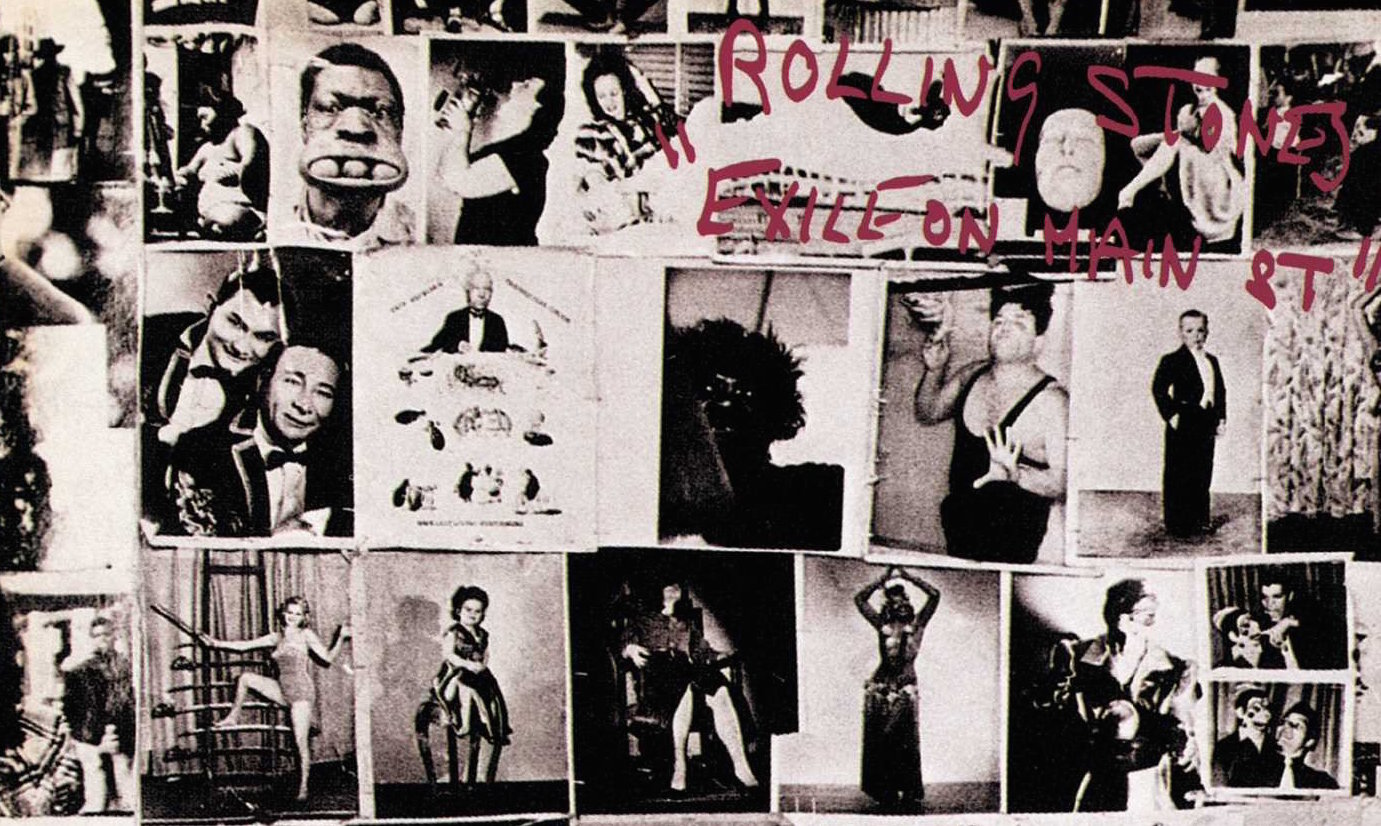Guillermo del Toro :: Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers
Guillermo del Toros Märchen über die Liebe einer Frau zum einer Kreatur weckt nicht nur wunderschöne Erinnerungen an alte Monsterfilme. Es ist auch ein Drama über sexuelle Selbstbestimmung in einer Männergesellschaft.

„The Shape Of Water“ – „Bester Film“ bei den Oscars 2018! Alle Gewinner hier.
Die Kritik beinhaltet Spoiler.
Es ist schwer zu entscheiden, was „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ vor allem ist. Eine Hommage an ein Genre? Ist es eine Hommage an ein Zeitalter, oder eine an den Zauber des Kinos an sich? Vielleicht ein Kommentar zur sexuellen Selbstbestimmung?
Es ist alles drin, und das ist auch ein persönlicher Triumph für Guillermo del Toro. Endlich wieder. Hollywood schien ihn verschluckt zu haben. Zuletzt wurde der Mexikaner mit schematischem Horror („Crimson Peak“) und Riesenmonster-Trash („Pacific Rim“) beauftragt. Dieser Film ist keine Auftragsarbeit, sondern ein Herzensprojekt, mit eigenem Drehbuch, jahrelang daran gefeilt.
Das macht sich bezahlt. In nur zwei Stunden Spieldauer erhält jede Figur, von der Heldin Elisa (Sally Hawkins) bis zum KGB-Spion Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) und dem US-Army-General Hoyt (Nick Searcy) eine ausgeleuchtete, biografische Beziehung zum vermeintlichen Dschungel-Monster, das ihr aller Leben verändert. Für die einen ist die Kreatur aus dem südamerikanischen Fluss ein „Ding“, für andere ein „Kapital“, für Elisa ein Geschöpf mit Intelligenz und Gefühl.
Baltimore, 1963: Das Militär untersucht in ihrer geheimen Forschungseinrichtung eine Amphibie in Menschengestalt, oder, je nach Betrachtung, einen Menschen in Amphibiengestalt (Doug Jones, einer von del Toros Lieblingsschauspielern, unkenntlich maskiert). Putzfrau Elisa, seit Kindheit stumm, ohne sexuelle Erfahrung, aber mit großer Libido, verliebt sich in ihn. Nachdem sie erfährt, dass die Army den Mann sezieren will, plant sie dessen Befreiung. Auch russische Spione glauben Potential im Wesen zu erkennen, als Waffe gegen den Westen.
Musical statt Vietnam
Del Toro hat für Elisa und ihren Nachbarn Giles (Richard Jenkins) eine Amelie-Märchenwelt entworfen, eine Realitätsverweigerung inmitten riesiger Bücherwände und Katzen. Ihre Wohnungen liegen direkt über einem Kino, und in ihren Fernsehern laufen Musicals. Wenn die Nachrichten den Vietnamkrieg bringen, schalten die Träumer um. Bunte Tortenstücke warten auf ihren Tellern, verkauft vom pausbäckigen, freundlichen Bäcker.
Selbst das Ding aus dem Sumpf verliert sich in dieser cineastischen Welt – seine Flucht aus Elisas Wohnung endet abrupt im Kinosaal darunter. Wie gebannt schaut es auf die Leinwand und vergisst, dass es ein Gejagter ist. Als Elisa dann träumt, sprechen zu können, geschieht das im Tanz mit der Kreatur (vielleicht der einzige schwache Moment des Films: natürlich geschieht das im Traum, natürlich als Musical, und natürlich als „Nur er macht mich vollkommen, sieht mich, wie ich bin“).

Diese Blase muss irgendwann platzen, del Toro zeigt amerikanische Wirklichkeit. Der All-American-Konditor schmeißt den schwulen Giles, nachdem der ihm Avancen macht, aus seinem Laden; ein afro-amerikanisches Pärchen darf gar nicht erst darin Platz nehmen. Vielleicht kein Zufall, wie Olivia Spencer (zu sehen in der Rolle als Elisas Kollegin Zelda) auch in einem Interview anmerkte, dass es ausgerechnet ein homosexueller Mann sowie eine schwarze Frau sind, die in diesem Film am meisten reden. Sie haben keine Macht, aber Stimmen, die immer lauter werden.
Colonel Strickland (Michael Shannon) führt privat ein Musterleben seiner Zeit, Vorort-Siedlung, zwei Kinder, Cornflakes am Morgen, gefällige Ehefrau, Missionarsstellung, er hält ihr dabei den Mund zu, und er wünscht sich die Versetzung an einen ruhigeren Dienstort, sobald das „Ding“ erstmal getötet und untersucht wurde. In seiner Welt gelten Frauen nichts. Es ist ausgerechnet der Finger mit seinem Ehering, der Strickland von der Kreatur abgebissen wird. Und die Verwirklichung eines amerikanischen Traums, die der Soldat zuerst zögerlich, dann umso begeisterter angeht, machen die Fluchtkomplizen des Wesens zunichte: sein neuer mintgrüner Caddillac, ihm als die Zukunft verkauft, wird demoliert.

„Das Flüstern des Wassers“ erscheint manchmal wie ein Film im Film, die zwei finalen Shoot-Outs im Regen, einmal trifft es die russischen Spione, dann das Liebespaar, wirken wie den Kinodramen vergangener Zeit entnommen; die offensichtlichste Verneigung bietet natürlich das Design der Kreatur, angelehnt am „Schrecken vom Amazonas“ (Jack Arnold, 1954). Strickland selbst kommt gleich zur Sache, bevor wir Zuschauer es aussprechen könnten, und berichtet, man habe es im Amazonas gefunden.
Die Romanze zwischen Frau und Kreatur hätte in „Beauty and The Beast“-Seichtgebiete abdriften können, doch del Toro stellt sein „Monster“ nicht als verzauberten Menschen dar, der seine Hülle verdammt. Vielleicht trifft sogar etwas anderes zu: Elisa ahnt, dass ihre Menschengestalt Fassade ist. Schließlich lebt sie ihre Sexualität – Masturbation und Geschlechtsverkehr – nur unter Wasser aus. Als Findelkind wurde sie in der Nähe eines Flusses gefunden, sie ist stumm wie das Amazonas-Wesen, und die Narben an ihrem Hals sehen aus wie verkümmerte Kiemen.
Überlebt Elisa am Ende ihre Verletzungen? Man hofft es, aber ihre Szenen unter Wasser erscheinen als Märchen. Sie finden vor allem in der Vorstellung ihres Freundes Giles statt, der aus dem Off erzählt. Es ist eine fantastische Welt, in der auf wundersame Weise verschwommen bleibt, was Wirklichkeit sein könnte.