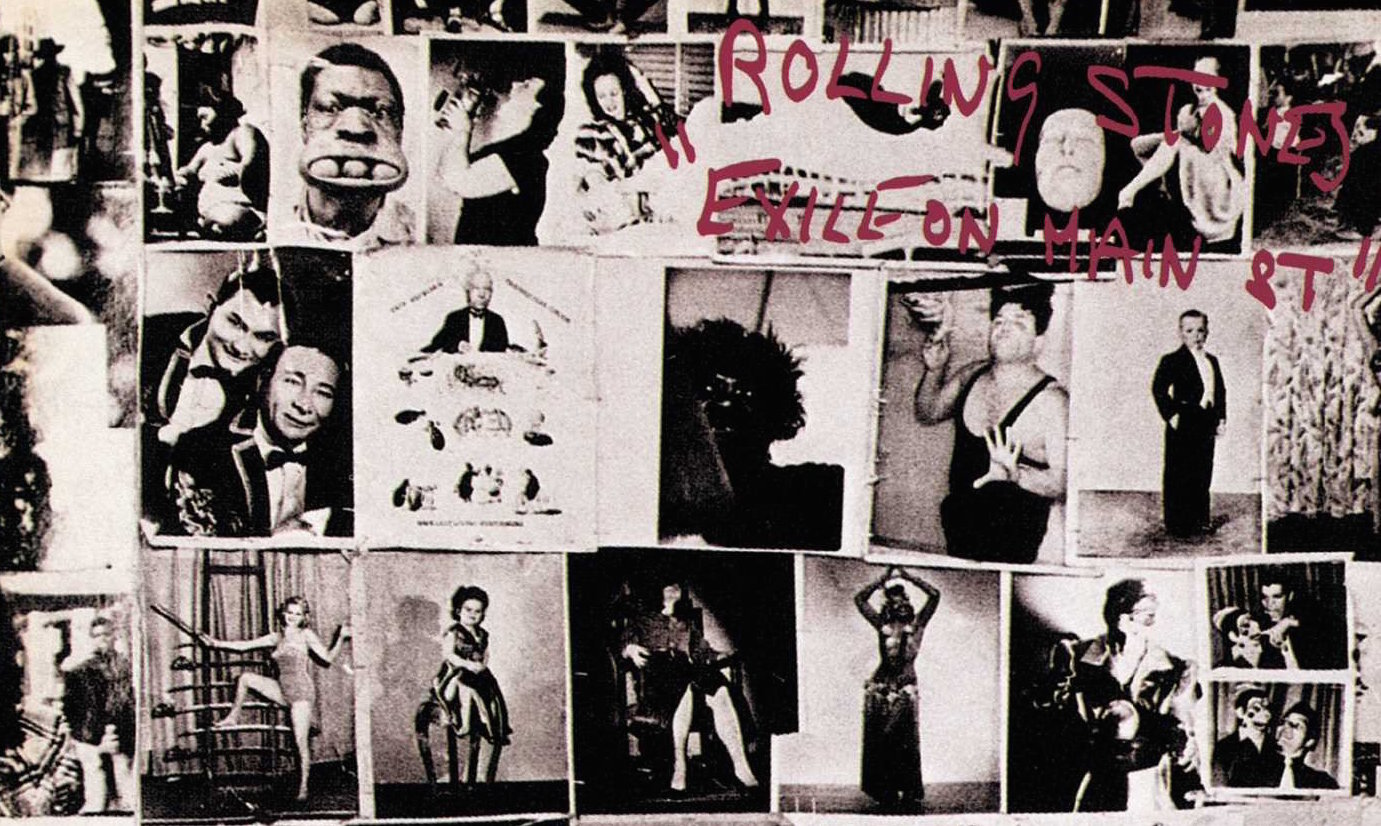Kritik: „Old“ von M. Night Shyamalan – Wie man glücklich stirbt
In M. Night Shyamalans Horrorfilm „Old“ altern Urlauber, die ihrem Strand nicht entkommen können, rapide – bis zum schnellen Tod. Wie nutzt man ein arg beschleunigtes Leben, um in Frieden zu sterben?

Die Rezension enthält Spoiler
„Ich brauche einfach noch etwas Zeit“, sagt die junge Frau zum jungen Mann, sie muss sich über ihre Gefühle klar werden. Ein klassisches Teenager-Gespräch. Dabei bleibt gar keine Zeit mehr. Das Mädchen alterte innerhalb weniger Stunden, es ist nicht mehr acht, sondern 14 Jahre alt. Geht es in dem Tempo weiter, erliegt sie am nächsten Morgen der Altersschwäche.
Eine Gruppe Urlauber wird von den Managern eines subtropischen Beach-Resorts an einen abgelegenen Strand geführt, wo sie einen schönen Nachmittag verbringen sollen. Aber sie werden von dort nicht mehr abgeholt, und sie können ihre Bucht nicht verlassen. Wer die zum Strand führende Höhle in die andere Richtung durchqueren will, wird ohnmächtig und erwacht wieder im Sand (wie eine Videospielfigur, die zurück zum ersten Level transportiert wird). Dann bemerken die Touristen neue Fältchen in ihren Gesichtern, und dem Sechsjährigen werden die Shorts plötzlich zu eng, weil er in die Höhe schießt. Eine alte Dame erliegt wenig später einem Herzstillstand; ein neugeborenes Baby stirbt sofort, weil es nicht die Kraft hat, rapide zu altern; die Kinder kommen sofort in die Pubertät und werden unberechenbar. Innerhalb der drei Familien entstehen Panik und Streit.
„Old“ ist eine Adaption des Graphic Novels „Sandcastle“ (2010) von Pierre Oscar Levy und Frederik Peeters. Ihre Story kommt ohne eine Erklärung des übernatürlichen Phänomens aus, alle Figuren werden alt und sterben. Die Leichen werden weggespült von den Wellen, so wie auch die Sandburgen, die sie gebaut haben. Regisseur M. Night Shyamalan, der erstmals eine gezeichnete Geschichte als Vorlage für einen Film benutzt, hat sich ein neues Ende überlegt, eines, das wir nicht spoilern brauchen. Beworben wird es als Twist (und Shyamalan gilt noch immer, 22 Jahre nach „The Sixth Sense“, als König der Twister). Dabei ist es kein Twist. Dass eine Geheimgesellschaft die in den Höhlen schlummernde Kraft für ihre Zwecke zu nutzen scheint, ist Teil der offenliegenden Geschichte.
Philosophische Exkurse sind nicht das Spezialgebiet Shyamalans, aber für seinen ersten Film, der nicht in Philadelphia oder den dunklen Wäldern Pennsylvanias gedreht wurde, hat er sich unter der Sonne der Dominikanischen Republik einige Fragen überlegt. Welche Erinnerungen und Erlebnisse machen ein Leben zu einem erfüllten Leben? Kann es auch unter solch alptraumhaften Bedingungen nicht zumindest ein wenig Glück bedeuten, seine eigenen Kinder noch als erwachsene Menschen zu erleben? Wie wichtig ist uns unsere Jugend, unsere Schönheit? Wie gelingt uns Entschleunigung – und erreichen Urlaube am Strand nicht eher das Gegenteil, machen sie alles nicht noch schlimmer, weil beim Rumliegen das Kopf-Kino erst recht losgeht?
Demenz als Geschenk
Eine Bikini-Mom mit Fitnesswahn (Abbey Lee) versteckt sich in der Höhle, weil sie ihre Runzeln nicht erträgt. Die Hauptfigur ist ein Mann, gespielt von Gael Garcia Bernal, der wohl nicht zufällig den simplen Rollennamen „Guy“ trägt. Er ist ein Schwächling, hat in der Notlage als einziger keine Survivalist-Ideen, und seine Frau Prisca (Vicky Krieps) denkt an Scheidung, weil sie eine Affäre unterhält. Am Ende des Tages, am Ende seines verkürzten Lebens also, sitzt Guy am Strandlagerfeuer und leidet an Altersdemenz. Er weiß nicht mehr, was überhaupt passiert ist, warum er im Sand sitzt, wie es ihn dahin verschlagen hat. Nur dass er seine Frau liebt, die ihm doch erst vor einer Stunde von dem anderen Mann in ihrem Leben erzählt hat. Demenz ist für ihn ein Geschenk.

Guy ist Versicherungsmakler, ein langweiliger Typ mit zwei linken Händen, aber die anderen Urlauber passen einfach zu gut in dieses Strandszenario, um Regisseur Shyamalan nicht doch einen mittlerweile gängigen Vorwurf machen zu können: Einige seiner Story-Wendungen wirken konstruiert und sind voller Logiklöcher. Unter den Touristen befindet sich ein Arzt (Rufus Sewell), er wird im Sand eine – von allen Anderen mit haarsträubender Selbstverständlichkeit assistierte – Operation ohne Narkose und per Taschenmesser durchführen, bei der ein Kokosnuss-großer Tumor entfernt wird. Eine Psychologin steht ihm zur Seite, um Konflikte zu deeskalieren, und ein Krankenpfleger weiß immer dann um besonnenen Rat, wenn Empathie wichtiger sein sollte als medizinische Fähigkeiten. Den Pfleger Jarin spielt Ken Leung, der in „Lost“ einen PSI-begabten Forscher verkörperte, und überhaupt gibt es einige Parallelen zu J.J. Abrams Mystery-Serie, die ebenfalls in einem Archipel angesiedelt ist. Die „Lost“-Insel weiß Krankheiten zu heilen, und in „Old“ fühlt eine Epileptikerin, dass es ihr seit des Aufenthalts am verwunschenen Strand doch eher besser als schlechter gehe.
All diese Leute altern nicht nur schnell, sie haben auch eine derart schnelle Auffassungsgabe, dass sie die Rätsel der Bucht früh erkennen und ihre Lebenserwartung innerhalb von Minuten zu definieren wissen. Alle denken laut. Alles wird für uns Zuschauer flugs verbalisiert. Die besten Drehbücher sind aber immer noch solche, deren Geschichte sich durch Handlung offenbart – nicht durch Vorträge.
Einige Geheimnisse bleiben ungeklärt, vielleicht ja ganz gut so. Ein Rätsel immerhin, das den Arzt umtrieb, lässt sich googlen: Wie der Film hieß, in dem Marlon Brando und Jack Nicholson gemeinsam zu sehen sind.