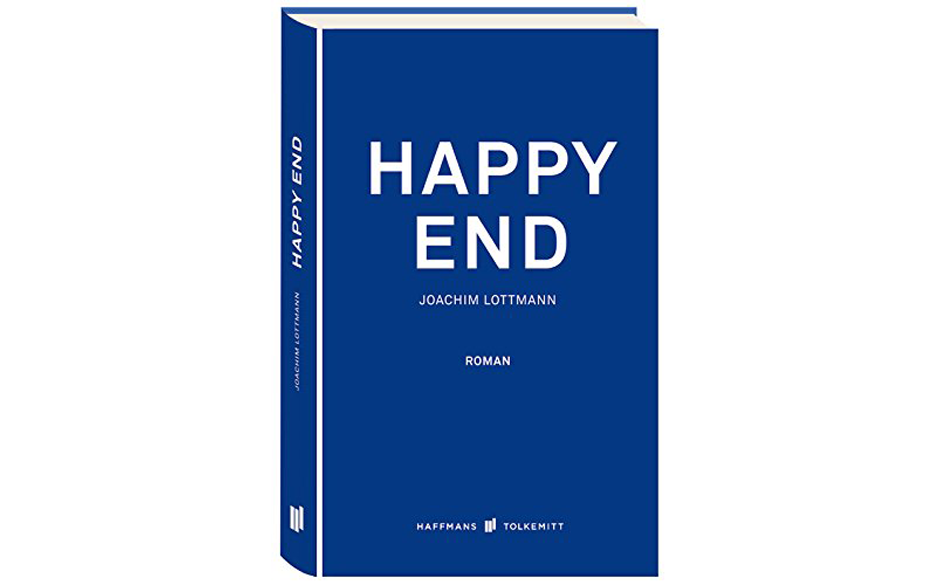Happy-End :: Joachim Lottmann
He, es gibt mich wirklich! Der selbst ernannte Erfinder der deutschen Popliteratur erklärt sich und tippt sein Meisterstück
Der Umschlag ist herrlich blau – so blau wie die letzten Bücher von Rainald Goetz. Das ist das Erste, was einem auffällt, wenn man sich den neuen Roman von Joachim Lottmann anschaut. Und das kann natürlich kein Zufall sein, zumal Goetz vorkommt in „Happy End“, genauso wie die auf dem Umschlagrücken mit Lobpreisungen für Lottmann nicht sparenden Kollegen Sibylle Berg, Matthias Matussek und Tex Rubinowitz, die innen drin übrigens nicht unbedingt von ihrer Schokoladenseite gezeigt werden.
Auch Goetz schont die Kollegen in seinen Büchern ja nicht. Was die beiden Autoren außerdem eint, ist, dass sie an der Gegenwart entlangschreiben. Doch während Goetz ganz penibler Beobachter und Chronist ist, gibt Lottmann den selten zuverlässigen Erzähler: Er erinnert sich öfter und absichtlich falsch, bringt die Faktenlage durcheinander und beeinflusst das Beobachtete meist, indem er selbst ins Geschehen eingreift. Zudem geht es bei Lottmann immer zuvorderst um Lottmann, auch wenn der Protagonist von „Happy End“ – ein Schriftsteller natürlich wie schon 2009 in „Der Geldkomplex“ – den Namen Johannes Lohmer trägt. Der herrliche, ebenfalls nicht ganz zuverlässige Text auf der hinteren Umschlagklappe stellt bereits die Identität von Autor und erzählendem Ich her: „Joachim Lottmann (* 1959 in Hamburg), bekannt geworden durch die unbeschwerlichen, luftig-leichten Romane der deutschen Popliteratur, als dessen [sic!] Erfinder er gilt, hatte in Wirklichkeit ein schweres Leben. Als ewiger Außenseiter des Literaturbetriebs litt er unter Anfeindung, Missgunst und extremem Geldmangel. Erst mit dem Thriller ,Endlich Kokain‘ gelang ihm 2014 der Durchbruch. Das Glück war nun zum Greifen nah. Ein Leben ohne Leiden. Wie das seines Protagonisten Johannes Lohmer in ,Happy End‘. Der heiratet die schönste Frau und gewinnt den Wolfgang-Koeppen-Preis. Schreiben kann er nun nicht mehr. Egal.“
Der Umschlag erzählt die ganze Geschichte und funktioniert zugleich als Manifest der schon sprichwörtlichen lottmannschen Oberflächlichkeit. Lohmer ist also verliebt und kann daher nicht mehr schreiben, weil man ja – da ist er mit allen Thomas-Bernhard-Figuren einer Meinung – Abgeschiedenheit und Unglück braucht, um eine Geistesarbeit verrichten zu können. Aber ein Romantiker ist er natürlich nicht, der Lohmer; nicht mehr schreiben zu können ist für ihn „eine feine Sache. Denn es bedeutet in Wirklichkeit, nicht mehr Schreiben zu müssen. Jeder echte Schriftsteller tut es ja ganz und gar aus Getriebenheit.“
Lohmer lebt (wie Lottmann und zeitweilig Bernhard, dessen Motive hier immer wieder aufscheinen) in Wien und hat (wie Lottmann) den Wolfgang-Koeppen-Preis bekommen, dessen Besonderheit darin besteht, dass der Ausgezeichnete den nächsten Preisträger bestimmen darf. Dummerweise liest Lohmer ungern Texte, die er nicht selbst geschrieben hat, und ist daher auf das Urteil seiner Frau angewiesen. Während die sich also durch die deutsche Gegenwartsliteratur liest und schließlich die Schwäbin Sara-Rebecka Werkmüller des Preises für würdig erachtet, tippt Lohmer schuldbewusst den Schriftsteller mimend vor sich hin und dokumentiert so die eigene Inspirationslosigkeit. Sein Lektor allerdings ist nach der Lektüre der ersten hingeschluderten Seiten begeistert, bescheinigt ihm, endlich zu sich selbst gekommen zu sein. Ermutigt schreibt Lohmer weiter, fährt mit Frau an die Amalfiküste, an den Sehnsuchtsort der Deutschen also. Hier fanden schon Walter Benjamin und Theodor Adorno zu sich und zu ihrer Philosophie, entwickelten aus ihrer Anschauung von Landschaft, Natur und Lebensart, der Durchdringung von Öffentlichem und Privatem und der Vermeidung des Definitiven den Begriff der Porosität. „Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht“, heißt es bei Benjamin, „keine Gestalt behauptet ihr ,so und nicht anders‘.“
Auch Lottmanns Text wird porös, changiert zwischen Lohmers privaten, jedoch für das nächste Buch gedachten Aufzeichnungen und ihren Verdichtungen und Umdeutungen in Feuilletonartikeln, die er für die „FAZ“ über seine Reise verfasst. Die Texte überschreiben und kommentieren einander. Lohmer beginnt überdies das jüngste Werk der von ihm zur Wolfgang-Koeppen-Preisträgerin erkorenen Sara-Rebecka Werkmüller zu studieren, die naturgemäß Ähnlichkeiten mit der von Lottmann vorgeschlagenen Anna Katharina Hahn aufweist. Schon das Autorenfoto gefällt ihm nicht, die gedrechselten Satzkonstruktionen bringen ihn zur Verzweiflung und führen zudem dazu, dass das Bild des idealisierten Lebensmenschen erste Risse bekommt, denn immerhin hat ihm ja seine Frau dieses aufgeblasene Machwerk empfohlen. Lohmer führt dann qua Imitation die Unsinnigkeit dieses literarisch gemeinten Schreibens vor und legt dabei seine eigene (und Lottmanns) Poetologie offen: „Meiner bescheidenen Literaturauffassung zufolge war ja das Leben eines jeden Menschen ein äußerst intensiver, todernster Kampf und somit objektiv spannender als jede blöde, weil ausgedachte Story im engen literarischen Sinn. Natürlich war ‚Madame Bovary‘ nur deshalb so gut, weil alles wahr war. Und alle meine Bücher sind schon deshalb ein Gewinn für den Leser, weil selbst die unbedeutendste Stelle etwas beschreibt, das es wirklich gibt. Es gibt nämlich mich.“
Und so muss auch die Preisrede auf die nach umständlichen Kontaktversuchen doch ganz sympathisch erscheinende Werkmüller vor allem von ihm selbst handeln. Am liebsten hätte Lohmer/Lottmann sich den Preis noch einmal selbst überreicht. Für „Happy End“ hätte er ihn auch verdient.