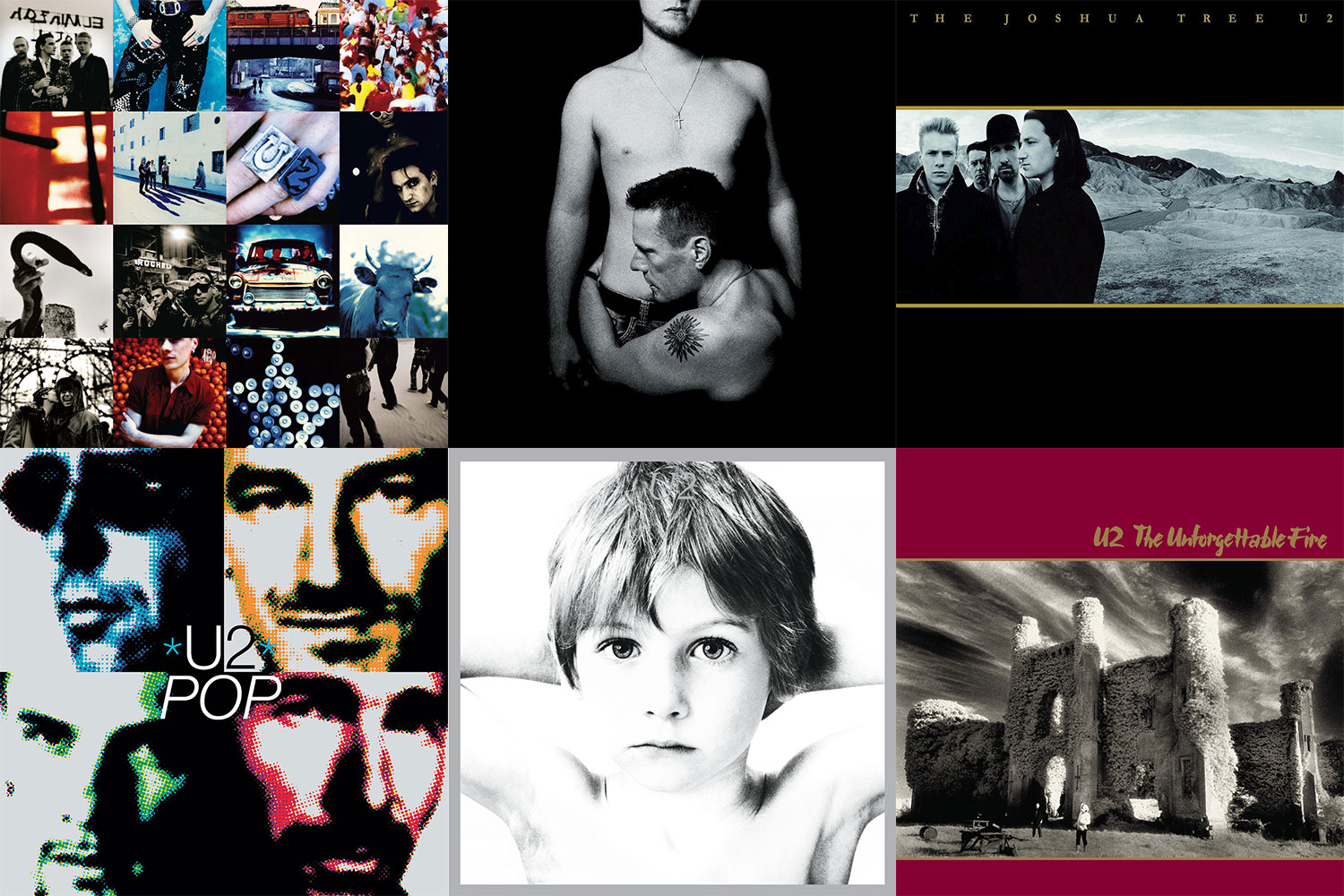Cursive
„Mama I’m Swollen“
Die ins formlose Dunkel blutende Abendsonne auf dem Cover führt nicht in die Irre. Lebensangst, Weltschmerz und tiefes Misstrauen allem Menschlichen gegenüber lauern hier im Übermaß, zehn noisige Lieder und 40 ermüdende Minuten lang. „We are the sons of butchers, all in all we are pawns, the darkness of mankind stirs in us all“, wirft Songwriter Tim Kasher in „Mama, I’m Satan“ freigiebig Asche auf jedes Haupt- eine etwas plakative Simplifizierung.
Kein Stein bleibt bei Cursives misanthropischem Rundumschlag auf dem anderen. Alles ist Hoffnungslosigkeit und Zweifel, an allem und an jedem. „I want to unlearn what I’ve learned.(…) I’d rather be on hands and knees“, erteilt der „Caveman“ der Zivilisation des Homo erectus eine Absage. „I hate this damn enlightenment, we were better off as animals.(…) Our words have found a death sentence“, räsoniert er gegen Erkenntnisgewinn und für hemmungslosen Hedonismus, „From The Hips“.
„It’s a contradiction that harms and heals/ It’s no big deal, it’s not worth losing sleep“, gibt er auch der Idee der romantischen Liebe eine brüske Abfuhr. Gewandt formuliert sind diese Tiraden und sogar literarisch verankert. Das „boom boom“ in „We’’e Going To Hell“ etwa pocht als Referenz an Poes „Das verräterische Herz“. Dennoch, vorgeblich Tiefsinniges wie „I’m at my best when I’m at my worst“ verortetete man eher in einem Teenager-Erguss als im Text eines 34-Jährigen.
Immerhin lädt Kasher seine Werke in der bedachtsam entworfenen Kakophonie seiner Band mit Hingabe auf. Während Bläser, Violinen und Synths den trägen Mahlstrom aus Gitarre, Bass und Drums auflockern, wispert, murmelt, ruft und kreischt er. „What Have I Done?“ schreit er unablässig im letzten und besten Song nach der deprimierenden Lebensbilanz: „I spent the best years waiting on the best years of my life.“ Insgesamt: anstrengend. Ich gehe jetzt mal in die Sonne. (Saddle Creek/Indigo)
Rüdiger Knopf