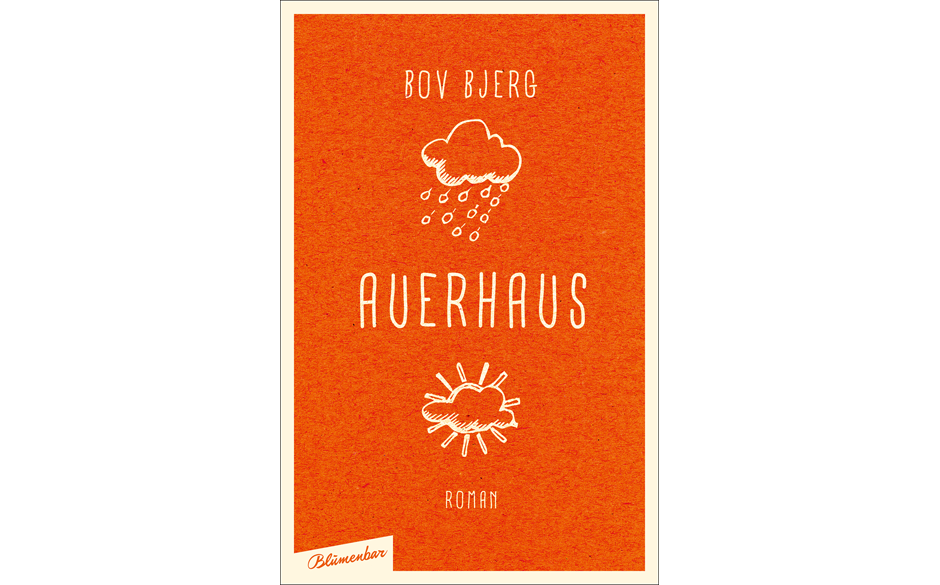Bov Bjerg :: Auerhaus

Es sind schon ein paar komische Stellen in diesem langen Prosablues über das Aufwachsen im Kaff, über die Melancholie, den Wahnsinn und die paar Jahre, in denen man wirklich lebt. Aber Bjerg, der Berliner Lesebühnen-Oldie, hält sich zurück und passt seinen Pointenausstoß souverän dem Stoff an. Frieder ist depressiv. Damit er nicht noch einmal Hand an sich legt, erlaubt man ihm und dem Icherzähler, kurz vorm Abitur eine WG aufzumachen. Noch ein paar andere, mehr oder weniger verpeilte Freunde finden sich ein, und eine Zeitlang entsteht im „Auerhaus“ – nach dem gleichklingenden Madness-Kracher, es sind die frühen Achtziger! – zwar immer noch keine Idylle, aber doch ein Ort, in dem man aufrechter geht und das Leben sich zu lohnen scheint. Ein kurzer Sommer der Anarchie. Bjerg hält sich Sentimentalität durch Lakonie und weitgehenden Verzicht auf Psychologisierungen vom Leib. Gelegentlich wären ein paar Streicher mehr durchaus effektvoller gewesen, aber das hätte das Teen-Ich, dessen juvenilen, moderat motzigen Tonfall der Autor ziemlich gut trifft, vielleicht Glaubwürdigkeit gekostet.