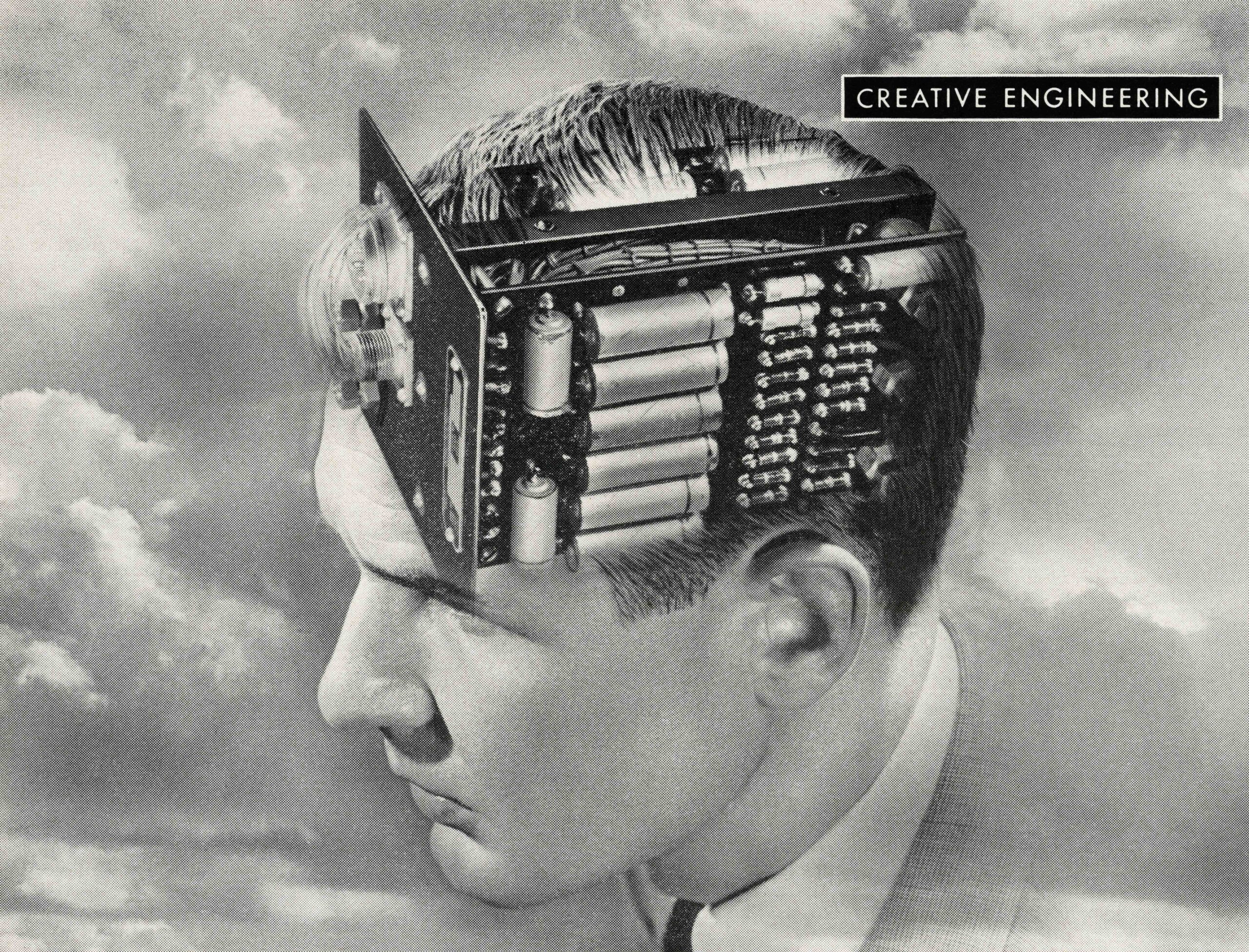Reeperbahn Festival: Spaß gemacht hat der Rummel auch dieses Jahr wieder
… Aber: etwas weniger offensichtliche Präsenz von radiofreundlichen Pop-Formaten würde der Vielfalt gut tun.
Am Samstag ging in Hamburg Europas größtes Club-Festival zu Ende. 45.000 Besucher*innen erlebten beim Reeperbahn Festival vier Tage lang ein internationales Angebot aus 800 Programmpunkten, davon 480 Konzerte von 450 Acts aus 35 Nationen, sowie 40 Lesungen, Live-Podcasts und Ausstellungen.
Wer dabei war, legt jetzt erst mal die Füße hoch und ruht sich aus. Denn das Entdecken von Newcomern und zukunftsträchtigen Themen ist eine kräftezehrende Angelegenheit. Die teilnehmende Clubs liegen zwar alle im Kiez von St. Pauli, aber natürlich nicht Tür an Tür. Da kommen jeden Abend schon ein paar Kilometer zusammen. Auch das Zusammenstellen des täglichen Musikmenüs erfordert Einsatzfreude und Vorausplanung – prominente Namen sind rar gesät, doch eine eigene App bietet Orientierung und Überblick.
Notorische Hipster und Szene-Typen hielten sich weitgehend zurück
Was nicht unwichtig ist, denn das Reeperbahn Festival ist – wie früher die Kölner Popkomm – auch Deutschlands größte Pop-Messe. 5.000 Fachbesucher drängelten sich auch diesmal wieder bei Networking-Events, Showcases, Award-Shows und Panels. Die Zahl der privaten Besucher war gefühlt jedoch eher rückläufig, notorische Hipster und Szene-Typen hielten sich weitgehend zurück. Avantgarde, Experiment und Underground werden anderswo besser bedient.
Im Festival Village auf dem Heiliggeistfeld vermischte sich schon tagsüber Marketing mit Newcomer-Förderung. Neben der ziemlich großen Fritz-Kola-Stage fand sich dort auch eine kleine TikTok-Bühne, wo ein einsamer Keyboarder vor geschätzt 12 Zuschauern traurig vor sich hin klimperte. Immerhin. Später wird einem noch eine Singer/Songwriterin begegnen, die ganz ohne Publikum in die Saiten greift.
Dazu der übliche Jahrmarktsbudenzauber, wenn es um die Herzen der Jugend geht: Die obligatorische Skateboard-Halfpipe, ein Infostand für das korrekte Viva-Con-Aqua-Wasser und der unvermeidliche Passbildautomat, für lustige Fun-Fotos. In einem durchsichtigen Plastikzelt namens „Glass House“ informiert das Netzwerk der Hamburger Musikwirtschaft über Karrierechancen im Business: „Wer von euch arbeitet in der Musikbranche?“, fragt ein Panel-Teilnehmer vom Podium herab das Publikum. Brav heben zwei Drittel der Zuhörer die Hand. „Prima! Und wer von euch verdient mehr als 50.000 Euro im Jahr?“ Keine einzige Hand geht nach oben – reich wird in dieser Branche offenbar keiner. Doch der alte Zauber ist scheinbar immer noch groß genug.
Vor dem alten Punkertreff Komet scherte man sich um Themen, wie Karriere, oder plötzlicher Reichtum durch Pop trotzdem nicht besonders. Hier trafen sich am Donnerstag die Vertreter der Hamburger Indie-Labels, die eher auf Zusammenarbeit und gute Musik setzen: Buback, Tapete, Glitterhouse, Sound of the Underground, oder der Ventil Verlag. Unter dem Motto „Treffen“ spielten danach einige Bands dieser Labels in Clubs, die nicht am Reeperbahn Rummel teilnehmen. Hafenklang, Golden Pudel, MS Stubnitz und weitere glauben eher an die Ideale einer von großen Musikkonzernen unabhängigen eigenen Szene. Dass das sehr gut funktioniert, zeigte unter anderen Die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen mit einen tighten und mitreißenden Auftritt im Komet.
Hundert Meter weiter, vor dem dunkelrot illuminierten Altar der St. Pauli Kirche – eine der schönsten und entspanntesten Location des Festivals – zelebrierte der belgisch-britische Sänger James de Graef, alias Loverman, eine charismatische Solo-Show. Und was für eine altmeisterlich große Stimme! Tief und voll, Scott Walker kommt einem in den Sinn, oder Nick Cave, mehr als eine Gitarre braucht der Mann nicht.
Fette Trap-Beats bei Sonnenuntergang
Kaum war man aus der Kirche raus, empfangen einen ultratiefe Bässe aus dem Park Fiction, einem Nachbarschaftspark mit Kunstanspruch und fantastischem Blick über Elbe und Hafen. Der Rapper Yungpalo steht mit Mikro auf einem Autodach, neben ihm zwei Kollegen, die immer wieder T-Shirts in die tobende Menge vor ihnen feuern. Lauter 18- bis 19-jährige Jungs, die jede Bewegung des Rappers in ihre Smartphones saugen. Fette Trap-Beats bei Sonnenuntergang, ganz ohne Türsteher und Taschencheck.
Die Bouncer nahmen ihren Job in diesem Jahr sehr ernst. Mit einer Tasche oder einem Rucksack, größer als Din-A-4, kam niemand rein. Sehr ärgerlich für die Betroffenen, denn in der großen Freiheit feierten Ibibio Sound Machine eine rauschende Disco-Party, mit Afro-Beat und Londoner Club-Sounds. Das koreanische Quartett Touched bot auf der großen Openair-Bühne am Spielbudenplatz derweil einen unglaublich perfekten und hybriden Rock-Sound. Ganz anders als die bekannten Boy- und Girl-Groups, wie Blackpink, die in Deutschland seit Jahren die Kinderzimmer erobern.
Stärker noch als Kanada, die Schweiz, oder Österreich, versucht Korea über das Reeperbahn Festival einen weiteren Fuß in den europäischen Pop-Markt zu bekommen. Nur dass die kanadischen Can-Fans von Yoo Doo Right die Sache deutlich wilder und dröhnender angehen. Ähnlich intensiv rockte nur das Berliner Trio Zahn und der Londoner Sam Akpro, der im Molotow mit seiner Band eine Mischung aus Rap und Post-Hardcore ablieferte, knochentrocken auf die Zwölf.
Das Nervige am Reeperbahn Festivals sind die vielen Touristen und Junggesellen-Abschiede, die hier am Wochenende mit hohem Alkohol-Pegel unterwegs sind. Längst hat sich das einst schwer romantisierte Viertel – von Hans Albers über Udo Lindenberg bis Jan Delay – zum Ballermann des Nordens entwickelt. Auch wenn Perlentaucher hier natürlich immer noch ihr Plätzchen finden. Den Mojo Club, zum Beispiel, der auch dieses Jahr wieder mit brillantem Sound und exzellent kuratiertem Programm punktet: Der dunkle Gothic-Folk von El Perro del Mar etwa, oder lasziv dahinfließende Songs von King Hannah. Schon am frühen Samstagabend brachte der Belgier Bolis Pupul das Mojo-Publikum zum kollektiven Durchdrehen und Arme in die Luft werfen, mit im DJ-Mix-Modus präsentiertem Electro-Funk, in der Tradition von Coldcut oder M|A|R|R|S.
Auf der anderen Seite der Reeperbahn, in einem alten Krimi-Theater namens Imperial, gab es danach die Jazzsängerin Reinel Bakole zu entdecken. Die Stimme wunderbar rau und wandlungsfähig, die Beats federnd und mellow.
Das vielleicht beste Konzert lieferte allerdings ein Vokal-Ensemble aus Südafrika. Die fünf gerade mal volljährigen Schulfreunde von The Joy sangen im Kaiserkeller fast ausschließlich A cappella, in der Gesangstradition des Volks der Zulu. Ein vor Energie, Lebendigkeit und Perfektion sprühender Auftritt! Das Publikum war außer sich, alle wippten, tanzten und hüpften herum.
Eher uninspiriert war der Auftritt des durch vier weitere Musiker verstärkten Duos Strongboi im Grünspan. An der charismatischen Sängerin Alice Phoebe Lou lag es bestimmt nicht, doch ihre Begleiter wirkten uninspiriert und lustlos, ein endloser Soundcheck vor Publikum nahm fast die Hälfte des Konzerts ein.
Ob die Jury ein anderes Konzert gesehen hat?
Und trotzdem wurden Strongboi einen Tag später mit dem Anchor Award ausgezeichnet. Ob die Jury ein anderes Konzert gesehen hat? Wir wissen es nicht.

Immerhin stand ein Jury-Mitglied – die amerikanische Sängerin und Songschreiberin Tayla Parx – wenige Stunden nach der Preisverleihung selbst auf der Bühne, in der eigentlich noch gar nicht offiziell eröffneten Georg Elser Halle. Die befindet sich im Feldstraßen Bunker, der nach einer mehrjährigen Aufstockung nun nicht nur ein begrüntes Hotel beherbergt, sondern, neben dem Uebel & Gefährlich, auch noch die doppelt so große Georg Elser Halle.
Die muss man sich aber erstmal erwandern – der Weg zum Eingang führt über einen steilen „Bergpfad“ hinauf, der sich einmal um den ganzen Betonklotz windet. Tayla Parx bietet dafür eine schwerst professionelle Ein-Frau-R&B-Show, ihr Gesang ist makellos, die Songs allesamt Hit verdächtig – schließlich schreibt sie schon seit Jahren für Kolleginnen, wie Ariana Grande, Mariah Carey, Alica Keyes, oder Janelle Monae. Leider war der 2000 Menschen fassende Saal nur von geschätzt 200 Zuschauern besucht, dafür gab es jede Menge Kameras und einen bombastischen visuellen Budenzauber, auf einer Multiplexkino-großen Leinwand hinter der Bühne.
Mein Eindruck vom Reeperbahn Festival 2024: Etwas weniger offensichtliche Präsenz von radiofreundlichen Pop-Formaten würde der Vielfalt gut tun. Auch die kulturwirtschaftlichen Ambitionen einzelner Länder könnte man etwas zurückfahren und dafür ein paar mehr Publikumsmagneten auf die Bühnen schicken. Die diesjährigen Großkaliber des Festivals – Trentemöller in der Elbphilharmonie, oder Noga Erez in der Großen Freiheit – waren vor allem deshalb vor Ort, weil sie neue Alben zu promoten hatten. Aber egal, Spaß gemacht hat der Rummel auch dieses Jahr wieder.