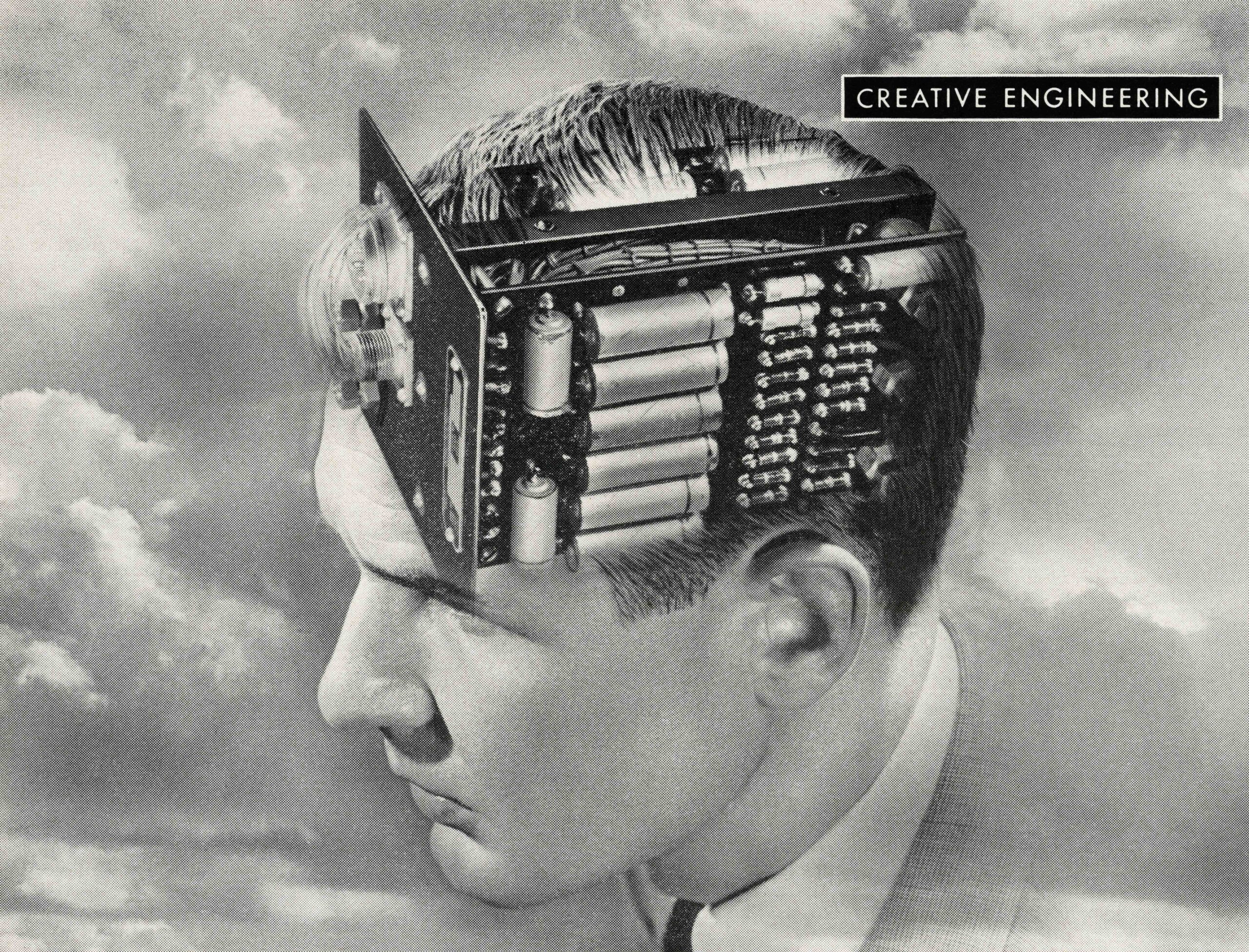Reale Kunst und die große weite Welt: So war das Reeperbahn Festival 2015
Das Karussell dreht sich noch: Das Reeperbahn Festival feiert zehnjährigen Geburtstag – und hat Besucher, Bands, Künstler und Vertreter der Musikbranche dazu eingeladen, ein paar Tage Wahnsinn und die wirkliche Kunst der Stadt zu erleben.
Vom 23. bis zum 26. September hat die berühmteste Hamburger Meile sich selbst gefeiert – und zur zehnten Ausgabe des Reeperbahn Festivals einige Gäste geladen, die den zehnten Geburtstag im Stadtteil St.Pauli zusammen mit allen Nachtschwärmern gefeiert haben, die sowieso auf der Straße unterwegs waren. 30.000 Leute konnten in fast alle Clubs auf der Reeperbahn und ein paar Außenstellen in der Sternschanze zu 400 Konzerten gehen, um dem Festival ein Fest zu bescheren, das man so nicht häufig erlebt – und einem natürlichen Chaos durch die Entropie seiner Gäste gleich kommt.
Wenn man von der U-Bahn ausgespuckt wird und über die Kreuzung in Richtung Reeperbahn geht, muss man erst einmal mit dem Wahnsinn klar kommen, der einem begegnet. Überall sind Menschen, aus jeder Ecke kommt Musik, die Prostituierten stehen in Moonboots auf dem kalten Asphalt und sich die Beine in den Bauch, während sie auf ihre Freier warten. Und wenn man einmal still steht, kann man Eines ganz klar sehen: Die angeheiterten Feiernden zirkulierten immer wieder um den Spielbudenplatz, Zentrum und Rettungsinsel im Wirbel des Wahnsinns, auf der sich die Menschen gern eine Pause gönnen – nur, um nach kurzer Zeit wieder aufs Karussell aufzuspringen und eine neue Runde zu drehen.
Verzerrt und harmonisch, wo es eben sein muss
So kann es passieren, dass man sich im Rock Café St. Pauli zum Konzert der Band Spidergawd wiederfindet und, nein, nicht zu 80er-Hair-Metal (der Band-Name der Musiker aus Norwegen kann das ja durchaus als Assoziation hervorrufen), sondern einer Mischung aus Stoner- und Hard-Rock irgendwo zwischen Kyuss, Motörhead und Eagles Of Death Metal. Die Atmosphäre ist von Hopfen und Malz geschwängert, auch wenn der Weg zur Bar schwer ist, weil der Club bis oben hin voll mit Menschen ist, die am frühen Abend ihr erstes Konzert sehen wollen. Der Schlagzeuger (Kenneth Kapstad) und Bassist (Bent Sæther) spielen eigentlich zusammen bei Motorpsycho ihre psychedelisch-noisigen Stärken aus – heute Abend aber in einer durchgängig harten Rock-Musik, wo Dynamik noch laut bedeutet, Energie das Maß aller Dinge ist und der Bass gern eine Gitarre wäre und die Gitarre ein Bass: Verzerrt und harmonisch, wo es eben sein muss. Einen Schicksalsschlag gab es aber bei diesem Konzert: Nachdem sich eine norwegische Airline entschieden hatte, das Instrument des Saxophonisten der Band beim Transport kaputt gehen zu lassen, muss die Gruppe ohne ihn auskommen. Schade eigentlich – das Publikum hätte sich bestimmt gefreut, noch etwas zu hören, das durch die Kanäle einer Zerre gejagt wurde. The Sky’s the Limit.
Je weiter die eigene Konzert-Reise geht, desto eher bekommt man das Gefühl, dass man sich einfach treiben lassen sollte. Es sind zu viele Acts, die man sehen und entdecken könnte. Um da nicht in ein Terminwirrwarr zu geraten, muss man entweder einen Sekretär angestellt haben oder einfach dem Strom folgen, was vor allem dann angenehm ist, wenn es einen in die Straßen rund um die Reeperbahn treibt, wo, siehe da, fast nichts mehr los ist. Geht man zum Beispiel über das Heiligengeistfeld zum Bunker, in dem der Club Uebel & Gefährlich ist, sieht man wenige der betrunkenen Festival-Besucher, sondern erst einmal nur Beton und einen Weg, der sich in ein nettes und alltägliches Großstadtgrau gekleidet hat. Ein Spaziergang in die etwas weiter entfernten Spielstätten des Festivals kann manchmal den Kopf frei machen und entspannt darauf vorbereiten, dass man immer wieder auf ganz andere Art aus dem Festival-Karussell herausgeschleudert wird.
Frosch-im-Hals-Falsett
Im Uebel und Gefährlich zum Beispiel erzählt einem Nicholas Müller von seinen Depressionen. Der ehemalige Jupiter-Jones-Sänger ist mit seiner neuen Band dort, nachdem er die alte Karriere wegen Problemen mit der Angst hinter sich lassen musste – und hat sich damit ironischerweise Material für sein neues Projekt, Von Brücken, von der Seele gearbeitet, mit dem er sofort ein großes Publikum erreichen kann und erfährt, dass ihn niemand vergessen hat. Mit seinem ehrlichen Frosch-im-Hals-Falsett und der aufrichtigen Haltung zur Musik und seinen Gästen gegenüber lässt Müller – auch wenn er vielleicht selbst im Zweifel ist –, beim Publikum jedenfalls keine zweiten Gedanken daran, dass diese Lieder und das bald erscheinende Album momentan das Richtige für beide Seiten sind. Eine eingespielte Band aus Freunden stützt da gut, wenn bei Songs wie „Lady Angst“ oder „Dann sammle ich Steine L.K.M.“ alles Intime auf direkte Art in den grauen Bunker mitten in Hamburg los gelassen wird – etwas nah am Kitsch, aber auf jeden Fall nicht an der Grenze zur Geschmacklosigkeit.
Wirklich geschmacklos geht es da schon eher auf der Reeperbahn selbst zu. Dort, wo früher nur Seemänner nach Kneipen gesucht haben, in denen sie ihre Heuer versaufen konnten, muss man sich mittlerweile, geblendet von Neonlicht und LED-Fassaden, durch Gruppen von Touristen, Yuppie-Kids, gescheiterten Existenzen und vorbei an harten Kerlen in dicken Karren schlängeln, um irgendwie sein Ziel zu erreichen. Selbst wenn das halbwegs rechtzeitig klappt, sollte man sich aber damit anfreunden, manchmal die Musik der Bands von Außen zu hören und die stickige Luft, die aus den Clubs strömt, ins Gesicht gefönt zu bekommen. So ist sie halt, die alte Wilde. Sie lässt das Chaos regieren und die Pläne vergessen – falls man überhaupt welche hatte – und zeigt einem immer wieder ihre Keller, Abgründe und vergessenen Ecken, an denen man sich dem Plastik, der Simulation, dem Motten-ins-Licht-Phänomen verwehren kann und oft das Gefühl hat: Ich weiß nicht, wie wirklich es ist, aber hier könnte Musik-Geschichte geschrieben werden. Vielleicht bleibt sie nicht für immer, diese Band, diese Musik, aber für den Moment und für uns, haben wir ein kleines Fenster gefunden, von dem aus man den Jahrmarkt der Eitelkeiten vergisst, weil kurz die reale, kalte und klare Nacht sichtbar wird.
Aber es gibt sie natürlich doch: Die Performances, die Momente, in denen auch die Clubbühnen von St. Pauli zur Theaterbühne werden. Wenn zum Beispiel Torres mit ihrer Band im schwarzen Overall und silberfarbenem Lippenstift auf der Bühne des Knust zum Spektakel lädt, geht das Rollenspiel zwischen Publikum und Musikern wunderbar auf – es wird Kunst geben, mit mehr Schatten als Licht und auf ehrliche Weise, daran besteht nach dem Intro der Band kein Zweifel. Mackenzie Scott und ihre drei Musiker haben bei ihrem Auftritt alle Songs der beiden Alben „Sprinter“ und ihres selbstbetitelten Debüts mit atmosphärischen Sounds in der Lücke zwischen den Stücken verbunden, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Vom abgründigen „Son You Are No Island“ bis zur Grunge-Rock-Eskapade „Strange Hellos“: Alles, was auf der Bühne passiert ist bewusst, durchdacht und vermittelt durchweg so viel Energie, dass der Sound der Band wie eine Stroboskop-Lampe Licht ins Dunkel der Halle bringt, der Reiz aber niemals schwächer wird oder gar aufhört. Da wird auf den Drums herumgedroschen, als sei es die pure Hassliebe, Gitarrensounds werden in Hall ersoffen und orchestral auf die Empore gehoben, während Synthesizer-Flächen die Erde ebnen, um die Songs zu einem lockeren Ganzen zu verbinden. Diese großen Gesten kommen auch beim Publikum an. „Ich heiße Mackenzie Scott. Aber heute Abend bin ich zu euch als Torres gekommen“, sagt die 24-Jährige kurz bevor mit „The Harshest Light“ der letzte Song beginnt. Und dafür scheint ihr jeder der Anwesenden dankbar zu sein.
„Des sehe i in Münchn jed’n Dog!“
Ganz anders, aber mit Energie die noch viel eher an der Sonnenseite des Lebens angelegt ist, funktioniert das, was Cristobal and the Sea danach bei einem der letzten Konzerte des Festivals im Nochtspeicher abliefern. Dabei kann man den Namen der Band wörtlich nehmen: Die vier Musiker schippern mit ihrem Kahn auf den großen Meeren der Weltmusik, suchen sich in allen Häfen passende Rhythmen und Akkorde, damit João Seixas sie vom obersten Schiffsmast auf die umher gleitenden, Delay-Wogen singen kann. Leïla Séguin gibt Gesangsharmonien dazu, um sich auch mit ihrer Querflöte in den Hall-Strudel zu stürzen, immer begleitet von Alejandro Romero und Joshua Oldershaw, die mit Bass und Schlagzeug das Ruder in der Hand und die Songs auf Kurs halten. Bossa Nova, Mariachi, einfach viele lateinamerikanische Rhythmen werden so mit einer Portion britischem Folk zu etwas stilisiert, das danach klingt, als seien die vier im Geiste weit gereist, würden ihre Herkunft und das Leben in Großbritannien reflektieren und hätten entdeckt, dass vor allem Freiheit das Wichtigste am Leben, vor allem aber in der Musik ist. Aus London kommen sie, haben sie jedenfalls gesagt, zeigen aber bei diesem Konzert eine überraschende Vielfalt, die in der Parallelstraße des Hamburger Hafens nicht Bier, nicht Zigaretten, keine Kotze oder Abgase, sondern Seeluft und ganz viel Weite riechen lässt. „Sugar Now“ wird das erste Album der Band heißen, das so selbstbewusst daher kommt, dass die flüchtigen Verbeugungen, das ungläubige Grinsen des Drummers nach dem Konzert und der schnelle Abgang der Newcomer-Band nur davon zeugen können, dass sie in die Rolle von umjubelten Musikern noch etwas hereinwachsen müssen – und das bestimmt schon sehr bald tun werden.
So kann es also gehen, wenn man den zehnten Geburtstag eines Festivals feiert, das Branche und Publikum, große und kleine Bands nebeneinander stellt und sich dem Chaos der Reeperbahn verschrieben hat. Es kann aber auch völlig anders passieren – mit anderen glücklichen Umständen oder verpassten Konzerten. In welcher Hand das liegt, kann niemand sagen, das Wichtigste aber, das man lernen kann, wenn man sich durchs Karussell rund um den Spielbudenplatz dreht, ist: Lass dich treiben und schaue was passiert, denn trotz allen Wahnsinns zirkuliert der Strom weiter. Auch mit Leuten, die dem Ganzen mit Unverständnis begegnen, an der Kultur vorbeilaufen, das Fest verwechselt haben und in Lederhosen, mit einer Begleitung im Dirndl vor Straßenmusikern stehen, um zu sagen: „Des sehe i in Münchn jed’n Dog!“ Man möchte ihnen sagen: „Nein, macht die Augen auf, das tut ihr nicht.“ Und ihnen ein Astra schenken.