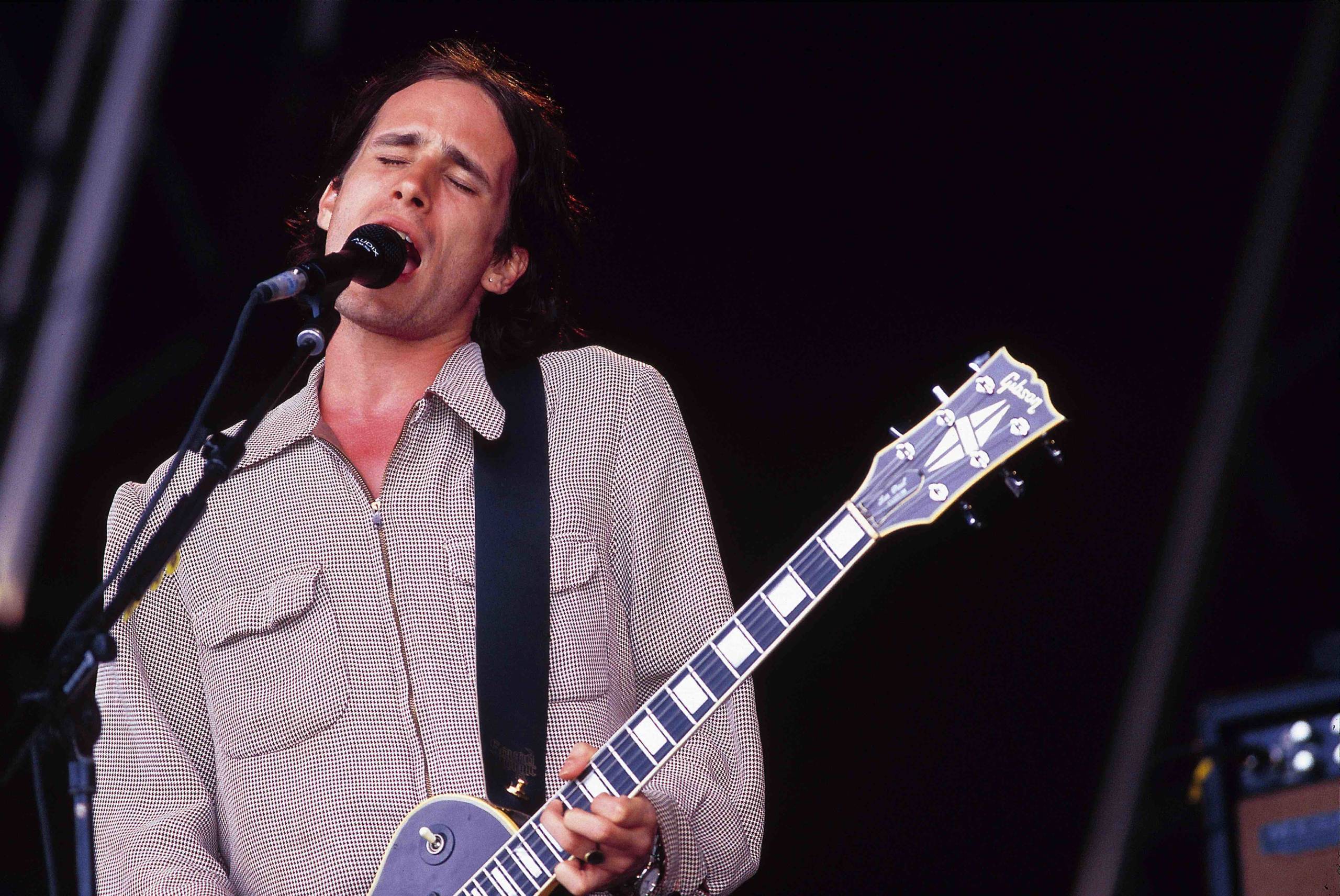Punk für die Leinwand
Die wechselhafte Karriere des britischen Regisseurs Danny Boyle kommt mit „Slumdog Millionär" zu einem vorläufigen Happy-End.

Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um in Danny Boyle noch immer jenen jungen Punk vor sich zu sehen, der Ende der 70er Jahre in Manchester seine Widerstandskraft gegen institutionalisiertes Denken formte. Auch heute ragt die Frisur formvollendet stachelig in alle Himmelsrichtungen, etwas ausgedünnt nur. Die 50 hat der Regisseur zwar überschritten, doch ihm ist noch immer die Identifikation mit den jungen, romantisierten Sturm-und-Drang-Männern anzumerken, die er bevorzugt mit hageren, hohlwangigen Burschen wie Ewan McGregor („Trainspotting“) oder Cillian Murphy („28 Days Later“) besetzt. Und nicht nur unter britischen Regisseuren gibt es neben Boyle kaum jemanden, der etablierte Weisheiten so selbstverständlich mit unbändiger Neugier und freiwilligem Kontrollverzicht aushebelt.
„In England gibt es diese Haltung, dass talentierte Kids gefälligst eine Band gründen“, sagt er über seinen Berufsstand, „während Filmemacher als verkopfte Akademiker gelten, die den Regeln des Systems gehorchen, obwohl diese Klischees längst nicht mehr zutreffen.“ Er spielt damit auf die Neigung der britischen Filmindustrie an, zumeist edle Kostümfilme oder aufrechtes Arbeiterklassenkino zu fördern, wo trotz unbestreitbarer Qualitäten selten die Grenzen der Erwartungskonformität überschritten werden. Danny Boyle indes geht seine Stoffe mit der diebischen Freude eines Entertainment-Anarchisten an und knöpft sich alle paar Jahre ein neues Genre vor, um es dann förmlich explodieren zu lassen. Mit dem Mut zum Scheitern durch Overkill und stilistisch durchaus als hemmungslose Rampensau ist er besessen davon, nie zu langweilen. Boyle will vielmehr Filme schaffen, „die vom Publikum nicht objektiv betrachtet werden können, sondern als Erlebnis wahrgenommen werden, das ihnen unter die Haut kriecht.“
Nach seinem schwarzhumorigen Debüt „Shallow Grave“ wurde er diesem Anspruch erstmals 1996 mit „Trainspotting“ gerecht, der fil mischen Flanke der „Cool Britannia“-Ära neben Britpop und New Labour. In einem sensorischen Rausch aus Realitätsverzerrungen, Tempo- und Erzählwechseln, Musikschnipseln und hiyour-face-performances machte Boyle vor, wie er Energie in Bildern zu bündeln versteht. Auch „Trainspotting“ war ein Blick auf den Rand der Gesellschaft, voll romantisierter Liebe für lebenshungnge lads, unter denen Boyle als Kind einer Arbeiterfamilie groß geworden war. Doch er sezierte und erklärte nicht, sondern versetzte der Popkultur einen Adrenalinstoß, indem er der Ernsthaftigkeit des Drogenthemas mit Punk-Attitüte den Mittelfinger entgegen streckte, wo für gewöhnlich warnend mit dem Zeigefinger gewedelt wird.
Mit Geldbündeln wedelte im folgenden Hollywood, so musste es ja kommen. Dass er sich mit der Roadmovie-Romanze „A Life Lcss Ordinary“ vornehmlich visuell austobte und darüber das Erzählen vergaß, mochte noch dem Druck des „Trainspotting“-Phänomens geschuldet sein, doch als Boyle für „The Beach“ den für seine Verhältnisse exorbitanten Etat von 40 Millionen Dollar und in Leonardo DiCaprio einen veritablen Filmstar bewilligt bekam, drohte er ohne Not seiner Originalität verlustig zu gehen. „Ich habe es nie geschafft, eine persönliche Sicht auf Alex Garlands Roman zu finden“, erinnert Boyle, „und weiß heute, dass ich schlichtweg in die Geldfalle getappt war. Sicher, es gibt viele Regisseure, die jedes erdenkliche Spielzeug und große Crews brauchen. Doch ich lernte, dass ein großer Apparat nur zu großem Kontrollzwang führt, der die Kreativität erstickt, während ich am besten bin, wenn ich in Guerilla-Manier arbeite und mich Not erfinderisch macht.“
Nach der Abfuhr für „The Beach“ bei Kritik und Publikum ließ Boyle weitere Hollywood-Optionen ersatzlos verstreichen, ging zurück nach England und betrieb schonungslose Fehleranalyse. Am Ende stand eine Rückkehr zu den Wurzeln des Fernsehens, wo er mit kleinen Produktionen seine Laufbahn begonnen hatte. „Bei der BBC staunten sie alle nicht schlecht“, schmunzelt Boyle, „als ich mit der Bitte um Beschäftigung anklopfte, während sie mich noch irgendwo in den Fluren der Macht in Los Angeles vermuteten. Doch nur hier bekam ich die Chance, unter dem Radar der Öffentlichkeit meine Instinkte neu zu schärfen, indem ich mit fünf Leuten und einer kleinen Digicam auf die Straße ging und mich zwang, ohne viel Planung aus jedem Drehtag das Beste herauszuholen.“ Diese TV-Probeläufe mündeten 2002 in „28 Days Later“, dem besten und genuin gruseligsten Horrorfilm seit „The Shining“, in dem Boyle klug das Aggressionspotential westlicher Wohlstandsgesellschaften reflektierte. Seither ist er vielleicht nicht immer so erfolgreich wie erhofft – sein wunderbarer Kinderfilm „Millions“ verfehlte die Zielgruppe und das Science-fiction-Drama“Sunshine“implodierte wie ein sterbender Planet unter der Last von metaphysischem Mumpitz. Doch Boyle hatte sein Selbstbewusstsein und seine Stilsicherheit wiedergefunden, wählte Material mit der kühnen Unberechenbarkeit eines professionellen Chamäleons und fühlte wieder „die Freiheit, nur das zu machen, was ich für richtig halte“.
Die Summe dieser Elemente ist nun „Slumdog Millionär“ — ein Filmmärchen, das auf dem Papier klingt wie eine Arte-Doku und seit letztem Herbst doch einen wundersamen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Nicht übel für eine 6-Millionen-Pfund-Produktion, die im indischen Mumbai mit Laien und Unbekannten zu weiten Teilen in Hindi gedreht wurde und in den USA um Haaresbreite nur auf DVD erschienen wäre, nachdem ihr der Finanzier Warner die kommerzielle Verwertbarkeit absprach. Mit raffinierten Zeitsprüngen erzählt Boyle die Lebensgeschichte eines Slum-Jungen, der auf der Suche nach der Liebe seines Lebens in die Hände von Ausbeutern des Elends fällt, sich im Taj Mahal als Touristenführer durchschlägt und unversehens auf dem heißen Stuhl der indischen Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ landet. Eine klassische rags-to-riches-Story also. Indem Boyle sich aber, mit einer notdürftig gekühlten Digitalkamera bewaffnet, in den Moloch Mumbai stürzte, findet er zugleich die denkbar modernste Form für eine traditionelle Entdeckungsreise.
So recht kann es der Regisseur bei unserem Gespräch in London kurz vor Weihnachten auch noch gar nicht fassen, welch ein Momentum „Slumdog Millionaire“ dank Mundpropaganda über Monate bekam. Und dass er ausgerechnet in die entlegensten Winkel Indiens reisen musste, um am Ende wieder im Herzen Hollywoods zu landen — ob dieser Entwicklung ist sein Grinsen so breit, dass es ihm derzeit wohl nur operativ zu entfernen wäre…