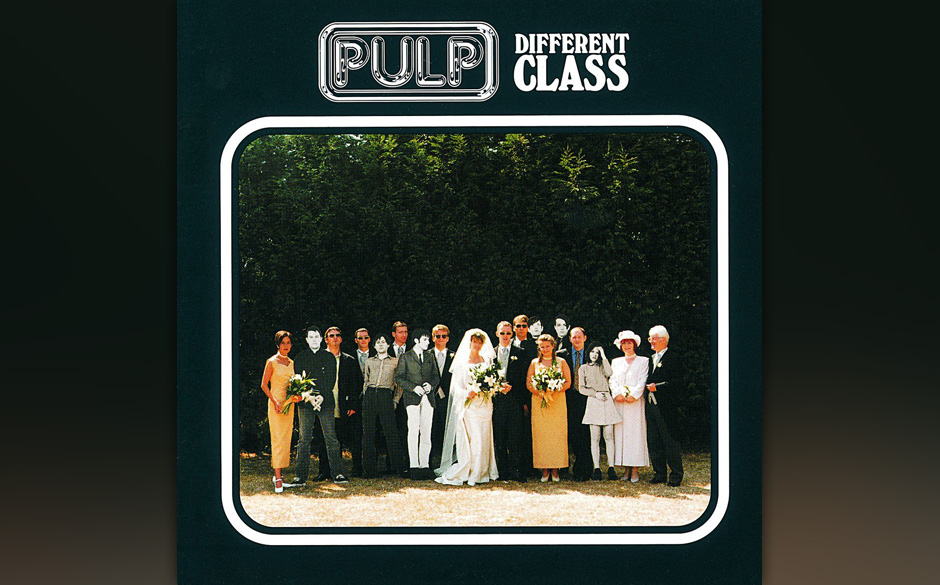Pulp Fiction mit bin Laden

ES BEGINNT WIE EIN klassischer Detektiv-Roman. Joe Wilkes döst in seinem Büro im laotischen Vientiane vor einer Flasche Whisky, als eine ebenso schöne wie mysteriöse Frau hereingeschneit kommt und ihn beauftragt, einen Groschenromanschreiber namens Mike Longshott zu suchen. Einziger Hinweis: ein schmieriger, kleiner Verlag in Paris, der Longshotts Bücher verlegt. Die aber haben es in sich. Denn sie heißen „Einsatz Afrika“ und „World Trade Center“ und handeln von „Osama, dem Vergelter“, dessen Fußtruppen weltweit verheerende Terroranschläge verüben.
Osama bin Laden als Pulp-Fiction-Ikone -darauf muss man erst einmal kommen. Und diese abgedrehte Idee ist erst der Beginn einer Achterbahnfahrt durch (fiktionalen) Raum und Zeit, auf die uns Lavie Tidhar in seinem fabelhaften Opium-geschwängerten Politthriller „Osama“ schickt.
„Zwischen 1998 und 2005 bin ich als Globetrotter durch die Welt gereist und gleich viermal in die Nähe von Al-Qaida-Anschlägen geraten“, erklärt Tidhar im Interview mit dem ROLLING STONE. Der heute 37-jährige Israeli wohnte 1998 erst in Nairobi im selben Hotel wie die Al-Qaida-Terroristen und hielt sich dann zum Zeitpunkt des Bombenanschlags auf die amerikanische Botschaft in Daressalam auf. Danach wurde es noch enger: 2004 entkam er mit seiner Frau dem Attentat auf die Touristen-Resorts auf der Halbinsel Sinai, und ein Jahr später wäre das Paar beinahe dem Anschlag auf den Londoner Bahnhof King’s Cross zum Opfer gefallen.
„Auch wenn es letztlich wohl alles Zufall war“, fährt er fort, „hat das doch meine Auffassung vom Schreiben geprägt. Ich will keine eskapistischen Geschichten schreiben, sondern über Dinge berichten, die ich für wichtig halte, wenn auch auf eine vielleicht schräge und absonderliche Weise.“
Tatsächlich sprengt „Osama“, für den Tidhar 2012 bereits den begehrten World-Fantasy-Award gewonnen hat, so ziemlich alle Grenzen zwischen Krimi, Science Fiction und Fantasy und zeigt damit dem Genre, das mehr denn je Gefahr läuft, zwischen hirnlosen Serienkiller-Thrillern und blutlosen Regio-Krimis in die Bedeutungslosigkeit zu schlingern, eine elegante Perspektive auf. Dass er dazu das Personal der Gründerväter Chandler und Hammett wiederbelebt, ist sicher kein Fehler. Denn wenn Tidhar mit seinem Privatdetektiv fertig ist, ist er endlich bis zur Kenntlichkeit entstellt. Und wir kommen in den Genuss des wahrscheinlich verrücktesten Romans seit William S. Burroughs‘ legendärem Drogenepos „Naked Lunch“.
Burroughs‘ paranoider Verschwörungsthriller von 1959 spielt als Ausgangspunkt von Tidhars Trip durch eine Welt, in der Osama bin Laden offenbar nur in der Fantasie eines Pulp-Schreiberlings existiert, sogar eine wesentliche Rolle. Nichts ist, was es zu sein scheint. Der Privatdetektiv findet keine Spur des verschwundenen Autors, stattdessen wird er von mysteriösen Agenten heimgesucht, die ihn in eine Art „Guantanamo hinter den Spiegeln“ verschleppen, wo sie ihn wie einen Terroristen verhören und wissen wollen, was ein Handy ist. Oder ein iPad, oder das Internet. So merken wir langsam, dass wir uns in einer Parallelwelt bewegen, in einem wirren Kaleidoskop aus den kulturellen Versatzstücken des 21. Jahrhunderts, die sich vor Joes Augen zu ständig neuen, bruchstückhaften Mosaiken formen.
Virtuos zieht Tidhar hier alle Register der Popkultur. Alice landet schließlich am Gare du Nord in der Gosse, Agent Smith verfolgt Philip Marlowe durch „Klein-Kairo“, Gilda singt im Blue Note „Somewhere Over The Rainbow“. Und über allem wacht Philip K. Dicks „Orakel vom Berge“. Joes Odyssee führt ihn durch die Immigranten-Basare, Jazzclubs und U-Bahnschächte von Paris, London und New York, bis er schließlich -kein Witz, oder doch? – auf einer „Osama-Fan-Convention“ landet, wo die Ereignisse völlig aus dem Ruder laufen.
Wer nun jedoch glaubt, dieser Roman sei einfach eine postmoderne Drogenhalluzination, irrt gewaltig.
Denn Tidhar gelingt es, allen Anspielungen zum Trotz, eine ganz eigene originelle Geschichte zu erzählen. Eine verstörende Elegie über die Fragilität einer Welt, in der es keine Gewissheiten mehr gibt, und in der jeder zum Opfer werden kann. Das klingt nicht wie aus einem Drogennebel hervorgezogen, sondern hat etwas erschreckend Reales.
Denn zwischen die atemberaubenden Schießereien und Verfolgungsjagden montiert Tidhar die verstörenden Stimmen von Terroropfern, deren letzte Gedanken er wie einen Soundtrack aus dem Schattenreich evoziert, bis am Ende die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischen.
„Das wahre Geheimnis liegt in Joe selbst. Er muss sich selbst gegenübertreten und dem stellen, was er ist“, umschreibt Tidhar ein wenig kryptisch die Sinnsuche seines Helden, der sich verzweifelt bemüht, den Moment in der Geschichte zu finden, an dem das Unheil hätte aufgehalten werden können. „Aber“, fügt er lakonisch hinzu, „vielleicht ist es auch einfach nur die Geschichte einer Liebe, die sich im allgegenwärtigen Schatten des Terrors beweisen muss.“ Und tatsächlich ist es am Ende die Liebe zweier Menschen, die den Schlüssel zu Tidhars virtuosem Vexierspiel mit Fiktion und Wirklichkeit liefert. Hinter der Tür allerdings, die dieser Schlüssel öffnet, warten nicht Trost oder Erlösung, sondern nur das Grauen der existenziellen Leere.
Jack Kerouac hat Burroughs‘ „Naked Lunch“ mal als den eingefrorenen Augenblick definiert, „in dem jeder sehen kann, was auf der Gabel aufgespießt ist“. Bei der Lektüre von Lavie Tidhars ebenso faszinierendem wie verstörendem Roman fragen wir uns am Ende, ob wir überhaupt eine Gabel in der Hand halten.