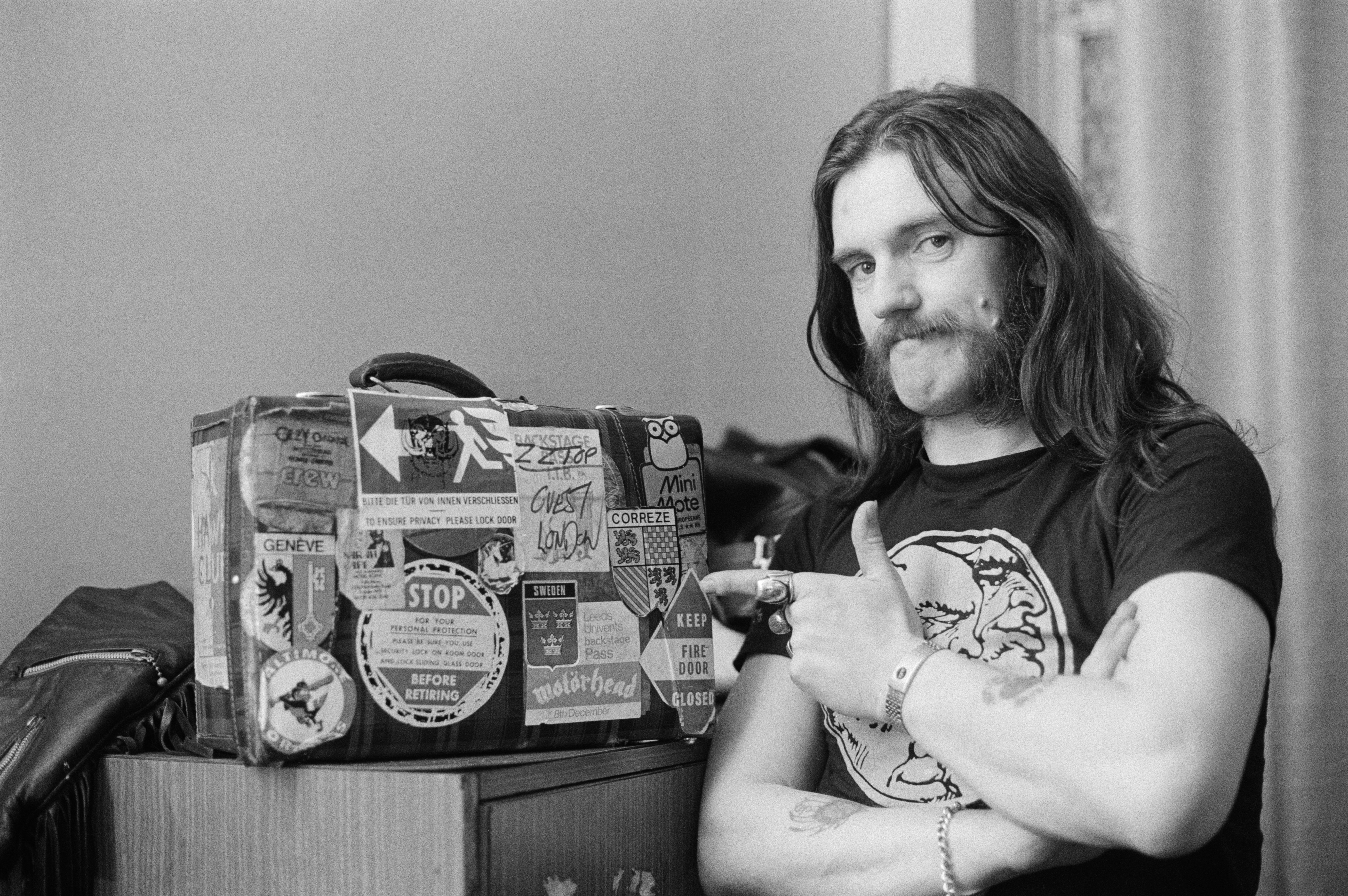Paul Heaton, der Wortführer von The Beautiful South, bleibt an der Bar

Ein Treffen mit Paul Heaton kann eine Offenbarung sein – oder ein Schlag ins Bierglas; dann nämlich, wenn der Ex-Housemarrin und Beautiful South-Anführer vor dem leidigen Interview mal wieder zu tief in selbiges geblickt hat.
Doch das Glück ist mir hold. Ich treffe Heaton leidlich nüchtern an der Bar des gediegenen Copthorne Plaza Hotels im Londoner Nobel-Stadtteil Kensington. Kaffee für mich und ein großes Dunkles samt zugehörigem Cola-Rum zum Nachspülen für Genosse Heaton, der, insoweit kann ich den verstörten Barmann verstehen, das Bild eines Bohemiens abgibt: fettiges, in Strähnen um seinen gedrungenen Kopf wirrendes Haar, speckiger Wollmantel und das fahle Antlitz eines Gewohnheitstrinkers.
Kaum zu glauben, daß die wohl zuckrigsten Popsongs der letzten 13 Jahre aus der Feder dieses Stadtstreichers geflossen sind, den abgesehen von Bier, Fußball und der imperialistischen Politik der britischen Regierung kaum etwas aus der Reserve zu locken vermag. Und doch: Nach dem unerwarteten Triumph der Beautiful South-Singles-Compilation „Carry On Up The Charts“ vor zwei Jahren, auf der sich noch einmal die schönsten und melancholischsten Momente der Beautiful South-typischen Alltagsdramatik versammelt hatten, rutschte auch das unlängst veröffentlichte Album „Blue Is The Colour“ aus dem Stand in die Charts. Erstaunlich für eine Musik, die außer zeitweise recht bissiger Lyrik kaum etwas Aufregendes vorzuweisen hat Einmal mehr frage ich Heaton folglich nach dem Geheimnis des Erfolgs. „Nun, ich bin noch immer der Meinung, daß der gewöhnliche Musikhörer merkt, wann er verarscht wird und wann nicht. Die Leute sind nicht so dumm, wie John Major oder die Plattenindustrie es annehmen“, erklärt er mit einem listigen Seitenblick. „Ich denke, daß ich in meinen Songs schlicht und einfach herüberbringe, ein ebenso gewöhnlicher Kerl zu sein, wie jeder, der unsere Musik hört Deshalb mögen uns manche Leute lieber als beispielsweise diese Witzfigur da!“ Mit ungeahnter Heftigkeit bohrt sich Heatons Zeigefinger auf das Schwarzweißphoto eines idiotisch grinsenden Phil Collins in der „Times“ auf dem Tresen, Ein Witzbold hatte dem Konterfei des Wahl-Schweizers per Kugelschreiber ein Paar Eselsohren und Dracula-Fangzähne verpaßt „Collins ist so ein Typ, der sich lautstark darüber beschwert, wie ungerecht die neuen Steuergesetze für den Normalbürger sind, und dann nichts Besseres zu tun hat, als sich in die Schweiz abzusetzen, wo er ungestört seine Millionen horten kann“, pöbelt Heaton, wird jedoch gleich darauf verlegen, als ich ihn an den nicht unbeträchtlichen Geldsegen erinnere, der ihm durch den erstaunlichen Erfolg des Best-Of-Albums zugekommen sein dürfte.
Doch nach einem weiteren kräftigen Schluck aus dem Bierglas kassiere ich Paul Heatons sozialistischkorrekte Antwort: „Der Unterschied ist ganz einfach, daß ich auch weiterhin ein armer Schlucker bin und mich damit auch wohl fühle. Ich benötige Geld nur, um Musik zu machen, zu reisen – und natürlich, um mir etwas zu trinken zu kaufen.“ Ein zünftiges Prosit auf die Trinker aller Länder.