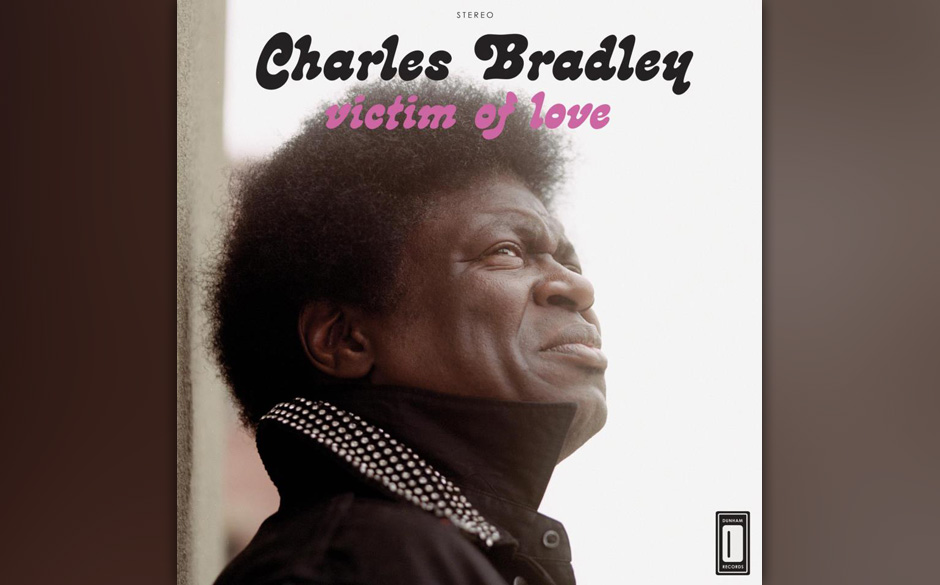Passionsspiele: So waren Charles Bradley & The Extraordinaires in Berlin
Am Mittwoch spielten Charles Bradley & The Extraordinaires im Astra in Berlin. Frank Castenholz war für uns vor Ort.
„Do you feel alright?!“ Als Bradley sich eine halbe Stunde nach Konzertbeginn nach unserem Wohlbefinden erkundigt, schmettern wir ein lautes und aufrichtiges „Yeah!“ zurück. Und sind doch etwas schwindelig vor Gefühl. Denn sein Soul ist bei allem Groove nicht in erster Linie tanzbar und cool, sondern trifft ins Mark. Seine Schreie, die an die Idiosynkrasien seines großen Idols, James Brown, erinnern, dienen weniger als Ventil der Ekstase denn des Schmerzes. Ein Schmerz, der sich über viele Jahrzehnte seines Lebens aufgestaut hat.
Mit 14 war er von zuhause abgehauen, hatte als Jugendlicher in New York in Armut und Obdachlosigkeit gelebt, schlug sich die nächsten 30 Jahre als Koch von Alaska über Kalifornien bis zurück nach Brooklyn durch, spielte abends Shows als James Brown-Darsteller und haderte mit Gott und der Welt. Vor gut 10 Jahren wurde Gabriel Roth von Daptone Records, der schon bei Sharon Jones und Lee Fields sein Gespür für unvollendete Soul-Talente reiferen Alters bewiesen hatte, auf ihn aufmerksam. Nach einigen Singles folgte 2011 im Alter von 62 endlich sein Albumdebüt „No Time For Dreaming“ mit der Menahan Street Band – ein fragendes, klagendes, oft zum Verzweifeln düsteres Genre-Werk klassischer Schule, das sich thematisch ohne Schnörkel und Charaden aus Bradleys Leben speist. Das Trauma, dass sein Bruder vor Bradleys Elternhaus auf offener Straße erschossen wurde, das stete Mühen und Scheitern im „land of milk and honey“, Songs, die ihre Größe nicht so sehr aus kompositorischen Tricks und Kniffen ziehen, sondern aus der Intensität des Vortrags, und bei allem Persönlichen, Intimen doch auch die universellen Seelennöte des Menschen und seine bisweilen erstaunlich zähen Hoffnungen reflektieren: Deep Soul, der im „live“-Moment erst seine ganze existenzielle Wucht entfaltet. Der Schmerzensmann zelebriert seine Passion auf der Bühne, geht zu einem Song in die Knie und schultert die Last des Mikrophonständers wie ein Kreuz. Doch heute ist er nicht mehr der James Brown-Imitator „Black Velvet“ von einst, sondern Charles Bradley, „The Screaming Eagle of Soul“: Ein Phönix, der beim Singen mitunter Flügelschläge andeutet, wohl um seine künstlerische Befreiung spielerisch zu feiern.
Seine beinahe ungläubige Dankbarkeit und Demut vor dieser allzu späten Anerkennung zeigt Bradley offen, schaut mit großen Augen ins Publikum, kostet die Momente aus, entertaint aber auch mit zuckendem Tanz, Spagat und Mikrofon-Akrobatik – Lockerungsübungen bis zum nächsten Lamento voll „heartache and pain“. Seine Tourband, die Extraordinaires, junge Weißbrote allesamt, lassen die Menahan Street Band nicht vermissen, sie können viel, trockenen Schlagzeug-Funk, kantige Stax-Bläser, füllige Hi-Hitze auf der Orgel, ohne sich aufzuspielen oder allzu akademisch exakt zu klingen; nur für die etwas dünnen Background-Chöre würde man Bradley lieber ein gospelgeschultes Trio an die Seite stellen.
Zum Schluss, nach einem bestürzend intensiven „Why Is It so Hard? (To Make It In America)“ steigt Bradley einfach von der Bühne und wird eins mit dem Publikum, schüttelt Hände, lacht, umarmt – nicht als Mutprobe oder Show-Akt, sondern aus Liebe und Dankbarkeit. Mit einer ähnlich unprätentiösen und vollherzigen Geste der Nahbarkeit beliebte auch der überlebensgroße King of Rock’n’Soul, Solomon Burke, seine Konzerte zu beschließen. Bradley steht nicht nur deshalb in bester Tradition.