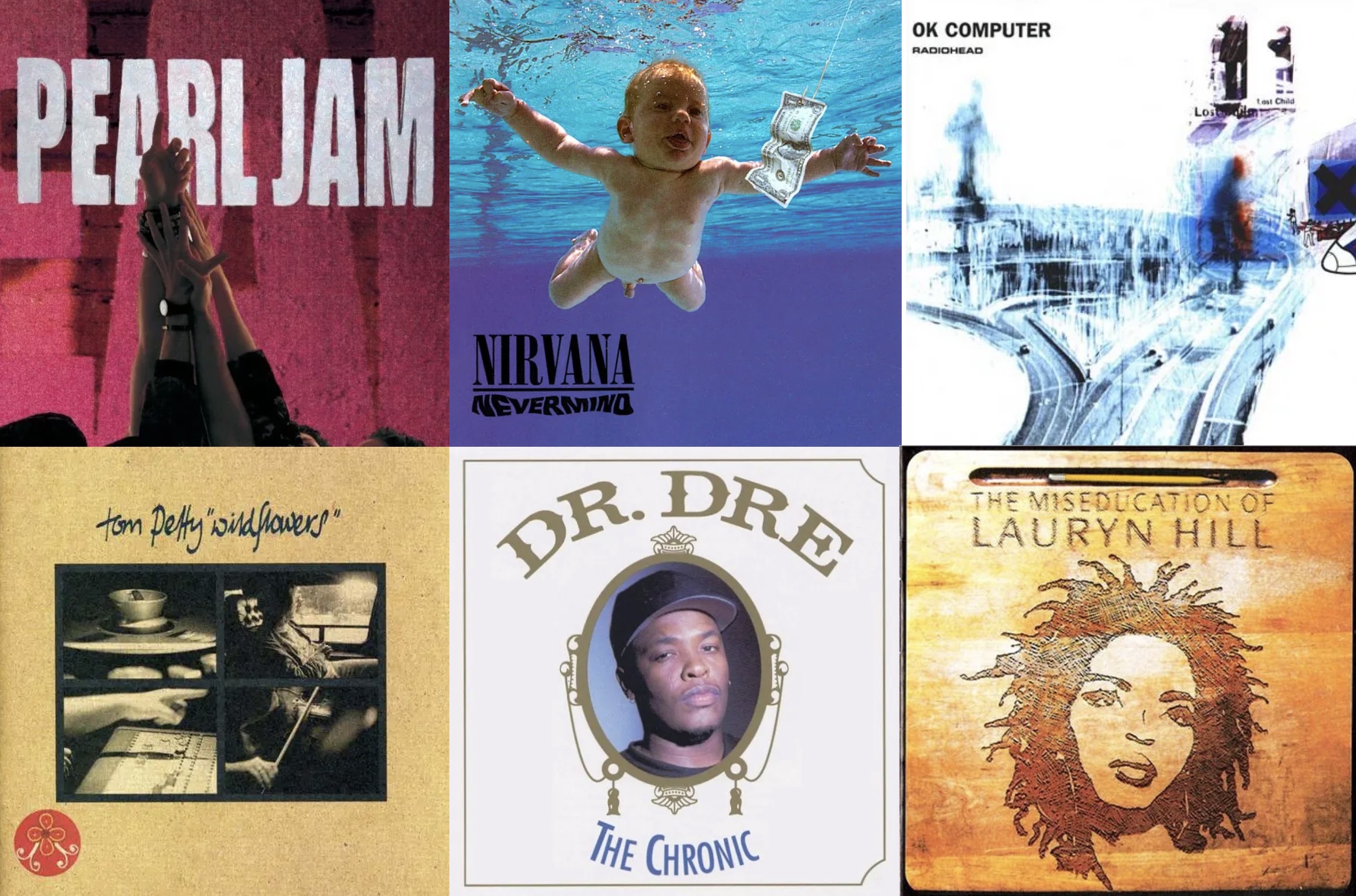Moby – München, Colosseum

Die Leute um ihn herum mögen hektisch werden – Moby bewahrt kühlen Kopf, auch wenn er sich vor Bewegungsdrang nicht zu entspannen weiß. So war es auch an einem nasskalten Februar-Abend im restlos vollen Münchner Colosseum. Und es war ein großes Schauspiel, das mit dem Fernost-Instrumental „My Weakness“, dem Schlusslied von „Play“, seinen so anrührenden (weil klanglich sehr schönen) wie ironischen Anfang nahm. Meine Schwäche? Aber Moby hat doch gar keine, höchstens für sentimentale Melodien, wie andere Menschen auch.
Dieser Richard Hall kann alles, beherrscht alle Stile, HipHop, Techno, Rock, Blues, Hardcore, alles. Er kann die schönsten Klanggebilde auf die Bühne zaubern (auch wenn sie teilweise natürlich vom Band kommen). Er ist abwechselnd subtil und brutaL Er kann herumhopsen wie ein Derwisch und hat dabei immer noch seine Gitarre im Griff.
Und das ist sein Problem – oder vielmehr ein Problem, das man als Pop-Konsument mit seiner Virtuosität haben kann. Die Richtungslosigkeit macht dich ratlos; irgendwann wird dir das alles zu viel; du sehnst du dich nach Beschränkung, nach Besinnung auch. Wenn Moby beispielsweise seine traurige Weise „Why Does My Heart Feel So Bad?“ oder, auch nicht gerade fröhlich und mit brummender Stimme, Springsteens „I’m On Fire“ anstimmt, dann ist die Stimmung unter den Leuten längst so aufgeheizt, dass es nur noch eines gibt: Ekstase. Mobys Spiel ist ein Spiel ohne Grenzen. Und die Begeisterung, die er damit beim Publikum weckt, ist es auch. Dass er sich dafür immer gleich mehrmals bedankt mit einem „tahnkyou-thankyou-thankyou-thankyou-thankyou“, mag ja seine Berechtigung haben, wirkt aber schon beim zweiten Mal ziemlich affig. Das ändert nichts: Ein großer Könner fegte über die Bühne.
Zuletzt blieb nur noch die Selbstfeier, die er wie ein Messias mit bloßem Oberkörper beging. Moby – er gleicht einem Maler, der alle Farben mischt und am Ende doch bloß Weiß erhält.