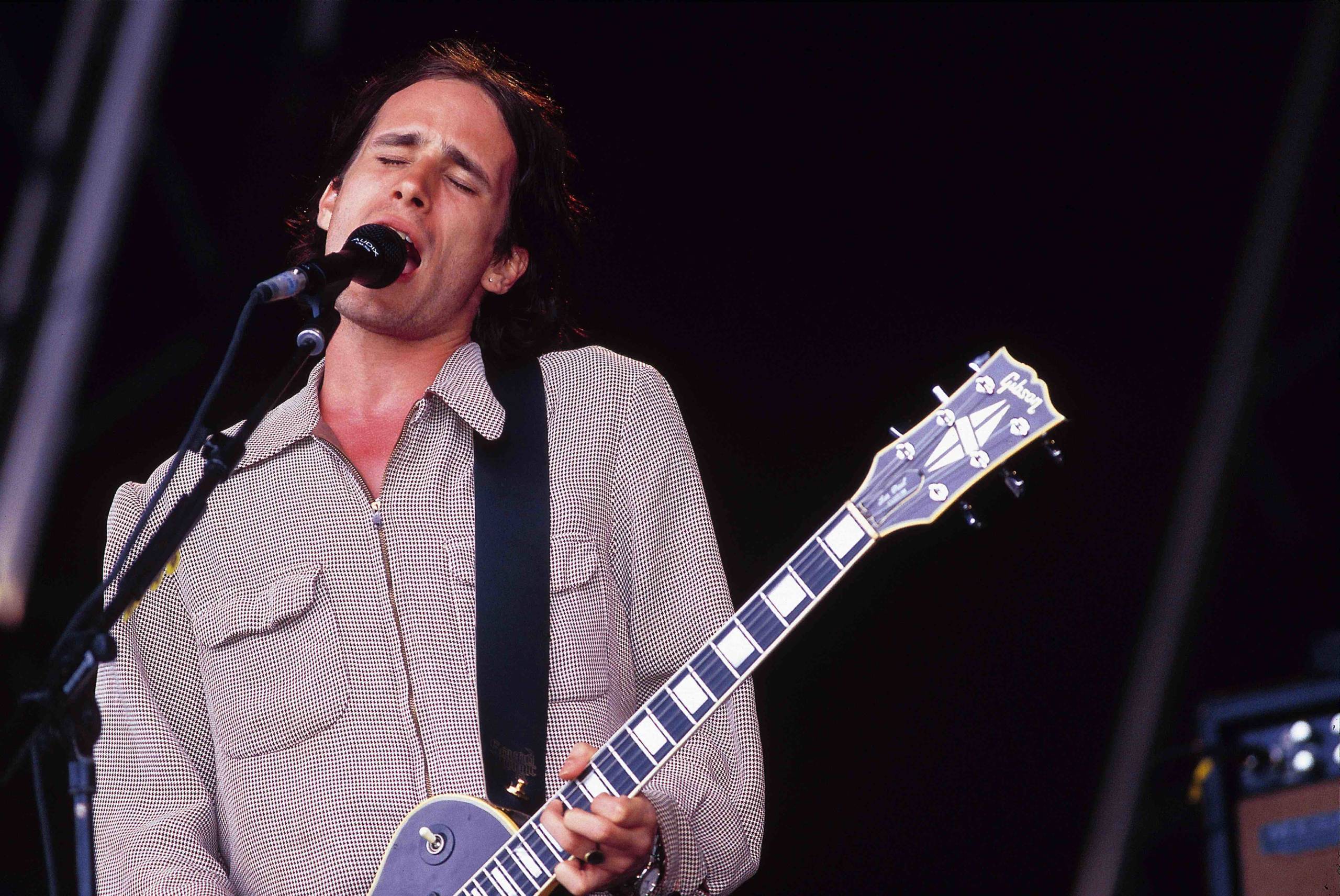Mit neuester Studiotechnik kommt die Kunst von John Cale seinen inneren Antrieben und Wünschen ein Stückchen näher

Leicht surreal kommt es einem vor, eine noktambule Gestalt wie John Cale um zehn Uhr früh zu treffen. Zunächst trifft das Fußvolk ein, der Laptop wird angeschlossen, dann wird man von der Managerin begrüßt, schließlich kommt Cale mit leidendem Blick, bestellt einen doppelten Expresso, setzt sich auf die Couch und fragt gleich, ob wir anfangen können, er habe viele Interviews heute, denn „the record’s done something“. Er meint sein neues Album „HoboSapiens“, auf das Cale verdammt stolz zu sein scheint.
Er wirkt zwar etwas muffelig, schaut aber sehr fit aus, braun gebrannt, durchtrainiert, mit einer an den Seiten seltsam geknüpften Hose, die seine blanken Oberschenkel durchblitzen lässt. „I’d love it if that window was open and gave me some fresh air“, murmelt er unbestimmt in den Raum hinein, und da ich mittlerweile neben ihm der Einzige bin, der sich noch dort befindet, mache ich das Fenster auf.
Zehn Uhr morgens, sagt er, das sei für ihn die Zeh, zu der er sonst immer ins Studio gehe, gegen 14 Uhr lasse er dann die Arbeit ruhen und gehe in die Sporthalle, um zu trainieren. Das fehle ihm jetzt ein bisschen, noch mehr aber fehle ihm sein Energy-Pulver, das er sich sonst immer in seinen Saft mixe. „Das ist eigentlich für Leute, die sich von Darmoperationen erholen. Aber ich nehme das jeden Tag. „It really has a great Wellness factor to it.“ Was folgt, sind medizinische Erklärungen, die einen innerlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen lassen. Sitzt man hier in der Sprechstunde oder was?
„HoboSapiens“ klang beim ersten Hören alles andere als gesund und nach Aufnahmen vom frühen Morgen schon gar nicht. Es tönt recht dunkel, ein bisschen unheimlich, irritierend, man fühlt sich regelrecht attackiert. Erst nach mehreren Durchläufen wird einem die Schönheit dieses Werks bewusst. Man kennt das so von Cale, der immer auf einen schmalen Grat zwischen perfektem Pop und Zerstörung, zwischen Genie und Wahnsinn, wie man so sagt, zu balancieren scheint. Die schönsten Momente im Konzert sprengte er, indem er sein Piano mit den Ellenbogen traktierte, der Avantgarde von „Church Of Anthrax“ stellte er die Kammermusik „Paris 1919“, den Pop von „Slow Dazzle“ und den Terror von „Sabotage “ entgegen. Cale fühlt sich zum Chaos hingezogen, misstraut jeder Form von Ordnung.
In Wales aufgewachsen, sprach Cale bis zu seinem siebten Lebensjahr nur walisisch, sein Vater allerdings, ein englischer Kohlearbeiter, war dieser Sprache nicht mächtig. „Meine Großmutter hat den Gebrauch von Englisch bei uns zu Hause nicht geduldet Wohl vor allem, weil sie enttäuscht war, dass meine Mutter diesen mittellosen Arbeiter geheiratet hatte, wo sie doch alles unternommen hatte, um ihren Kindern eine universitäre Ausbildung zu ermöglichen – meine Mutter war Lehrerin und sie so aus diesem Milieu rauszuholen. Ich habe meine Großmutter dafür gehasst, und ich habe Walisisch gehasst Ich könnte das zwar noch sprechen, aber der Magen würde sich mir umdrehen. Ich spreche nur noch Englisch.“
Die Ablehnung der – im wahrsten Sinne des Wortes – Muttersprache, und damit der ersten Ordnung, mit der er überhaupt konfrontiert wurde, ist scheinbar ein Schlüssel zum Werk des Künstlers John Cale. Er hat sein Leben lang keine Form höherer Ordnung akzeptieren können, sich aber gleichzeitig immer nach einem regelnden Prinzip gesehnt So studierte er schon mit 15 die Werke großer Philosophen von Kant bis Russell. Auch in den Texten des neuen Albums sind die Spuren dieser Sehnsucht in den noch deutlich erkennbar: „In Zen and the Art of Algebra there is no value for time“, „Archimedes and me both married in our own way/ To old ideas in new clothes“.
„Ich glaube, dass es so was gibt wie ein Prinzip, auf das wir alles zurückführen können, auch wenn der Vers in ,Archimedes‘ natürlich vor allem ein Witz ist: Archimedes and me, we go back a long way (lacht). Ich bin beispielsweise überzeugt davon, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, auf den sich jede Form von Musik zurückführen lässt, auf etwas, was jeder versteht. Aber ich habe ihn nie gefunden. Vielleicht ein Grund dafür, dass ich mit meiner Musik niemals viele Menschen auf einmal erreichen konnte.“
Als Schüler der Avantgardekomponisten La Monte Young und John Cage hatte Cale in den frühen 60ern in New York traditionelle Vorstellungen von Tonalität und Struktur innerhalb der Musik verworfen, um kurz darauf dann doch an traditionellen Songformen zu arbeiten. Die Songs aber stammten von Lou Reed, Cale kümmerte sich um Sound, Improvisation und Irritation. Ersten eigene Lieder schrieb er erst nach seinem Rausschmiss bei Velvet Underground, und auch die wirkten, als habe er die Songs anderer Künstler zerstört, ausgeplündert und neu zusammengesetzt. Ein manisch Getriebener, der, weil er die Ordnung nicht anerkennt, erst Ruhe gibt, nachdem er alles zerschlagen hat, um dann die Bruchstücke zu transzendieren und ihnen eine neue, fremde, vielleicht gar höhere Bedeutung abzugewinnen.
Besonders gut gelang ihm das auf seinem 1982er Meisterwerk „Music For ANew Society“, einem klaustrophobischen Albtraum von einem Album, das er – wie auch „Hobo Sapiens“ praktisch im Alleingangkonzipierte. „Ja. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den beiden Alben. Aber die Produktion von ‚New Society‘ war viel umständlicher, weil das alles über Tape-Maschinen lief. Aber jetzt, mit dem Computer, kann man einfach viel mehr machen. Du gehst ins Studio, findest einen loop, den du magst, findest einen Sound, mit dem du arbeiten möchtest… Der französische DJ Dimitri Tikovi hat mir einige sehr seltsame, irritierende loops geschickt. Das war quasi der Ausgangspunkt. Die Songs sind bis auf zwei alle aus Sounds entstanden, aus Geräuschen, aus Krach, nicht aus Akkordwechseln. Für mich hat das Album eine sehr sinnliche, auch befreiende Natur, die aus den Atmosphären entstand, die diese Kombinationen von Sounds und loops haben. Der Entstehungsprozess ist mir immer noch rätselhaft.“
Diese beunruhigende Mischung aus TripHop, seltsamen Geräuschen, Ambient und Weltmusik scheint in gewisser Weise Cales Misstrauen, Wünsche und Antriebe genauer abzubilden als alles, was er zuvor aufgenommen hat gerade, weil es sich nicht in Kategorien fassen lässt und weiterzieht statt sich festzulegen. Schon der Albumtitel „Hobo Sapiens “ (vernunftbegabter Landstreicher?) deutet darauf hin, dass es hier nicht um Ziele, sondern um Wege geht „Es geht hauptsächlich darum, aus sich selbst herauszukommen – herauszureisen, wenn du so willst. Ich meine, da ist eine Menge über Wiedergeburt drin. Das ist mir ein bisschen peinlich. Aber ich kann’s nicht bestreiten, es ist da.“
Der Hobo deutet aber auch auf einen amerikanischen Mythos, der eng verbunden ist mit Ikonen der amerikanischen Songkunst wie Jimmie Rodgers und Woody Guthrie. Hat sich Cale, der sich immer zwischen den Welten – der alten europäischen und der neuen amerikanischen, der der Avantgarde und der des Pop und klassischen Songwritertums – bewegte, etwa jetzt für eine Seite entschieden? „Dieser ganze Mist darüber, eigentlich ein europäischer Komponist sein zu wollen, ist ja sinnlose Energieverschwendung. Ich lebe länger in New York, als ich in Europa gelebt habe, und schon als Kind war mir klar, dass ich ein New Yrker bin, dass ich da eines Tages leben werde. Für den Moment, mit diesem Album, fühle ich mich auch in der Songschreiberposition ganz wohl. Nick Fragten von Lemonjelly hat mir zwar am Ende geholfen, einige Songs richtig hinzukriegen, doch ansonsten ist ‚Hobo Sapiens‘ das totale Gegenteil einer Kollaboration: Es ist ausschließlich ein Produkt meiner Imagination.“
Dann lehnt John Cale sich zufrieden zurück. Da hat die Sprechstunde ja doch noch was gebracht.