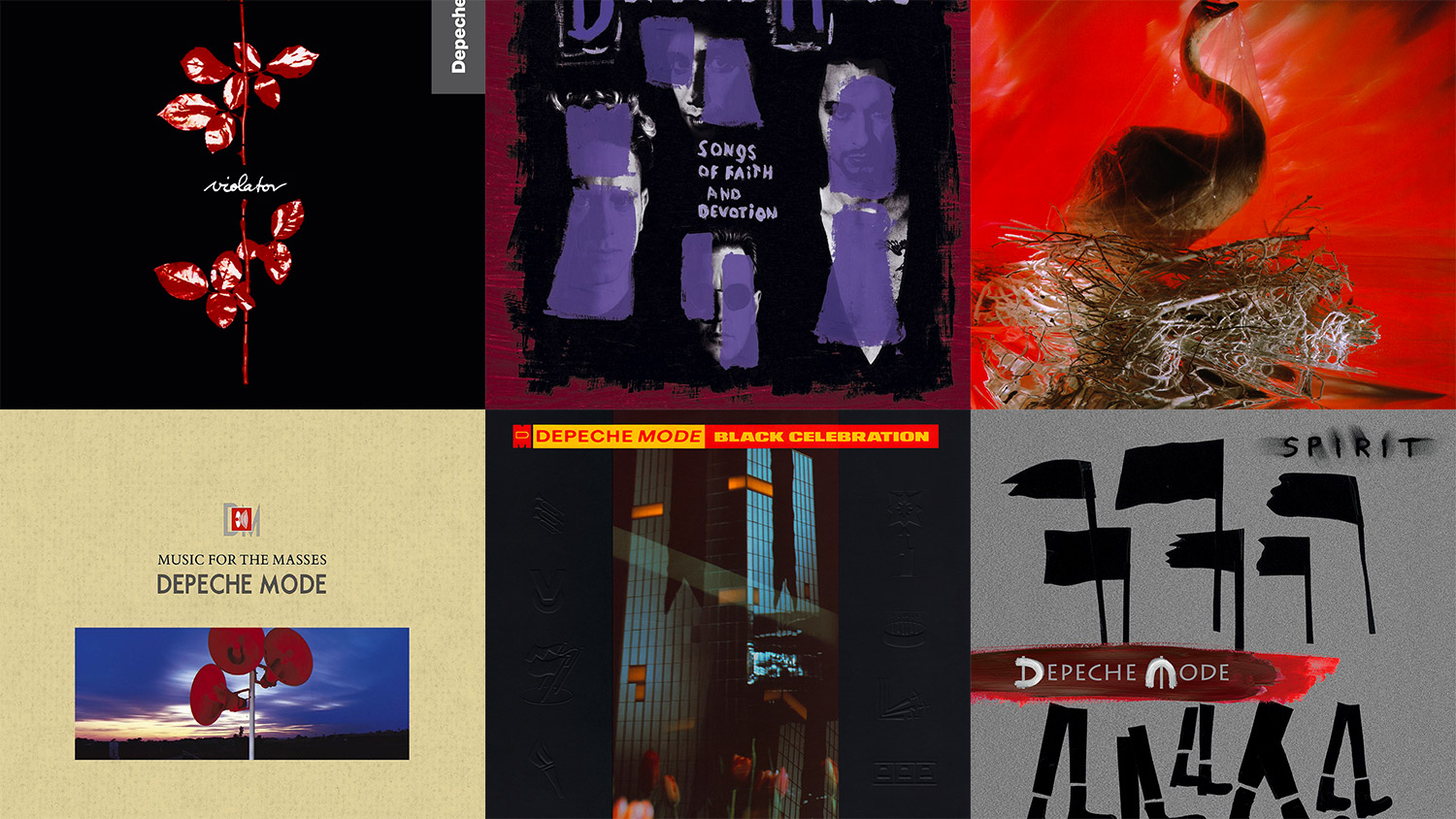Hölle, Marsch, Metal: Wie die Amerikaner Rammstein sehen
David Fricke - einer der dienstältesten Redakteure des amerikanischen ROLLING STONE - erklärt uns den Blick seiner Landsleute auf das Phänomen Rammstein. Hölle, Marsch, Metal: Wie die Amerikaner Rammstein sehen

Hölle, Marsch, Metal: Wie die Amerikaner Rammstein sehen
ROLLING-STONE-Archiv: Ein Artikel aus dem Jahr 2012
Am einem Abend im Februar 1984 – genaugenommen war‘s schon der frühe Morgen – stand ich gefährlich nah vor der Bühne der „Danceteria“, dem längst geschlossenen New Yorker Club, wie hypnotisiert von der rohen mechanischen Gewalt der Einstürzenden Neubauten. Es war der erste Auftritt der Berliner Band in den USA. Und der radikale Erfindungsgeist ihrer Avant-Rock-Kollisionen hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Die gutturalen Urschreie und knochenklappernden Riffs von Blixa Bargeld wurden von synkopierten Rhythmen befeuert. Die auf Ölfässern und verbeulten Blechen generiert wurden. Es war der letzte Akt eines Psychodramas, das wohl irgendwann einmal mit Elvis und den Rolling Stones begonnen hatte. Nun aber mit gnadenlosem Modernismus und ohrenbetäubendem Lärm auf die nackte Raserei reduziert wurde.
Als das letzte verzerrte Scheppern von „Zeichnungen des Patienten O.T.“ aus der völlig überforderten PA verklungen war, drehte ich mich um und sah Alan Vega, die singende Hälfte der New Yorker Minimalisten Suicide. Er grinste über das ganze Gesicht. „Das war nicht übel“, sagte er. „Aber das haben wir – in kleinerem Rahmen – schon vor zehn Jahren gemacht.“

15 Jahre später musste ich an diese Szene denken, als ich mit der gleichen gespannten Erwartung Rammsteins erstes großes New Yorker Konzert im „Hammerstein Ballroom“ verfolgte. Die sechsköpfige Gruppe aus Berlin hatte zuvor schon diverse Showcases in den USA gespielt. 1997 bei der „CMJ College Radio Conference“. Und war im folgenden Jahr Teil der „Family Values“-Tour gewesen. Glaubte man der Mundpropaganda der lokalen Chef-Headbanger, waren sie in diesem Rap-Metal-Paket sogar der „real deal“. Auch wenn sie im Line-up erst hinter Korn und den Krawallköpfen von Limp Bizkit aufgeführt wurden.
Wie in einer Wagner-Oper
Zu ihrem Headliner-Debüt in New York kamen die Deutschen so, wie man es von ihnen erwartet hatte. Mit einem Höllen-Spektakel und grimmig-militaristischem Auftreten. Laser-Pointer und Feuer-Säulen illuminierten eine Bühne. Die mit so vielen Rohren und Gerüsten vollgestopft war, dass man eine ganze Öl-Raffinerie damit hätte bestücken können. Die Band, perfekt futuristisch gekleidet, setzte eine überdimensionale Marsch & Metal-Maschinerie in Gang, die von satanischem Synthesizer-Staub berieselt wurde.
Der Gesang passte genial zum schneidigen Befehlston, der – für amerikanische Ohren zumindest – bei deutschen Texten fast unvermeidlich scheint. Sänger Till Lindemann ließ zwischen seinen grunzenden Urlauten zwar jede Melodik vermissen. Wirkte mit seinem melodramatischen Auftreten aber gleichzeitig wie ein Opernsänger. Ein Opernsänger aus der Klapsmühle. Ein Mann, dem man besser nie „Nein“ sagen sollte. Als dann noch die Gitarristen Richard Z. Kruspe und Paul H. Landers in die Chant-ähnlichen Gesänge einstiegen, fühlte man sich in eine Wagner-Oper versetzt, für die Nine Inch Nails als musikalische Begleitung verpflichtet wurden.
Lärm und Feuerzauber
Zum Ende dieses Jahrzehnts, in dem der vermeintliche „Modern Rock“ schlimmer war als der Mainstream, waren Rammstein ein erfrischend unterhaltsamer Frontalangriff. Im Lärm und Feuerzauber ihres Auftritts konnte man aber durchaus ihre Vorbilder erkennen. Ich stellte mir vor, dass Vega wieder hinter mir stand. Zusammen mit Bargeld, den britischen Doom-Punk-Ahnen Killing Joke, Al Jourgenson von Ministry und der 70er Besetzung von Faust. Den ersten Deutschen, die aus westlichem Beat, maschineller Orchestrierung und Dada einen neuen Rock schufen. Und sie alle nickten und sagten: „Ja, das ist alles ganz lustig. Aber wir haben’s schon damals gemacht. Und damals hatte es noch die Aura des Riskanten und Gefährlichen.“
Das ist eben das Problem jeder cartoonhaften Überzeichnung – vor allem, wenn man damit den kommerziellen Jackpot zu knacken versucht: Die Leute vergessen die anfängliche Subversivität. 1996 holte sich Trent Reznor, ein früher Verehrer, zwei Tracks vom Rammstein-Debüt „Herzeleid“ für den Soundtrack zu David Lynchs kryptischem Thriller „Lost Highway“. Andere Beiträge auf dem Album stammten von David Bowie und den damals nicht minder angesagten Smashing Pumpkins. Für Rammstein war es das Gütesiegel „Cool“ – und die Tür nach Amerika wurde weit aufgestoßen.
Doch der „Cool“-Faktor sollte wieder schnell verblassen, nicht zuletzt ausgelöst durch den unerwarteten kommerziellen Erfolg (unerwartet, da es sich schließlich um deutsche Texte handelte). Die Medien interessierten sich natürlich nicht für die sublimen Rammstein-Botschaften, für die paranoiden Selbstzweifel und den Horror völliger Isolation (perfekt umgesetzt im frühen „Engel“), sondern stürzten sich auf ihren flamboyanten Auftritt und die unvermeidlichen Nazi-Assoziationen. Als ich damals Rammstein zum ersten Mal sah, waren sie bereits das Industrial-Metal-Äquivalent zu den Scorpions, Deutschlands erfolgreichstem Exportartikel in diesem Genre. Von „Sehnsucht“, Rammsteins zweitem Album aus dem Jahr 1997, wurden allein in den USA immerhin zwei Millionen Exemplare verkauft.
Sie sind nur Nachgeborene
2001 kam die Band erneut ins „Hammerstein“ und wurde zum Abschluss mit einem Promi-Finale geehrt: Marky und CJ Ramone kamen zusammen mit Jerry Only von den Misfits auf die Bühne und versuchten sich gemeinsam an „Pet Semetary“ von den Ramones. Für den Rest des Jahrzehnts machten sich Rammstein in Nordamerika rar, doch als sie 2010 wieder aufkreuzten, waren die Arenen bis unters Dach gefüllt. Als sie im Dezember den Madison Square Garden spielten, grölte das Publikum sogar ihre Texte mit.
In gewisser Weise haben Rammstein für diesen Erfolg aber auch zahlen müssen. „Leiht euer Ohr einer Legende“, singt Lindemann im „Rammlied“ vom 2009er Album „Liebe Ist Für Alle Da“. Das Album marschierte zwar in die amerikanischen Top 20 (wenn auch nur kurzzeitig), doch was die Fusion von Rhythmus, Elektronik und hypnotischer Monotonie betrifft, sind die wahren Legenden eben immer noch Can, Neu! oder Guru Guru. Das sind die deutschen Namen, die – neben Kraftwerk, Faust, ja selbst den frühen Tangerine Dream – nach wie vor fallen, wenn man von den revolutionären Vorreitern spricht, die vor 40 Jahren zwar kaum Platten verkauften, aber noch heute lange Schatten werfen. In ihrem Metier gehören Rammstein sicher zu den besten, in jedem Fall zu den größten Bands. Doch: Sie sind nur Nachgeborene. Und Risiko ist im Showbiz nicht gefragt. Und Ruhm – so substanziell er auch sein mag – ist nicht die automatische Vorstufe zur Legende.
Rammstein kamen, siegten und machen – inzwischen in ihrer Greatest-Hits-Album-Phase angekommen – noch immer gute Geschäfte in den USA. Sie haben hier mehr erreicht als jede andere deutsche Band ihrer Generation. In ihrer Heimat mögen sie bereits Teil des kollektiven Bewusstseins sein, doch ob sie im Land, in dem der Rock geboren wurde, ebenfalls Geschichte schreiben werden, steht noch in den Sternen.