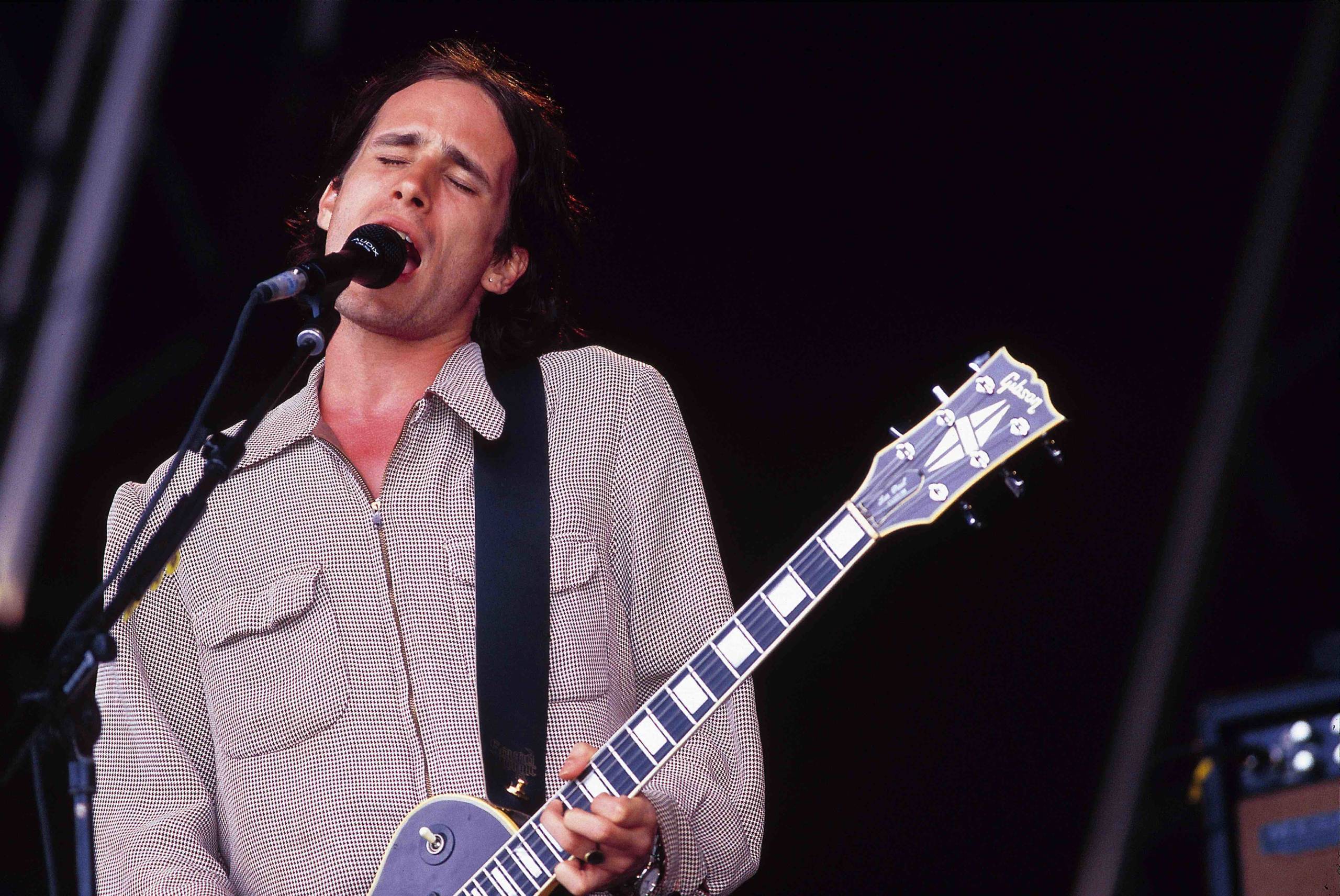Low Fidelity – Die Misere der deutschen Pop-Literatur
Nach den fröhlichen Jahren der Pubertäts- und Plattensammlungs-Ausbeutung mit Buch-Schlagern von Lebert, Stuckrad-Barre, Hennig-Lange, Regener und Goosen ist der Markt übersättigt. Echter Rock'n'Roll und widerborstige Lektüre werden in Deutschland schleppend wahrgenommen - oder gar nicht.

Vor ein paar Jahren wurden sie mit Pauken und Trommeln ausstaffiert, ein Hamburger Nachrichtenmagazin hievte sie aufs Cover. Kulturpessimisten debattierten Sinn und Unsinn der „neuen deutschen Dichter“. Der Rubel rollte, die Kassen klingelten. Manchmal rollten Literaturagenten auch die roten Teppiche aus. Seltener klang es aus den Büchern wie erwartet. Gefeiert und gekauft wurde „Popliteratur“ trotz programmierter Verramschung – ja geradezu wegen derselben. Die Regale bei „Thalia“ sind rammelvoll mit den Paperbacks, Stuckrad wurde bei Goldmann gleich noch mal weniger formschön aufgelegt.
Schon der Begriff musste ja schnell peinlich werden, mehr Verkehrtes als nichts sagend. Aber eine Zeit lang war alles Fun und Pop. Unter Vertrag kam, wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Cocktails bestellte, jung war und hübsch genug für Titel und Talkshows, vor allem bereit dazu, jeden Scheiß mitzumachen – und dabei jung und frech, aber doch manierlich genug war für jeden Gabentisch. Heute ist Popliteratur ein Unwort – wer in der Literatur agiert und Pop erwähnt oder gar zitiert, bemüht sich, an der Front der U- versus E-Kultur nicht allzu deutlich Stellung zu beziehen. Same old song&dance, alles wie gehabt? Fast.
Irre: Beim Gesamtumsatz von Tonträgern machen Rock & Pop mehr als die Hälfte, Klassik weniger ab zehn Prozent aus. Im Buchdruck ist es immer noch umgekehrt – trotz einiger Hits der Unernsten. Irre {slight return): Der Begriff „Rock & Roll“ ging vor mehr als 50 Jahren über den Äther, noch 1966 rätselte man bei der Deutschen Grammophon, ob das Tochterlabel Polydor diesen neuen Künstler aus England veröffentlichen solle – und verdiente an ihm (Hendrix) Abermillionen. Doch im Elfenbeintürmchen des Buchdrucks disputieren immer noch die Verfechter der Hochkultur darüber, wie deutsche Dichter denken; verteidigen quasi mit den Argumenten der Konservatorien Mozart vor Rock’n’Roll.
Aus London kam denn auch der Urknall, der in Buchverlagen dazu führte, dass Taschenrechner gezückt und das Label „Popliteratur“ zurechtgehämmert wurde. Nick Hornbys „High Fidelity“ zeigte, dass ein Thema, das Millionen bewegt, sowohl literarischanspruchsvoll als auch unterhaltsam und zugleich kommerziell erfolgreich sein kann. Der dem deutschen E-Kulturwesen vertraute Bauchnabel-Betrachter Peter Handke hatte sich zwar bereits 1990 einen „Versuch über die Jukebox“ aus dem Griffel gezwungen, aber ansonsten war Pop zwischen Buchdeckeln bis zu Hornby eigentlich nur für Legastheniker oder „ab 15“; ein von seelen- und verständnislosen Sachbearbeitern betreuter Hort für Denkschwache („Sie entfesseln mit ihrer Musik die Apokalypse, bis die Toten wirklich auferstehen“ – Klappentext von 1986).
Verleger hatten einfach nicht damit gerechnet, dass nach 1960 Geborene (laut Statistik zu wachsenden Teilen nicht nur im Beat, sondern auch in der Schule gebildet) mehr wollten als Grass und Walser (beide Jahrgang 1927!). Außer Erkenntnis zum Beispiel Wiedererkennen, außer Intertextuellem zur Antike beispielsweise etwas über Gefühlspenetration via Gehörmuschel und Stroboskop. Schleunigst wurde „Trainspotting“, bislang bei Rogner & Bernhard via Zweitausendeins-Versand und -Läden nur limitiert erhältlich, von einem Major lizenziert, riesig verkauft. KiWi durchforstete die Mitarbeiterlisten des Süddeutschen Verlags nach Leuten, die jung, hübsch und originell genug schienen, um sich als Pop-Literaten verkaufen zu lassen. Es brummte in allen Ecken – und poppig. Stuckrad-Barre verkaufte eine Viertel Million, Benjamin Lebert von der Internats- und Samenerguss-Novelle „Crazy“ gleich die Filmrechte, andere (meist ähnlich wenig frech und wild, aber jung) auch genug, um in der Welt der Bücher so etwas wie die NDW auszulösen.
Gar nicht so einfach für Lektoren, die ihren Job bekamen, weil sie über Pragmatik und Semantik von Metonymie dissertiert hatten. Da saßen sie nun, kannten gerade den Unterschied zwischen einem Tom und Phil Collins und sollten Pop-Literatur finden. Sie verrührten ihre Kontakte nach Übersee, garnierten die Titel mit bunten Covern, und manchmal trafen sie das Wohlwollen der Kritik, manchmal das Interesse der Käufer. Wirklich gerockt wurde in den meisten Büchern wenig. Wurde es wirklich wild, so kam (bei „Sex, Space & Rock’n’Roll“ von Linda Jaivin, Hoffmann 8C Campe 1999) im Anhang mit Erklärungen wie: „S. 183: Spinal Tap – satirischer Film über die Welt des Hard Rock mit gleichnamiger (erfundener) Band“.
Die mit hohen Vorschüssen bedachten „Wunderkinder“ (die resche Journalistin Rebecca Casati kassierte für ihre Rollenprosa „Hey Hey Hey“ mehr als Imre Kertesz für sein Gesamtwerk) wurden immerhin von der etablierten Kritik beäugt. Mit Pop im Sinne von Rock’n‘ Roll, Rebellion oder gar Formattacken ä la Warhol hatte das nichts zu tun; eher mit Popcorn. Light, aufgebläht und klebrig, superschnell ge- und vergessen. Egal, wenn was auf den Boden fallt und zertrampelt wird. Schwund gibt es schließlich überall.
Immerhin bewegt sich was, sichtbar auch in den Verkaufscharts. Die Lit-Vignetten von Wladimir Kaminer entsprechen dem Paradigmenwechsel von der Klassik zum Singles-orientierten Rock’n’Roll, „Russendisko“ (Goldmann) ging in die Top 100 der Hardcover-Belletristik Bestseller 2001 ein, ebenso das „Liegen lernen“ (Eichborn) von dem Tresenlesen-Dichter Frank Goosen und die Kneipentour „Herr Lehmann“ (Eichborn) des Element Of Crime-Trompeters Sven Regener. Kommerziell weniger auffällig, für Musik-Lover jedoch guter Stoff kam von Sister Souljah („Der kälteste Winter aller Zeiten“, „Diana“), von dem angenehm ironischen „Pop-Besessenen“ Christian Gasser („Mein erster Sanyo“, Edition Tiamat), in Form der von Tobias O. Meißner sorgfaltig codierten Cobain-Ode und Grunge-Meditation, „Halb-Engel“ (Rotbuch). Alles voller Feeling und Referenzen zu Sounds, die zwar viele kennen, aber nicht jeder versteht. Dass noch mehr geht, zeigt gerade ,,Dies ist kein Liebeslied“ (Eichborn) von Karen Duve – der Roman wurde von der „SZ“ gleich zum ersten „Post-Pop“-Werk erklärt, weil die Protagonistin nicht weiß, wer David Bowie ist. Zugleich lässt der Konjunkturschwund Verlage wieder vorsichtiger, also konservativer planen. Pop bleibt wieder draußen, statt auf Newcomer setzt die Branche auf etablierte Größen.
Verstanden hatte es ja eh keiner oder wie sonst ließe sich erklären, dass ein Titel, den es solange gibt wie Hornbys „High Fidelity“, erst sieben Jahre nach dem UK-Release hier erscheint, dass er binnen weniger Monate noch mal und noch mal nachgedruckt wird?
Das Marktpotenzial wurde offenbar vollkommen unterschätzt. Doch Giles Smiths vergnügliche Pop-Irrfahrt „Lost In Music“ (Heyne) belegte, dass außer Fan-Memoiren, außer gezappten Shorties der Generation MTV auch Musikermemoiren gekauft, gelesen, gekauft und wieder gekauft werden.
Das Erfolgsrezept, sagt sich mancher im Elfenbeintürmchen, zwar taub, aber nicht blind, sieht so aus: Die Trefferquote ist bei Büchern mit einer Schallplatte auf dem Cover ungleich höher – siehe „Soloalbum“, „Der Boden unter ihren Füßen“ von U2-Freund Salman Rushdie, „Liegen lernen“; dieses Jahr nun also auch „Lost In Music“, Jonathan Coes „Erste Riten“ (Piper) und „Populärmusik aus Vittula“ (btb), eine Cotning-of-age-Ge.schichte, in der Elvis und die Beatles tragende Rollen spielen.
Noch trauriger – und ein Beleg, wie die Verantwortlichen ignorant im Dunkeln stochern: Viele Rock’n‘ Roll-Romane, die mehr beinhalten als Reminiszenzen an „Yesterday“ oder Kalauer zu kindheitlichen Geschmacksverirrungen, erscheinen gar nicht auf deutsch. Romane, die Auf- und Abstieg von Bands thematisieren, voller Sex & Drugs, Betrug und Sound? Es gibt sie in Mengen – von Iain Banks, von Musikern und Musikjournalisten, von Madison Smartt-Bell, dem Finalisten des „National Book Award“…
Einen Überraschungs-Bestseller landete immerhin Jürgen Teipel mit seinem Doku-Roman über deutschen Punk und New Wave („Verschwende deine Jugend“, Suhrkamp). Da kann der US-Underground-Kenner und Burroughs-Vertraute Udo Breger nur ungläubig den Kopf schütteln: Vor Jahren bot er „Please Kill Me“ – eine O-Ton-Collage des Punk, von Iggy Pop via New York Dolls zu Thunders‘ Ende – 18 Verlagen an und kassierte nur Absagen. Das Original wurde mehrmals neu aufgelegt, weil es ein Renner – und übrigens sehr gut – ist. Doch im Vorort Deutschland: Dornröschenschlaf, Wiederbelebung, Mundzu-Mund machen wir mit etablierten Größen, Jahrgang 1927.
Weitere Rock’n’Roll-Romane, bei denen die bpm stimmen, der Fuß mitwippt? Da wären ein Fakt und Fiktion vermischender Krimi über Charles Manson, Hollywood und den gewaltvollen Tod des One-Hit-Wonders Bobby Füller („Dead Circus“); ein Biz-Roman, dem Elvis Costello Humor und Herz attestierte, Lou Reed, dass er „zum Schreien komisch“ sei („A&R“); ein Road-Roman („Go Now“) mit Empfehlungen William Gibsons. Oder die weise, hellseherische Vision von Don DeLillo, der schon vor Jahrzehnten die Faszination Dylans gegen Alice Coopers austarierte („Great Jones Street“). Oder Mark Lindquists „Never Mind Nirvana“, das gekonnt Rock’n’Roll als Lifestyle präsentiert, natürlich in Seatde – Grunge und Kaffeehäuser als Kulisse einer „American Psycho“-Krise voller Labels, Etiketten, Songtitel und Referenzen, die man versteht, auch wenn man aus Semantik-Seminaren einst desertierte.
In Deutschland erwartet man derweil nur Kurt Cobains Tagebücher.