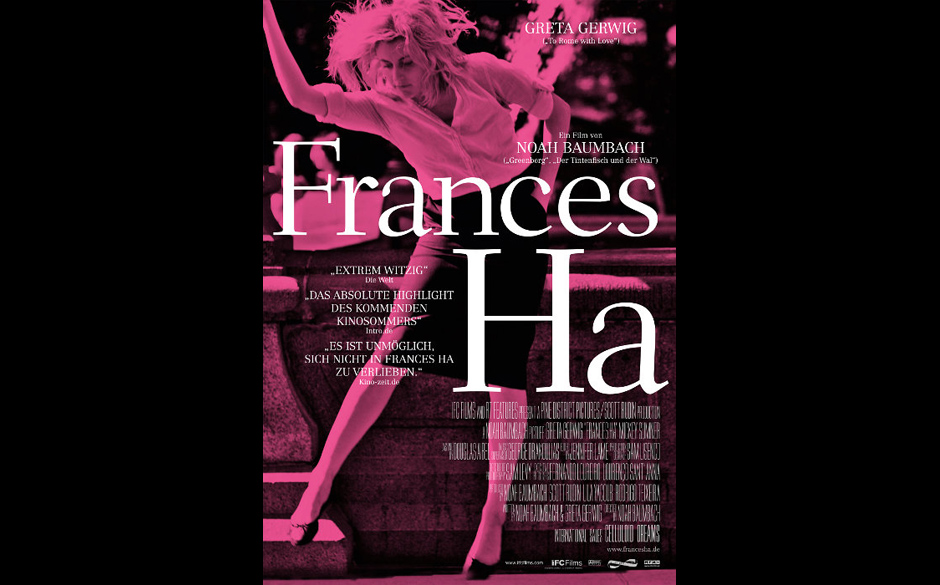Long Fin Killie verbinden Percussion-Pop mit politischen Diskursen

Der Mann kann reden, und er tut es. Luke Sutherland ist ein Agitator, der daran glaubt, mit jedem Song ein issue behandeln zu können. Seine Anliegen sind konkret, seine Ausführungen explizit. Trotzdem ruft seine Band Long Fin Killie so viele Mißverständnisse hervor wie wenige andere.
Nach dem ersten Album der Schotten – Mißverständnis Nummer eins – wurde allerorten von der „homosexuellen Band Long Fin Killie“ geschrieben. Mal abgesehen davon, daß es Schwachsinn ist, Menschen ihre sexuellen Vorlieben als adjektivisches Muß aufzuschultern, wird hier noch einmal eine weltläufige Denkweise deutlich: Jemand, der über Homosexualität singt wie Sutherland auf „Houdini“, muß aus den Stereotypen herausfallen. It’s the Singer, not the song, basta.
In Amerika, wo ja derzeit alle über „Queercore“ reden, machte die Band denn auch eine befremdliche Erfahrung. „Da war dieser Journalist“, sagt Sutherland. „Irgendwann kamen wir auf unsere sexuellen Präferenzen zu sprechen, da war er ganz enttäuscht. Wie sich herausstellte, wollte er eine Reportage über homosexuelle Punkbands schreiben. Wir kamen dann nicht darin vor, weil wir nicht tun wollten, als wären wir schwul.“ Das zweite Mißverständnis: Long Fin Killie sind ein Haufen Hippies. Das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, genauer: an Sutherlands Rasta-Zöpfen. Die Band musiziert alles andere als zurückgelehnt, sondern – ihrer agitatorischen Attitüde entsprechend – mit Anspannung. In ihrem Percussion-Pop ist jeder Ton mit dem anderen verkeilt. Trotzdem bleibt Raum für Improvisation. Auf der Bühne sind Long Fin Killie, die wie ein Free-Jazz-Ensemble zu Werke gehen, seltsam anzuschauen: In sich versunken und doch hellwach. Trance ohne Tran.
Seit Ende der Achtziger arbeiten die vier zusammen, aber „Valentino“ist erst das zweite Album. Und eine weitere Sammlung von issues. „A Thousand Wounded Astronauts“ handelt von Männerritualen. Ein extrem ruhiges Soundscape – immer wenn Long Fin Killie am sanftesten sind, sind sie am härtesten. Der Titelsong nimmt den Mythos Hollywood auseinander. Sutherland, als ein Schwarzer im „statistisch weißesten Distrikt von Schottland“ aufgewachsen, meint: „Schwarze sind hier immer noch unterrepräsentiert. Deshalb wünscht sich der Erzähler, wie Spencer Tracy zu sein. Der verkörpert noch immer den good white guy, für den es kein schwarzes Pendant gibt.“ Auf“ Valentino“ geht es um Images, Stereotypen, Marketing. Und auch um deren Rolle im Bereich gender politics. „Ich verstehe diese Pornographie-Debatte nicht. Das Bild der Frau wird doch nicht vorrangig da geprägt. Entscheidender sind Zeitschriften, die bestimmte Stereotypen formen.“ Lachend erinnert sich Sutherland: „Ich weiß noch, wie die Zeitschrift ,Loaded‘ das Foto einer Frau mit Brusthaar gedruckt hat. Ein paar Typen haben ganz verstörte Leserbriefe eingeschickt. Nun ja, jetzt wissen sie, daß manche Frauen Brusthaare haben.“