Lisa Hallidays spektakulärer Debütroman „Asymmetrie“: Dichtung und Wahrheit
„Asymmetrie“, längst zum literarischen Phänomen erkoren, ist eine kluge und komische Metafiktion über Macht und Literatur, Terror und Überwachung.

Es gibt in diesem Roman eine Szene, in der eine Interviewerin der BBC-Kultserie „Desert Island Discs“ von dem renommierten amerikanischen Schriftsteller Ezra Blazer – eine fiktive Figur, die allerdings Assoziationen zu Philip Roth weckt – wissen will, ob dessen Romane ausschließlich das Produkt einer ausschweifenden Fantasie seien oder zumindest einen autobiografischen Kern hätten. Ezra, ein hochdekorierter Autor, der sein Leben ganz dem Schreiben gewidmet hat, entgegnet, der Versuch, Wahrheit und Fiktion zu trennen, sei aber an sich schon vergeblich: „Unser Gedächtnis ist doch keinen Deut verlässlicher als unsere Fantasie.“
Amazon Lisa Hallidays an genialischen Kunstgriffen reicher Debütroman, „Asymmetrie“, kreist nicht zuletzt um dieses Paradox. Denn die Autorin nutzt die Frage, inwiefern die eigene Lebenserfahrung unsere Wahrnehmung bestimmt, als Ausgangspunkt für eine Erkundung der persönlichen, politischen und geografischen Verwerfungslinien der Gegenwart.Letzte Muse von Philip Roth
Der „New Yorker“ feierte den Roman, an dem Halliday seit 2011 gearbeitet hatte, bereits als „literarisches Phänomen“. Das große Interesse hat dabei sicherlich auch mit ihrer Hintergrundgeschichte zu tun, die man als illuster bezeichnen darf: Aufgewachsen in Massachusetts, Kunststudium in Harvard, Arbeit als Lektorin und Übersetzerin in Mailand, Karriere als Literaturagentin bei der berühmten Wylie Agency, in ihren Zwanzigern war sie für einige Zeit mit dem im Mai dieses Jahres verstorbenen Philip Roth liiert.
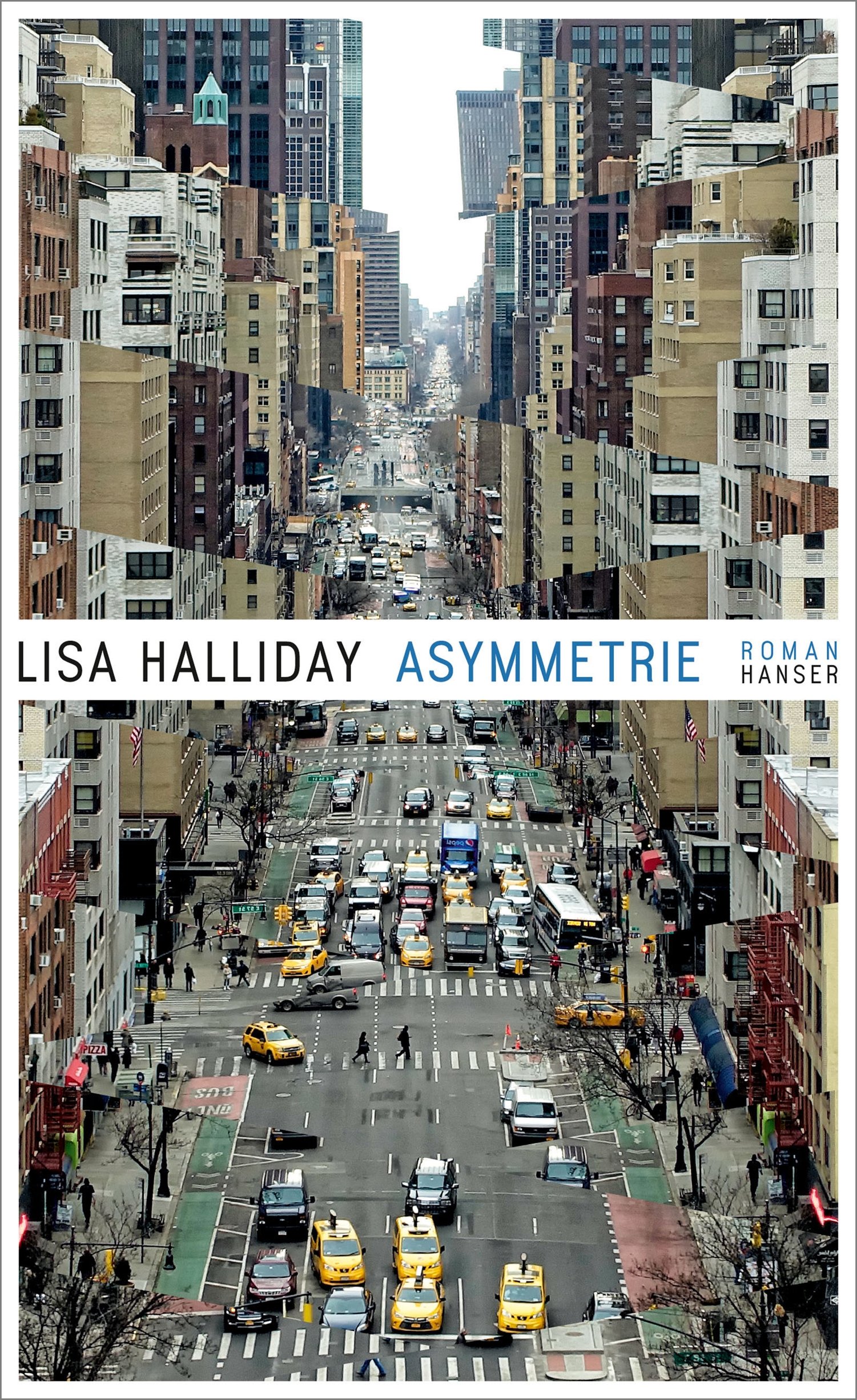
Wenn also im ersten Teil von „Asymmetrie“ die Protagonistin Alice auftritt, die bei einem New Yorker Verlag arbeitet und eine Affäre mit ebenjenem Autor Ezra Blazer beginnt –„zusammen hatten Ezra und sie siebenundneunzig Jahre gelebt“ –, liegt es nahe, in Alice ein Alter Ego der Autorin zu sehen. Die ist aber natürlich mit allen postmodernen Wassern gewaschen und nutzt diesen Verdacht in diesem äußerst selbstreflexiven Roman, um ihre metafiktionale Schraube noch ein Stück weiter zu drehen.
In pointierten, erzählerisch zunächst noch geradlinigen Episoden unterwandert „Asymmetrie“ Klischees bezüglich der Macht- und Begehrensdynamik klassischer Künstler-Muse-Beziehungen: Alice geht für Ezra Medikamente kaufen und begleitet ihn ins Krankenhaus, er zahlt ihren Studienkredit zurück. Am Wochenende gehen beide gemeinsam ins Kino und schauen Marx-Brothers-Filme oder essen vor dem Fernseher Pralinentorte. Alice fragte sich derweil, welche Pille sie schlucken würde: die eine, die sie nach Europa bringen und zur Schriftstellerin machen würde, oder die andere, die Ezra sie bis an ihr Lebensende lieben ließe.Diese Chronik einer Beziehung zweier New Yorker Intellektueller unterlegt Halliday mit dem Beben des Zeitgeschehens. Im Fernseher laufen Ansprachen von US-Präsident George W. Bush, der Krieg im Irak nimmt gerade seinen Lauf. Zwischendurch erhält Alice Anrufe von ihrem Vater, der krude Verschwörungstheorien verbreitet. Die Leichtigkeit, mit der „Asymmetrie“ zunächst daherkommt, löst sich in diesem Hintergrundrauschen Stück für Stück auf.
Familienbesuche in Bagdad
Plötzlich ist man dann in einem ganz anderen Roman, es beginnt der zweite Teil von „Asymmetrie“, der die Überschrift „Wahnsinn“ trägt: Amar, ein amerikanisch-irakischer Wirtschaftswissenschaftler, sitzt in einer Zelle am Londoner Flughafen Heathrow. Die Behörden halten ihn für einen potenziellen Gefährder und wollen ihn nicht einreisen lassen. Inmitten der kafkaesken Wirren einer modernen Überwachungsbürokratie erinnert sich Amar an seine Kindheit in den USA sowie an Familienbesuche in Bagdad nach Beginn der US-Invasion 2003. Bei seinen ziellosen Streifzügen durch die verwüstete Stadt plagt Amar das schlechte Gewissen des Gasts, der bei Bedarf wieder zurück in die Komfortzone einer westlichen Wohlstandsgesellschaft kann – anders als die Bewohner von Bagdad, die sich notdürftigen Optimismus bewahren mit dem „leicht morbiden Gedanken, dass es ja nicht bis in alle Ewigkeit so entsetzlich weitergehen konnte“.
Die Wege von Alice und Amar kreuzen sich in „Asymmetrie“ zu keinem Zeitpunkt. Halliday lässt beide Geschichten nebeneinander koexistieren und überlässt es ihren Lesern, sie zueinander ins Verhältnis zu setzten. Diese von jeglicher Kausalität befreite Erzählweise mag zunächst wie eine Verweigerungsgeste anmuten. Jedoch gewinnt der Roman seine einschneidende Wirkung gerade dadurch, dass man als Leser so tief in die Bedeutungsproduktion verwickelt wird.
Neue Form des Erzählens?
Dass dieser literarische Hochseilakt funktionieren kann, liegt auch daran, dass Hallidays Gespür für dialoggetriebene Situationskomik ebenso groß ist wie ihr Bewusstsein für die Dynamiken einer globalisierten Welt. Wie hier aktuelle literarische Debatten um Autofiktion und kulturelle Aneignung mit politischen Fragen über westliche Selbstgefälligkeit und den War on Terror verwoben werden, ist nicht nur höchst raffiniert, sondern eröffnet Perspektiven, wie nur die Literatur es kann.
Einmal philosophiert Amar, dass ein Mensch zwar einen Spiegel auf jedes beliebige Objekt richten könne, aber dabei doch immer von einer Sache eingeschränkt werde: „Es führt nichts um die Tatsache herum, dass sie immer diejenige sein wird, die den Spiegel hält.“ Lisa Halliday zerbricht in „Asymmetrie“ den Spiegel des klassischen Erzählens und setzt ihn so neu zusammen, dass in den Scherben unsere individuellen blinden Flecken sichtbar werden. Man bleibt in Gedanken bei diesem beeindruckenden Roman, lange nachdem man die letzte Seite gelesen hat. Amazon


