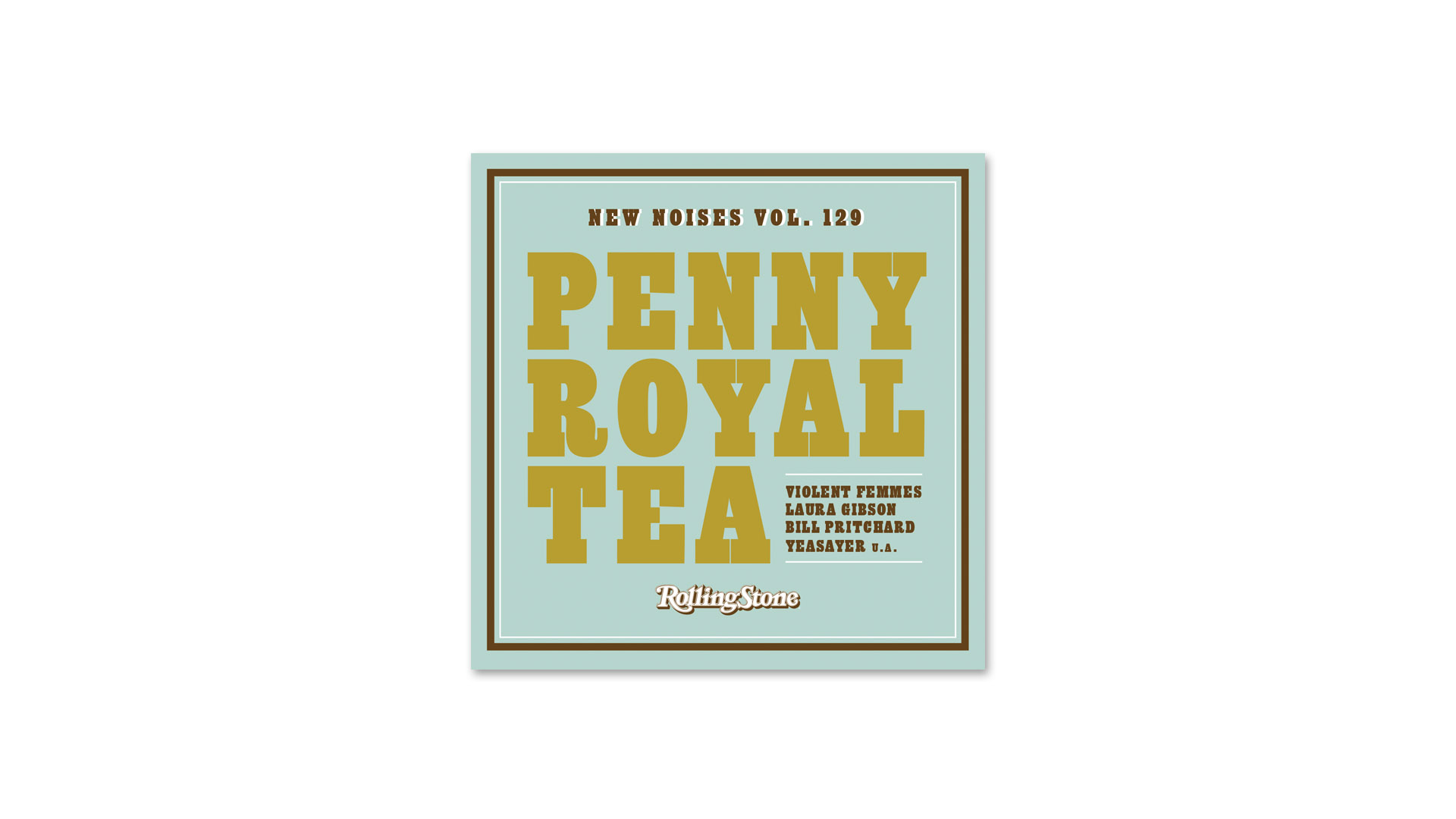Laura Gibson – Erst sägen, dann singen

In einem kleinen Wohnwagen in Portland fand Laura Gibson die Entschlossenheit, die ihren fragilen Folksongs bisher fehlte.
Wenn Laura Gibson mal Ruhe braucht, fährt sie nach La Grande. Das ist – dem pompösen Namen zum Trotz – eine Kleinstadt im Osten Oregons. Oft ist die Songschreiberin nicht dort, denn sie hat es sich im heimischen Portland schon ganz gemütlich gemacht. Dennoch gefällt ihr der Ort so gut, dass ihr neues, drittes Album nun „La Grande“ heißt. „Da ist gar nichts los, wenn nicht gerade ein Tourbus dort zusammenbricht – was allerdings häufiger passiert. Es ist quasi das Bermudadreieck Oregons.“ Sie kichert kurz und fährt sich wieder durch die Haare. Erzählt kurzatmig weiter, nestelt an ihrem riesigen Schal herum.
Gibson wirkt auf den ersten Blick nicht so, aber wenn es um ihre Musik geht, ist sie sehr entschlossen. Den Feen-Folk ihrer ersten beiden Alben hat sie nun opulenter gestaltet, die Lieder verdichtet und das Instrumentarium ausgebaut. Zwei Monate lang erlaubte sie sich, mit allen möglichen Details herumzuspielen, erst danach fing sie an zu sortieren und zu destillieren. „Ich bin oft ein eher vorsichtiger Mensch“, sagt die immer selbstkritische Sängerin. „Aber jetzt wollte ich mal ein Risiko eingehen und einfach alles ausprobieren, was mir in den Kopf kommt, auch wenn es vielleicht erst mal gar nicht zu mir passt.“ Dass sie für ihr vorheriges Album, „Beasts Of Seasons“, überschwängliche Kritiken bekommen hatte, stand ihr dabei nicht im Weg. „Komischerweise hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das noch übertreffen muss. Die Aufnahmen fielen gerade auf die paar Monate in meinem Leben, in denen mir alles scheißegal war. Ein flüchtiger Moment der Freiheit, perfekt abgepasst!“ Ein glücklicher Zufall.
So hört man auf „La Grande“ nun zehn fragile Folksongs mit ein bisschen „Bossa-Percussion“, wie Gibson das doppelte Schlagzeug nennt, Flöte und Klarinette, einem Lo-Fi-Mikrofon – und dann tauchen da noch ein paar Typen auf, die Indie-Freunden bestens bekannt sein dürften. So ist das eben in Portland, wo es inzwischen mehr Studios als Starbucks zu geben scheint. Gibson muss lachen. „Man weiß gar nicht, wen man zuerst fragen soll! Ich wusste, dass mein Freund Nate Query von den Decemberists größtenteils den Bass spielen soll, er war gesetzt. Joey Burns von Calexico kam auf der Durchreise im Studio vorbei. Und die Dodos waren auch zufällig in der Stadt. Man kann noch so viel planen, das Beste sind immer die Überraschungen.“
„Time Is Not (Against Us)“ singt sie auf dem neuen Album – ein Mantra, das sie sich immer wieder selbst vorsagt. Denn auch im paradiesischen Portland quälen sich Musiker mit der Frage, wie sie künftig ihre Träume verwirklichen und dabei auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen können. „Ich und viele meiner Freunde haben oft das Gefühl, dass uns die Zeit wegrennt – auch wenn wir erst Anfang 30 sind. Man fragt sich dauernd, ob man genug erreicht hat und wie es weitergehen soll. Die Herausforderung ist, diese Ängste und Zweifel zuzulassen. Sie direkt anzuschauen und zu sagen: Nein, von euch lasse ich mich nicht aufhalten!“
Gibson lebt, ganz Bohemien, in einer WG mit zwei Musikern von Musee Mecanique. Da kommen dauernd Leute vorbei und nehmen im Wohnzimmerstudio Songs auf, sitzen herum und diskutieren: schön, aber manchmal auch anstrengend. Um etwas mehr Raum für sich allein zu haben, kaufte Gibson schließlich einen alten Wohnwagen und baute ihn zum Mini-Studio um. Leider war sie keine sehr geschickte Handwerkerin, bis sie auf diese Idee kam, und ihre Kumpels waren gerade auf Tournee und konnten nicht helfen. Sie machte – wie immer – das Beste daraus: „Die Feststellung, dass ich solche praktischen Dinge doch ganz allein lösen kann, gab mir ein neues Selbstbewusstsein, das sich auch auf meine Musik ausgewirkt hat. Ich wurde sozusagen zur Meisterin im Problemlösen. Erst Sägen und Hämmern, dann Songschreiben und Singen – das ist eine erstaunlich gute Kombination.“