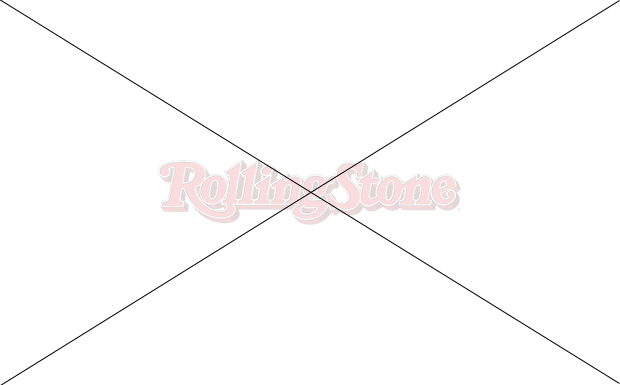Lars von Trier: Der Marionettenspieler
Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde der dänische Regisseur Lars von Trier nach seinem Skandalauftritt zur Persona non grata erklärt. Doch das war nur Teil seiner Inszenierung.

Es war ein bizarrer Monolog, in den sich Lars von Trier während der Pressekonferenz zur Premiere seines Meisterwerkes „Melancholia“ (lesen Sie hier die Rezension) bei den Filmfestspielen in Cannes verstrickte, nachdem eine britische Journalistin nach den „deutschen Wurzeln“ des Regisseurs gefragt hatte, der in „Melancholia“ ausgiebig die Bildwelten der deutschen Romantik zitiert: Unter einem Himmel wie von Caspar David Friedrich sehen in „Melancholia“ zwei ungleiche Schwestern dem Weltende entgegen. Dazu tönt Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Der verwunschene Schauplatz, ein Herrenhaus auf einer schwedischen Insel, ist ins Bild gesetzt wie ein Gemälde von Arnold Böcklin. „Ich habe lange geglaubt, jüdische Wurzeln zu haben“, versuchte von Trier seine ästhetischen Vorlieben zu erläutern. „Dann fand ich heraus, dass ich von deutschen Nazis abstamme, aber das ist auch okay.“ Von seiner Hauptdarstellerin Kirsten Dunst ängstlich angestoßen, steigerte er sich in seine Rede hinein: „Wir Nazis mögen eben das Monumentale.“ Dann lobte er die Architektur des NS-Rüstungsministers Albert Speer und schlug einen alternativen Titel für „Melancholia“ vor: „Die Endlösung“.
Der Verdacht liegt nahe, dass der Filmemacher seinen Skandalauftritt zu einem guten Teil vorher geplant hatte. Schon in einem kurz zuvor erschienenen Newsletter des Dänischen Filminstituts hatte er sich zur Speer-Ästhetik bekannt – und sein Studio wird im Text süffisant als „Führerbunker“ bezeichnet. Dort äußerte der Regisseur zudem die Befürchtung, mit „Melancholia“ seinen bisher gefälligsten Film gedreht zu haben – geradezu „Hollywood-kompatibel“, klagte er. In Cannes konnte er sich nur bestätigt fühlen: Nach der umjubelten Pressevorführung tat er daher alles, um diesen Eindruck zu zerstören. Es dauerte fast 24 Stunden, bis die „Hitler-Rede“ endlich Wirkung zeigte hatte: Als erster Filmemacher wurde von Trier in Cannes zur Persona non grata erklärt – Hausverbot im Festivalpalais inklusive. Sofort wollte man „Melancholia“ vor seinem Schöpfer in Schutz nehmen – als einen seiner besten Filme. Was die von Robert De Niro geleitete Jury dann auch tat, indem sie beide Darstellerinnen prämierte, den Regisseur und Autor jedoch leer ausgehen ließ.
Als Regisseur sieht sich von Trier gern in der Rolle eines Marionettenspielers. Immer wieder locken seine Arbeiten das Publikum in geschickt platzierte Fallen, um ihm die eigene Manipulierbarkeit vor Augen zu halten. Am schönsten in seinem Essayfilm „The Five Obstructions“: Hier spielt er einen Produzenten, der den dänischen Kunstfilmer Jørgen Leth dazu zwingen will, sein eigenes Werk durch schlechte Remakes zu verhunzen. Da „Melancholia“ eine solch zynische Note fehlt, reichte von Trier sie einfach nach. Wenigstens nachträglich sollte man sich als Zuschauer für seine Anteilnahme schämen.
So empörend seine geschmacklosen Äußerungen also sind – man kann sie nicht von seinem künstlerischen Ansatz trennen, in dem es keine Schönheit ohne Leiden gibt, keinen Illusionismus ohne Verfremdungseffekt. Seine besten Filme kamen so zu ihrer Wirkung: diese verblüffende Neuentdeckung des Brecht’schen Verfremdungstheaters „Dogville“. Oder „Breaking The Waves“, das Opferdrama mit Emily Watts, das immer wieder durch Songs von Rod Stewart, Elton John oder Deep Purple unterbrochen wurde. Beide Filme gingen nicht nur in Cannes in die Annalen an, sondern sind bedeutende Momente der Filmgeschichte. Auch als unerwünschte Person kann man Lars von Trier daraus nicht mehr wegradieren.